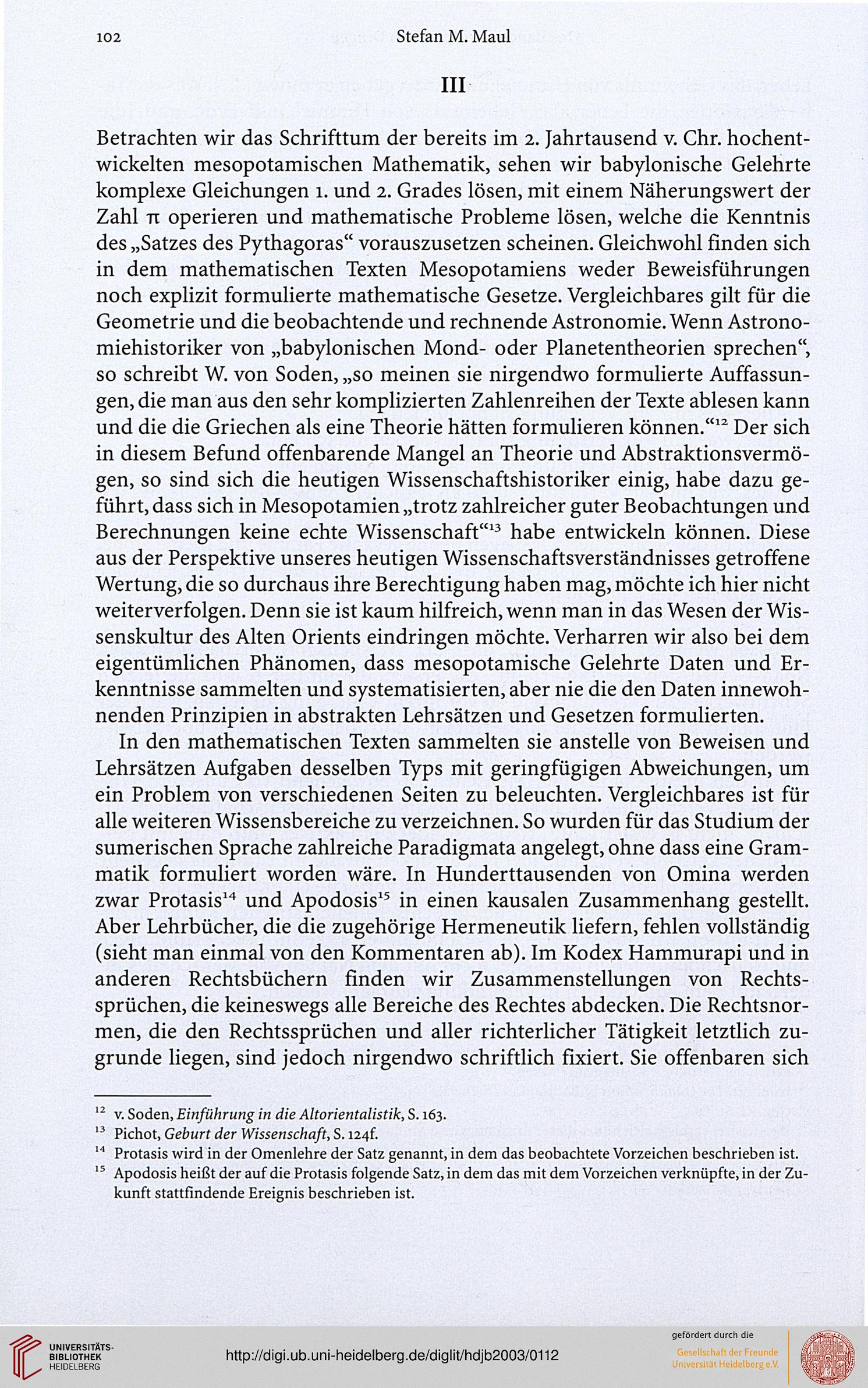102 Stefan M. Maul
III
Betrachten wir das Schrifttum der bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. hochent-
wickelten mesopotamischen Mathematik, sehen wir babylonische Gelehrte
komplexe Gleichungen 1. und 2. Grades lösen, mit einem Näherungswert der
Zahl ix operieren und mathematische Probleme lösen, welche die Kenntnis
des „Satzes des Pythagoras" vorauszusetzen scheinen. Gleichwohl finden sich
in dem mathematischen Texten Mesopotamiens weder Beweisführungen
noch explizit formulierte mathematische Gesetze. Vergleichbares gilt für die
Geometrie und die beobachtende und rechnende Astronomie. Wenn Astrono-
miehistoriker von „babylonischen Mond- oder Planetentheorien sprechen",
so schreibt W. von Soden, „so meinen sie nirgendwo formulierte Auffassun-
gen, die man aus den sehr komplizierten Zahlenreihen der Texte ablesen kann
und die die Griechen als eine Theorie hätten formulieren können."12 Der sich
in diesem Befund offenbarende Mangel an Theorie und Abstraktionsvermö-
gen, so sind sich die heutigen Wissenschaftshistoriker einig, habe dazu ge-
führt, dass sich in Mesopotamien „trotz zahlreicher guter Beobachtungen und
Berechnungen keine echte Wissenschaft"13 habe entwickeln können. Diese
aus der Perspektive unseres heutigen Wissenschaftsverständnisses getroffene
Wertung, die so durchaus ihre Berechtigung haben mag, möchte ich hier nicht
weiterverfolgen. Denn sie ist kaum hilfreich, wenn man in das Wesen der Wis-
senskultur des Alten Orients eindringen möchte. Verharren wir also bei dem
eigentümlichen Phänomen, dass mesopotamische Gelehrte Daten und Er-
kenntnisse sammelten und systematisierten, aber nie die den Daten innewoh-
nenden Prinzipien in abstrakten Lehrsätzen und Gesetzen formulierten.
In den mathematischen Texten sammelten sie anstelle von Beweisen und
Lehrsätzen Aufgaben desselben Typs mit geringfügigen Abweichungen, um
ein Problem von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Vergleichbares ist für
alle weiteren Wissensbereiche zu verzeichnen. So wurden für das Studium der
sumerischen Sprache zahlreiche Paradigmata angelegt, ohne dass eine Gram-
matik formuliert worden wäre. In Hunderttausenden von Omina werden
zwar Protasis14 und Apodosis15 in einen kausalen Zusammenhang gestellt.
Aber Lehrbücher, die die zugehörige Hermeneutik liefern, fehlen vollständig
(sieht man einmal von den Kommentaren ab). Im Kodex Hammurapi und in
anderen Rechtsbüchern finden wir Zusammenstellungen von Rechts-
sprüchen, die keineswegs alle Bereiche des Rechtes abdecken. Die Rechtsnor-
men, die den Rechtssprüchen und aller richterlicher Tätigkeit letztlich zu-
grunde liegen, sind jedoch nirgendwo schriftlich fixiert. Sie offenbaren sich
v. Soden, Einführung in die Altorientalistik, S. 163.
Pichot, Geburt der Wissenschaft, S. i24f.
Protasis wird in der Omenlehre der Satz genannt, in dem das beobachtete Vorzeichen beschrieben ist.
Apodosis heißt der auf die Protasis folgende Satz, in dem das mit dem Vorzeichen verknüpfte, in der Zu-
kunft stattfindende Ereignis beschrieben ist.
III
Betrachten wir das Schrifttum der bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. hochent-
wickelten mesopotamischen Mathematik, sehen wir babylonische Gelehrte
komplexe Gleichungen 1. und 2. Grades lösen, mit einem Näherungswert der
Zahl ix operieren und mathematische Probleme lösen, welche die Kenntnis
des „Satzes des Pythagoras" vorauszusetzen scheinen. Gleichwohl finden sich
in dem mathematischen Texten Mesopotamiens weder Beweisführungen
noch explizit formulierte mathematische Gesetze. Vergleichbares gilt für die
Geometrie und die beobachtende und rechnende Astronomie. Wenn Astrono-
miehistoriker von „babylonischen Mond- oder Planetentheorien sprechen",
so schreibt W. von Soden, „so meinen sie nirgendwo formulierte Auffassun-
gen, die man aus den sehr komplizierten Zahlenreihen der Texte ablesen kann
und die die Griechen als eine Theorie hätten formulieren können."12 Der sich
in diesem Befund offenbarende Mangel an Theorie und Abstraktionsvermö-
gen, so sind sich die heutigen Wissenschaftshistoriker einig, habe dazu ge-
führt, dass sich in Mesopotamien „trotz zahlreicher guter Beobachtungen und
Berechnungen keine echte Wissenschaft"13 habe entwickeln können. Diese
aus der Perspektive unseres heutigen Wissenschaftsverständnisses getroffene
Wertung, die so durchaus ihre Berechtigung haben mag, möchte ich hier nicht
weiterverfolgen. Denn sie ist kaum hilfreich, wenn man in das Wesen der Wis-
senskultur des Alten Orients eindringen möchte. Verharren wir also bei dem
eigentümlichen Phänomen, dass mesopotamische Gelehrte Daten und Er-
kenntnisse sammelten und systematisierten, aber nie die den Daten innewoh-
nenden Prinzipien in abstrakten Lehrsätzen und Gesetzen formulierten.
In den mathematischen Texten sammelten sie anstelle von Beweisen und
Lehrsätzen Aufgaben desselben Typs mit geringfügigen Abweichungen, um
ein Problem von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Vergleichbares ist für
alle weiteren Wissensbereiche zu verzeichnen. So wurden für das Studium der
sumerischen Sprache zahlreiche Paradigmata angelegt, ohne dass eine Gram-
matik formuliert worden wäre. In Hunderttausenden von Omina werden
zwar Protasis14 und Apodosis15 in einen kausalen Zusammenhang gestellt.
Aber Lehrbücher, die die zugehörige Hermeneutik liefern, fehlen vollständig
(sieht man einmal von den Kommentaren ab). Im Kodex Hammurapi und in
anderen Rechtsbüchern finden wir Zusammenstellungen von Rechts-
sprüchen, die keineswegs alle Bereiche des Rechtes abdecken. Die Rechtsnor-
men, die den Rechtssprüchen und aller richterlicher Tätigkeit letztlich zu-
grunde liegen, sind jedoch nirgendwo schriftlich fixiert. Sie offenbaren sich
v. Soden, Einführung in die Altorientalistik, S. 163.
Pichot, Geburt der Wissenschaft, S. i24f.
Protasis wird in der Omenlehre der Satz genannt, in dem das beobachtete Vorzeichen beschrieben ist.
Apodosis heißt der auf die Protasis folgende Satz, in dem das mit dem Vorzeichen verknüpfte, in der Zu-
kunft stattfindende Ereignis beschrieben ist.