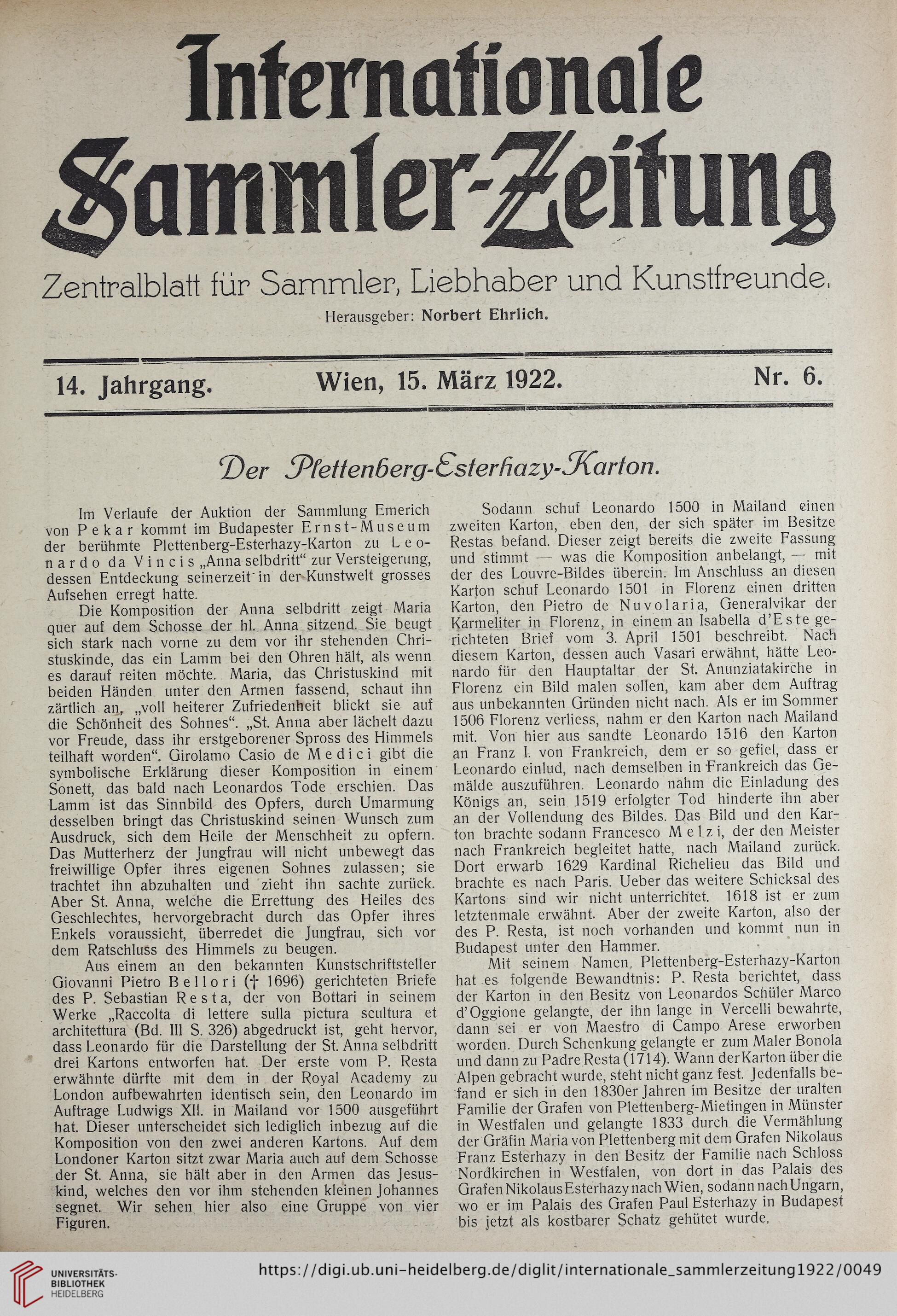Internationale
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde,
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
Nr. 6.
Wien, 15. März 1922.
14. Jahrgang.
2)er SPfettenßergSsterfiazy-SKarton.
Im Verlaufe der Auktion der Sammlung Emerich
von Pekar kommt im Budapester Ernst-Museum
der berühmte Plettenberg-Esterhazy-Karton zu Leo-
nardo da Vincis „Anna selbdritt“ zur Versteigerung,
dessen Entdeckung seinerzeit’in der Kunstwelt grosses
Aufsehen erregt hatte.
Die Komposition der Anna selbdritt zeigt Maria
quer auf dem Schosse der hl. Anna sitzend. Sie beugt
sich stark nach vorne zu dem vor ihr stehenden Chri-
stuskinde, das ein Lamm bei den Ohren hält, als wenn
es darauf reiten möchte. Maria, das Christuskind mit
beiden Händen unter den Armen fassend, schaut ihn
zärtlich an, „voll heiterer Zufriedenheit blickt sie auf
die Schönheit des Sohnes“. „St. Anna aber lächelt dazu
vor Freude, dass ihr erstgeborener Spross des Himmels
teilhaft worden“. Girolamo Casio de Medici gibt die
symbolische Erklärung dieser Komposition in einem
Sonett, das bald nach Leonardos Tode erschien. Das
Lamm ist das Sinnbild des Opfers, durch Umarmung
desselben bringt das Christuskind seinen Wunsch zum
Ausdruck, sich dem Heile der Menschheit zu opfern.
Das Mutterherz der Jungfrau will nicht unbewegt das
freiwillige Opfer ihres eigenen Sohnes zulassen; sie
trachtet ihn abzuhalten und zieht ihn sachte zurück.
Aber St. Anna, welche die Errettung des Heiles des
Geschlechtes, hervorgebracht durch das Opfer ihres
Enkels voraussieht, überredet die Jungfrau, sich vor
dem Ratschluss des Himmels zu beugen.
Aus einem an den bekannten Kunstschriftsteller
Giovanni Pietro Bellori (f 1696) gerichteten Briefe
des P. Sebastian Resta, der von Bottari in seinem
Werke „Raccolta di lettere sulla pictura scultura et
architettura (Bd. III S. 326) abgedruckt ist, geht hervor,
dass Leonardo für die Darstellung der St. Anna selbdritt
drei Kartons entworfen hat. Der erste vom P. Resta
erwähnte dürfte mit dem in der Royal Academy zu
London aufbewahrten identisch sein, den Leonardo im
Auftrage Ludwigs XII. in Mailand vor 1500 ausgeführt
hat. Dieser unterscheidet sich lediglich inbezug auf die
Komposition von den zwei anderen Kartons. Auf dem
Londoner Karton sitzt zwar Maria auch auf dem Schosse
der St. Anna, sie hält aber in den Armen das Jesus-
kind, welches den vor ihm stehenden kleinen Johannes
segnet. Wir sehen hier also eine Gruppe von vier
Figuren.
Sodann schuf Leonardo 1500 in Mailand einen
zweiten Karton, eben den, der sich später im Besitze
Restas befand. Dieser zeigt bereits die zweite Fassung
und stimmt — was die Komposition anbelangt, — mit
der des Louvre-Bildes überein. Im Anschluss an diesen
Karton schuf Leonardo 1501 in Florenz einen dritten
Karton, den Pietro de Nuvolaria, Generalvikar der
Karmeliter in Florenz, in einem an Isabella d’Este ge-
richteten Brief vom 3. April 1501 beschreibt. Nach
diesem Karton, dessen auch Vasari erwähnt, hätte Leo-
nardo für den Hauptaltar der St. Anunziatakirche in
Florenz ein Bild malen sollen, kam aber dem Auftrag
aus unbekannten Gründen nicht nach. Als er im Sommer
1506 Florenz verliess, nahm er den Karton nach Mailand
mit. Von hier aus sandte Leonardo 1516 den Karton
an Franz I. von Frankreich, dem er so gefiel, dass er
Leonardo einlud, nach demselben in Frankreich das Ge-
mälde auszuführen. Leonardo nahm die Einladung des
Königs an, sein 1519 erfolgter Tod hinderte ihn aber
an der Vollendung des Bildes. Das Bild und den Kar-
ton brachte sodann Francesco M e 1 z i, der den Meister
nach Frankreich begleitet hatte, nach Mailand zurück.
Dort erwarb 1629 Kardinal Richelieu das Bild und
brachte es nach Paris. Ueber das weitere Schicksal des
Kartons sind wir nicht unterrichtet. 1618 ist er zum
letztenmale erwähnt. Aber der zweite Karton, also der
des P. Resta, ist noch vorhanden und kommt nun in
Budapest unter den Hammer.
Mit seinem Namen. Plettenberg-Esterhazy-Karton
hat es folgende Bewandtnis: P. Resta berichtet, dass
der Karton in den Besitz von Leonardos Schüler Marco
d’Oggione gelangte, der ihn lange in Vercelli bewahrte,
dann sei er von Maestro di Campo Arese erworben
worden. Durch Schenkung gelangte er zum Maler Bonola
und dann zu Padre Resta (1714). Wann derKarton über die
Alpen gebracht wurde, steht nicht ganz fest. Jedenfalls be-
fand er sich in den 1830er Jahren im Besitze der uralten
Familie der Grafen von Plettenberg-Mietingen in Münster
in Westfalen und gelangte 1833 durch die Vermählung
der Gräfin Maria von Plettenberg mit dem Grafen Nikolaus
Franz Esterhazy in den Besitz der Familie nach Schloss
Nordkirchen in Westfalen, von dort in das Palais des
Grafen Nikolaus Esterhazy nach Wien, sodann nach Ungarn,
wo er im Palais des Grafen Paul Esterhazy in Budapest
bis jetzt als kostbarer Schatz gehütet wurde,
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde,
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
Nr. 6.
Wien, 15. März 1922.
14. Jahrgang.
2)er SPfettenßergSsterfiazy-SKarton.
Im Verlaufe der Auktion der Sammlung Emerich
von Pekar kommt im Budapester Ernst-Museum
der berühmte Plettenberg-Esterhazy-Karton zu Leo-
nardo da Vincis „Anna selbdritt“ zur Versteigerung,
dessen Entdeckung seinerzeit’in der Kunstwelt grosses
Aufsehen erregt hatte.
Die Komposition der Anna selbdritt zeigt Maria
quer auf dem Schosse der hl. Anna sitzend. Sie beugt
sich stark nach vorne zu dem vor ihr stehenden Chri-
stuskinde, das ein Lamm bei den Ohren hält, als wenn
es darauf reiten möchte. Maria, das Christuskind mit
beiden Händen unter den Armen fassend, schaut ihn
zärtlich an, „voll heiterer Zufriedenheit blickt sie auf
die Schönheit des Sohnes“. „St. Anna aber lächelt dazu
vor Freude, dass ihr erstgeborener Spross des Himmels
teilhaft worden“. Girolamo Casio de Medici gibt die
symbolische Erklärung dieser Komposition in einem
Sonett, das bald nach Leonardos Tode erschien. Das
Lamm ist das Sinnbild des Opfers, durch Umarmung
desselben bringt das Christuskind seinen Wunsch zum
Ausdruck, sich dem Heile der Menschheit zu opfern.
Das Mutterherz der Jungfrau will nicht unbewegt das
freiwillige Opfer ihres eigenen Sohnes zulassen; sie
trachtet ihn abzuhalten und zieht ihn sachte zurück.
Aber St. Anna, welche die Errettung des Heiles des
Geschlechtes, hervorgebracht durch das Opfer ihres
Enkels voraussieht, überredet die Jungfrau, sich vor
dem Ratschluss des Himmels zu beugen.
Aus einem an den bekannten Kunstschriftsteller
Giovanni Pietro Bellori (f 1696) gerichteten Briefe
des P. Sebastian Resta, der von Bottari in seinem
Werke „Raccolta di lettere sulla pictura scultura et
architettura (Bd. III S. 326) abgedruckt ist, geht hervor,
dass Leonardo für die Darstellung der St. Anna selbdritt
drei Kartons entworfen hat. Der erste vom P. Resta
erwähnte dürfte mit dem in der Royal Academy zu
London aufbewahrten identisch sein, den Leonardo im
Auftrage Ludwigs XII. in Mailand vor 1500 ausgeführt
hat. Dieser unterscheidet sich lediglich inbezug auf die
Komposition von den zwei anderen Kartons. Auf dem
Londoner Karton sitzt zwar Maria auch auf dem Schosse
der St. Anna, sie hält aber in den Armen das Jesus-
kind, welches den vor ihm stehenden kleinen Johannes
segnet. Wir sehen hier also eine Gruppe von vier
Figuren.
Sodann schuf Leonardo 1500 in Mailand einen
zweiten Karton, eben den, der sich später im Besitze
Restas befand. Dieser zeigt bereits die zweite Fassung
und stimmt — was die Komposition anbelangt, — mit
der des Louvre-Bildes überein. Im Anschluss an diesen
Karton schuf Leonardo 1501 in Florenz einen dritten
Karton, den Pietro de Nuvolaria, Generalvikar der
Karmeliter in Florenz, in einem an Isabella d’Este ge-
richteten Brief vom 3. April 1501 beschreibt. Nach
diesem Karton, dessen auch Vasari erwähnt, hätte Leo-
nardo für den Hauptaltar der St. Anunziatakirche in
Florenz ein Bild malen sollen, kam aber dem Auftrag
aus unbekannten Gründen nicht nach. Als er im Sommer
1506 Florenz verliess, nahm er den Karton nach Mailand
mit. Von hier aus sandte Leonardo 1516 den Karton
an Franz I. von Frankreich, dem er so gefiel, dass er
Leonardo einlud, nach demselben in Frankreich das Ge-
mälde auszuführen. Leonardo nahm die Einladung des
Königs an, sein 1519 erfolgter Tod hinderte ihn aber
an der Vollendung des Bildes. Das Bild und den Kar-
ton brachte sodann Francesco M e 1 z i, der den Meister
nach Frankreich begleitet hatte, nach Mailand zurück.
Dort erwarb 1629 Kardinal Richelieu das Bild und
brachte es nach Paris. Ueber das weitere Schicksal des
Kartons sind wir nicht unterrichtet. 1618 ist er zum
letztenmale erwähnt. Aber der zweite Karton, also der
des P. Resta, ist noch vorhanden und kommt nun in
Budapest unter den Hammer.
Mit seinem Namen. Plettenberg-Esterhazy-Karton
hat es folgende Bewandtnis: P. Resta berichtet, dass
der Karton in den Besitz von Leonardos Schüler Marco
d’Oggione gelangte, der ihn lange in Vercelli bewahrte,
dann sei er von Maestro di Campo Arese erworben
worden. Durch Schenkung gelangte er zum Maler Bonola
und dann zu Padre Resta (1714). Wann derKarton über die
Alpen gebracht wurde, steht nicht ganz fest. Jedenfalls be-
fand er sich in den 1830er Jahren im Besitze der uralten
Familie der Grafen von Plettenberg-Mietingen in Münster
in Westfalen und gelangte 1833 durch die Vermählung
der Gräfin Maria von Plettenberg mit dem Grafen Nikolaus
Franz Esterhazy in den Besitz der Familie nach Schloss
Nordkirchen in Westfalen, von dort in das Palais des
Grafen Nikolaus Esterhazy nach Wien, sodann nach Ungarn,
wo er im Palais des Grafen Paul Esterhazy in Budapest
bis jetzt als kostbarer Schatz gehütet wurde,