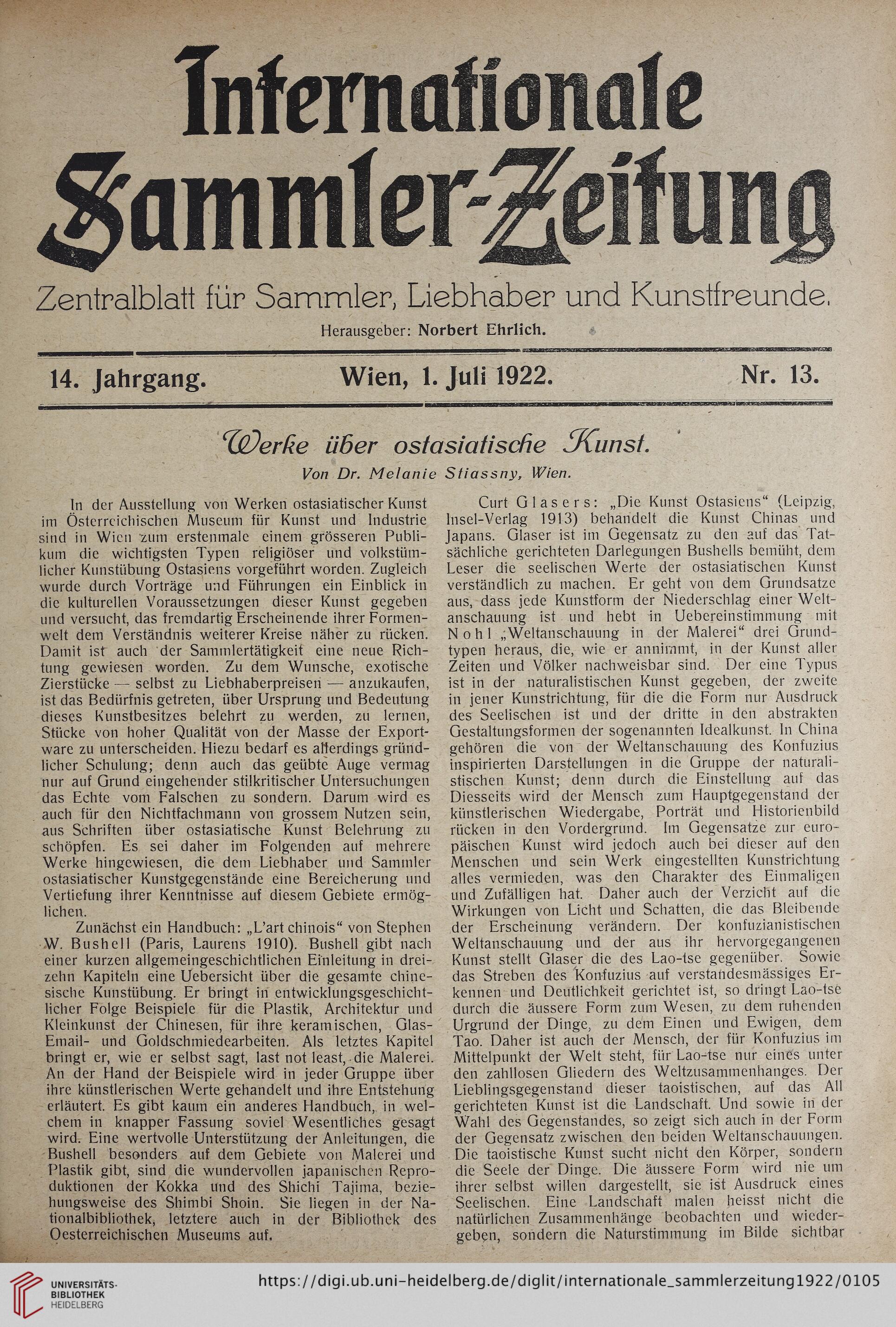Tnfernalionalß
^ammlßr-^ßifunfl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
14. Jahrgang. Wien, 1. Juli 1922. Nr. 13.
cCßJerke üßer ostasiatiscfie SKunst.
Von Dr. Melanie Stiassny, Wien.
In der Ausstellung von Werken ostasiatischer Kunst
im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
sind in Wien zum erstenmalc einem grösseren Publi-
kum die wichtigsten Typen religiöser und volkstüm-
licher Kunstübung Ostasiens vorgeführt worden. Zugleich
wurde durch Vorträge und Führungen ein Einblick in
die kulturellen Voraussetzungen dieser Kunst gegeben
und versucht, das fremdartig Erscheinende ihrer Formen-
welt dem Verständnis weiterer Kreise näher zu rücken.
Damit ist auch der Sammlertätigkeit eine neue Rich-
tung gewiesen worden. Zu dem Wunsche, exotische
Zierstücke — selbst zu Liebhaberpreisen — anzukaufen,
ist das Bedürfnis getreten, über Ursprung und Bedeutung
dieses Kunstbesitzes belehrt zu werden, zu lernen,
Stücke von hoher Qualität von der Masse der Export-
ware zu unterscheiden. Hiezu bedarf es allerdings gründ-
licher Schulung; denn auch das geübte Auge vermag
nur auf Grund eingehender stilkritischer Untersuchungen
das Echte vom Falschen zu sondern. Darum wird es
auch für den Nichtfachmann von grossem Nutzen sein,
aus Schriften über ostasiatische Kunst Belehrung zu
schöpfen. Es sei daher im Folgenden auf mehrere
Werke hingewiesen, die dem Liebhaber und Sammler
ostasiatischer Kunstgegenstände eine Bereicherung und
Vertiefung ihrer Kenntnisse auf diesem Gebiete ermög-
lichen.
Zunächst ein Handbuch: „L’art chinois“ von Stephen
W. Bushell (Paris, Laurens 1910). Bushell gibt nach
einer kurzen allgemeingeschichtlichen Einleitung in drei-
zehn Kapiteln eine Uebersicht über die gesamte chine-
sische Kunstübung. Er bringt in entwicklungsgeschicht-
licher Folge Beispiele für die Plastik, Architektur und
Kleinkunst der Chinesen, für ihre keramischen, Glas-
Email- und Goldschmiedearbeiten. Als letztes Kapitel
bringt er, wie er selbst sagt, last not least, die Malerei.
An der Hand der Beispiele wird in jeder Gruppe über
ihre künstlerischen Werte gehandelt und ihre Entstehung
erläutert. Es gibt kaum ein anderes Handbuch, in wel-
chem in knapper Fassung soviel Wesentliches gesagt
wird. Eine wertvolle Unterstützung der Anleitungen, die
Bushell besonders auf dem Gebiete von Malerei und
Plastik gibt, sind die wundervollen japanischen Repro-
duktionen der Kokka und des Shichi Tajima, bezie-
hungsweise des Shimbi Shoin. Sie liegen in der Na-
tionalbibliothek, letztere auch in der Bibliothek des
Oesterreichischen Museums auf.
Curt Glasers: „Die Kunst Ostasiens“ (Leipzig,
Insel-Verlag 1913) behandelt die Kunst Chinas und
Japans. Glaser ist im Gegensatz zu den auf das Tat-
sächliche gerichteten Darlegungen Bushells bemüht, dem
Leser die seelischen Werte der ostasiatischen Kunst
verständlich zu machen. Er geht von dem Grundsätze
aus, dass jede Kunstform der Niederschlag einer Welt-
anschauung ist und hebt in Uebereinstimmung mit
Nohl ,;Weltanschauung in der Malerei“ drei Grund-
typen heraus, die, wie er annimmt, in der Kunst aller
Zeiten und Völker nachweisbar sind. Der eine Typus
ist in der naturalistischen Kunst gegeben, der zweite
in jener Kunstrichtung, für die die Form nur Ausdruck
des Seelischen ist und der dritte in den abstrakten
Gestaltungsformen der sogenannten Idealkunst. In China
gehören die von der Weltanschauung des Konfuzius
inspirierten Darstellungen in die Gruppe der naturali-
stischen Kunst; denn durch die Einstellung auf das
Diesseits wird der Mensch zum Hauptgegenstand der
künstlerischen Wiedergabe, Porträt und Historienbild
rücken in den Vordergrund. Im Gegensätze zur euro-
päischen Kunst wird jedoch auch bei dieser auf den
Menschen und sein Werk eingestellten Kunstrichtung
alles vermieden, was den Charakter des Einmaligen
und Zufälligen hat. Daher auch der Verzicht auf die
Wirkungen von Licht und Schatten, die das Bleibende
der Erscheinung verändern. Der konfuzianistischen
Weltanschauung und der aus ihr hervorgegangenen
Kunst stellt Glaser die des Lao-tse gegenüber. Sowie
das Streben des Konfuzius auf verstandesmässiges Er-
kennen und Deutlichkeit gerichtet ist, so dringt Lao-tse
durch die äussere Form zum Wesen, zu dem ruhenden
Urgrund der Dinge, zu dem Einen und Ewigen, dem
Tao. Daher ist auch der Mensch, der für Konfuzius im
Mittelpunkt der Welt steht, für Lao-tse nur eines unter
den zahllosen Gliedern des Weltzusammenhanges. Der
Lieblingsgegenstand dieser taoistischen, auf das All
gerichteten Kunst ist die Landschaft. Und sowie in der
Wahl des Gegenstandes, so zeigt sich auch in der Form
der Gegensatz zwischen den beiden Weltanschauungen.
Die taoistische Kunst sucht nicht den Körper, sondern
die Seele der Dinge. Die äussere Form wird nie um
ihrer selbst willen dargestellt, sie ist Ausdruck eines
Seelischen. Eine Landschaft malen heisst nicht die
natürlichen Zusammenhänge beobachten und wieder-
geben, sondern die Naturstimmung im Bilde sichtbar
^ammlßr-^ßifunfl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
14. Jahrgang. Wien, 1. Juli 1922. Nr. 13.
cCßJerke üßer ostasiatiscfie SKunst.
Von Dr. Melanie Stiassny, Wien.
In der Ausstellung von Werken ostasiatischer Kunst
im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie
sind in Wien zum erstenmalc einem grösseren Publi-
kum die wichtigsten Typen religiöser und volkstüm-
licher Kunstübung Ostasiens vorgeführt worden. Zugleich
wurde durch Vorträge und Führungen ein Einblick in
die kulturellen Voraussetzungen dieser Kunst gegeben
und versucht, das fremdartig Erscheinende ihrer Formen-
welt dem Verständnis weiterer Kreise näher zu rücken.
Damit ist auch der Sammlertätigkeit eine neue Rich-
tung gewiesen worden. Zu dem Wunsche, exotische
Zierstücke — selbst zu Liebhaberpreisen — anzukaufen,
ist das Bedürfnis getreten, über Ursprung und Bedeutung
dieses Kunstbesitzes belehrt zu werden, zu lernen,
Stücke von hoher Qualität von der Masse der Export-
ware zu unterscheiden. Hiezu bedarf es allerdings gründ-
licher Schulung; denn auch das geübte Auge vermag
nur auf Grund eingehender stilkritischer Untersuchungen
das Echte vom Falschen zu sondern. Darum wird es
auch für den Nichtfachmann von grossem Nutzen sein,
aus Schriften über ostasiatische Kunst Belehrung zu
schöpfen. Es sei daher im Folgenden auf mehrere
Werke hingewiesen, die dem Liebhaber und Sammler
ostasiatischer Kunstgegenstände eine Bereicherung und
Vertiefung ihrer Kenntnisse auf diesem Gebiete ermög-
lichen.
Zunächst ein Handbuch: „L’art chinois“ von Stephen
W. Bushell (Paris, Laurens 1910). Bushell gibt nach
einer kurzen allgemeingeschichtlichen Einleitung in drei-
zehn Kapiteln eine Uebersicht über die gesamte chine-
sische Kunstübung. Er bringt in entwicklungsgeschicht-
licher Folge Beispiele für die Plastik, Architektur und
Kleinkunst der Chinesen, für ihre keramischen, Glas-
Email- und Goldschmiedearbeiten. Als letztes Kapitel
bringt er, wie er selbst sagt, last not least, die Malerei.
An der Hand der Beispiele wird in jeder Gruppe über
ihre künstlerischen Werte gehandelt und ihre Entstehung
erläutert. Es gibt kaum ein anderes Handbuch, in wel-
chem in knapper Fassung soviel Wesentliches gesagt
wird. Eine wertvolle Unterstützung der Anleitungen, die
Bushell besonders auf dem Gebiete von Malerei und
Plastik gibt, sind die wundervollen japanischen Repro-
duktionen der Kokka und des Shichi Tajima, bezie-
hungsweise des Shimbi Shoin. Sie liegen in der Na-
tionalbibliothek, letztere auch in der Bibliothek des
Oesterreichischen Museums auf.
Curt Glasers: „Die Kunst Ostasiens“ (Leipzig,
Insel-Verlag 1913) behandelt die Kunst Chinas und
Japans. Glaser ist im Gegensatz zu den auf das Tat-
sächliche gerichteten Darlegungen Bushells bemüht, dem
Leser die seelischen Werte der ostasiatischen Kunst
verständlich zu machen. Er geht von dem Grundsätze
aus, dass jede Kunstform der Niederschlag einer Welt-
anschauung ist und hebt in Uebereinstimmung mit
Nohl ,;Weltanschauung in der Malerei“ drei Grund-
typen heraus, die, wie er annimmt, in der Kunst aller
Zeiten und Völker nachweisbar sind. Der eine Typus
ist in der naturalistischen Kunst gegeben, der zweite
in jener Kunstrichtung, für die die Form nur Ausdruck
des Seelischen ist und der dritte in den abstrakten
Gestaltungsformen der sogenannten Idealkunst. In China
gehören die von der Weltanschauung des Konfuzius
inspirierten Darstellungen in die Gruppe der naturali-
stischen Kunst; denn durch die Einstellung auf das
Diesseits wird der Mensch zum Hauptgegenstand der
künstlerischen Wiedergabe, Porträt und Historienbild
rücken in den Vordergrund. Im Gegensätze zur euro-
päischen Kunst wird jedoch auch bei dieser auf den
Menschen und sein Werk eingestellten Kunstrichtung
alles vermieden, was den Charakter des Einmaligen
und Zufälligen hat. Daher auch der Verzicht auf die
Wirkungen von Licht und Schatten, die das Bleibende
der Erscheinung verändern. Der konfuzianistischen
Weltanschauung und der aus ihr hervorgegangenen
Kunst stellt Glaser die des Lao-tse gegenüber. Sowie
das Streben des Konfuzius auf verstandesmässiges Er-
kennen und Deutlichkeit gerichtet ist, so dringt Lao-tse
durch die äussere Form zum Wesen, zu dem ruhenden
Urgrund der Dinge, zu dem Einen und Ewigen, dem
Tao. Daher ist auch der Mensch, der für Konfuzius im
Mittelpunkt der Welt steht, für Lao-tse nur eines unter
den zahllosen Gliedern des Weltzusammenhanges. Der
Lieblingsgegenstand dieser taoistischen, auf das All
gerichteten Kunst ist die Landschaft. Und sowie in der
Wahl des Gegenstandes, so zeigt sich auch in der Form
der Gegensatz zwischen den beiden Weltanschauungen.
Die taoistische Kunst sucht nicht den Körper, sondern
die Seele der Dinge. Die äussere Form wird nie um
ihrer selbst willen dargestellt, sie ist Ausdruck eines
Seelischen. Eine Landschaft malen heisst nicht die
natürlichen Zusammenhänge beobachten und wieder-
geben, sondern die Naturstimmung im Bilde sichtbar