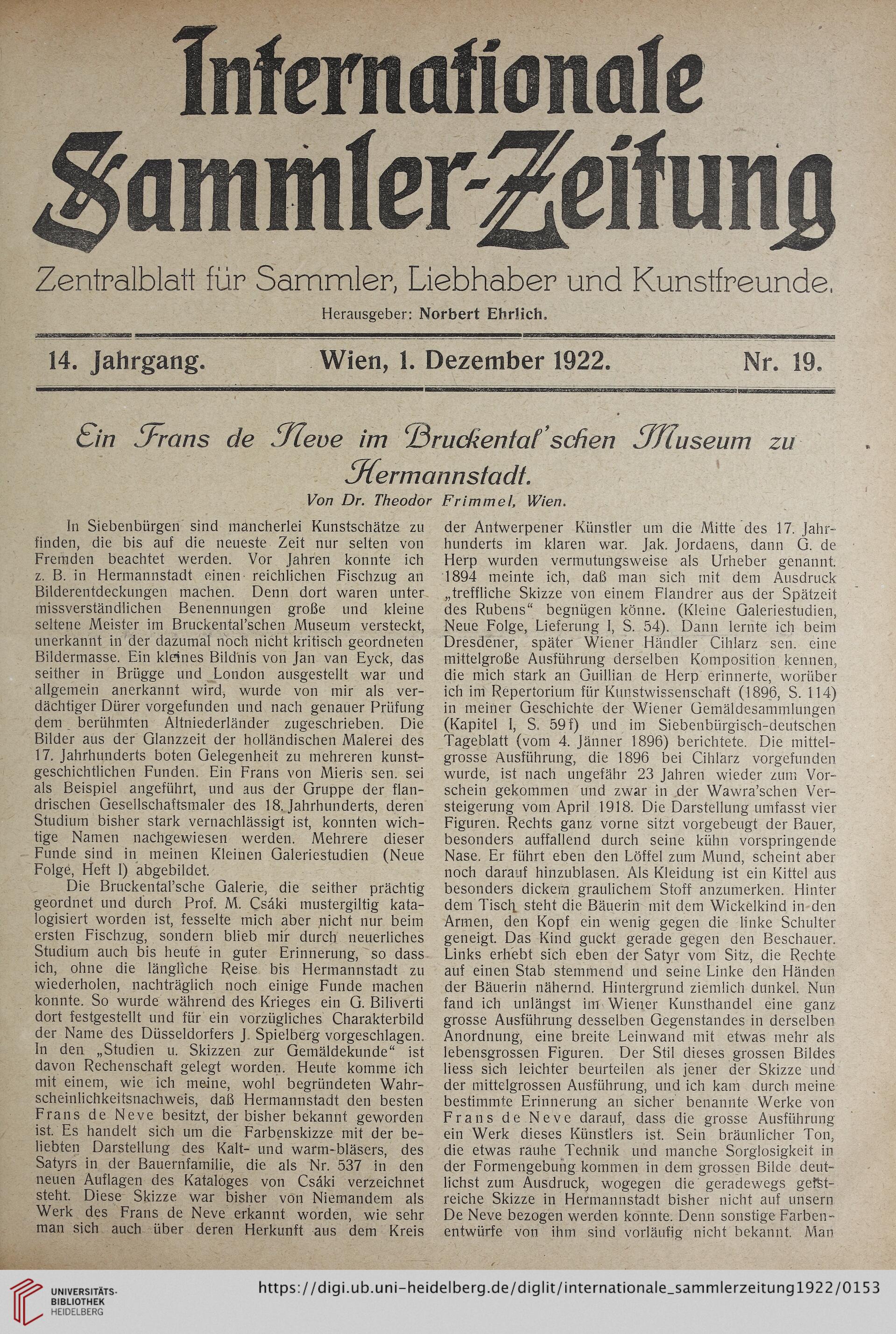Tnfentdfiondfe
^ammtßF^ßifuiiß
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde,
Herausgeber: Norbert Ehrlich,
14. Jahrgang. Wien, 1. Dezember 1922. Nr. 19.
Sin .Trans de ffeve im ‘\Brudieniaf’sehen FTluseum zu
Tlermannstadf.
Von Dr. Theodor Frimmel, Wien.
In Siebenbürgen sind mancherlei Kunstschätze zu
finden, die bis auf die neueste Zeit nur selten von
Fremden beachtet werden. Vor Jahren konnte ich
z. B. in Hermannstadt einen reichlichen Fischzug an
Bilderentdeckungen machen. Denn dort waren unter
missverständlichen Benennungen große und kleine
seltene Meister im Bruckental’schen Museum versteckt,
unerkannt in der dazumal noch nicht kritisch geordneten
Bildermasse. Ein kleines Bildnis von Jan van Eyck, das
seither in Brügge und London ausgestellt war und
allgemein anerkannt wird, wurde von mir als ver-
dächtiger Dürer vorgefunden und nach genauer Prüfung
dem . berühmten Altniederländer zugeschrieben. Die
Bilder aus der Glanzzeit der holländischen Malerei des
17. Jahrhunderts boten Gelegenheit zu mehreren kunst-
geschichtlichen Funden. Ein Frans von Mieris sen. sei
als Beispiel angeführt, und aus der Gruppe der flan-
drischen Gesellschaftsmaler des 18. Jahrhunderts, deren
Studium bisher stark vernachlässigt ist, konnten wich-
tige Namen nachgewiesen werden. Mehrere dieser
Funde sind in meinen Kleinen Galeriestudien (Neue
Folge, Heft 1) abgebildet.
Die Bruckental’sche Galerie, die seither prächtig
geordnet und durch Prof. M. Csäki mustergiltig kata-
logisiert worden ist, fesselte mich aber nicht nur beim
ersten Fischzug, sondern blieb mir durch neuerliches
Studium auch bis heute in guter Erinnerung, so dass
ich, ohne die längliche Reise bis Hermannstadt zu
wiederholen, nachträglich noch einige Funde machen
konnte. So wurde während des Krieges ein G. Biliverti
dort festgestellt und für ein vorzügliches Charakterbild
der Name des Düsseldorfers J. Spielberg vorgeschlagen.
In den „Studien u. Skizzen zur Gemäldekunde“ ist
davon Rechenschaft gelegt worden. Heute komme ich
mit einem, wie ich meine, wohl begründeten Wahr-
scheinlichkeitsnachweis, daß Hermannstadt den besten
Frans de Neve besitzt, der bisher bekannt geworden
ist. Es handelt sich um die Farbenskizze mit der be-
liebten Darstellung des Kalt- und warm-bläsers, des
Satyrs in der Bauernfamilie, die als Nr. 537 in den
neuen Auflagen des Kataloges von Csäki verzeichnet
steht. Diese Skizze war bisher von Niemandem als
Werk des Frans de Neve erkannt worden, wie sehr
man sich auch über deren Herkunft aus dem Kreis
der Antwerpener Künstler um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts im klaren war. Jak. Jordaens, dann G. de
Herp wurden vermutungsweise als Urheber genannt.
1894 meinte ich, daß man sich mit dem Ausdruck
„treffliche Skizze von einem Flandrer aus der Spätzeit
des Rubens“ begnügen könne. (Kleine Galeriestudien,
Neue Folge, Lieferung I, S. 54). Dann lernte ich beim
Dresdener, später Wiener Händler Cihlarz sen. eine
mittelgroße Ausführung derselben Komposition kennen,
die mich stark an Guillian de Herp erinnerte, worüber
ich im Repertorium für Kunstwissenschaft (1896, S. 114)
in meiner Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen
(Kapitel I, S. 59f) und im Siebenbürgisch-deutschen
Tageblatt (vom 4. Jänner 1896) berichtete. Die mittel-
grosse Ausführung, die 1896 bei Cihlarz vorgefunden
wurde, ist nach ungefähr 23 Jahren wieder zum Vor-
schein gekommen und zwar in der Wawra’schen Ver-
steigerung vom April 1918. Die Darstellung umfasst vier
Figuren. Rechts ganz vorne sitzt vorgebeugt der Bauer,
besonders auffallend durch seine kühn vorspringende
Nase. Er führt eben den Löffel zum Mund, scheint aber
noch darauf hinzublasen. Als Kleidung ist ein Kittel aus
besonders dickem graulichem Stoff anzumerken. Hinter
dem Tisclj steht die Bäuerin mit dem Wickelkind in den
Armen, den Kopf ein wenig gegen die linke Schulter
geneigt. Das Kind guckt gerade gegen den Beschauer.
Links erhebt sich eben der Satyr vom Sitz, die Rechte
auf einen Stab stemmend und seine Linke den Händen
der Bäuerin nähernd. Hintergrund ziemlich dunkel. Nun
fand ich unlängst im Wiener Kunsthandel eine ganz
grosse Ausführung desselben Gegenstandes in derselben
Anordnung, eine breite Leinwand mit etwas mehr als
lebensgrossen Figuren. Der Stil dieses grossen Bildes
liess sich leichter beurteilen als jener der Skizze und
der mittelgrossen Ausführung, und ich kam durch meine
bestimmte Erinnerung an sicher benannte Werke von
Frans de Neve darauf, dass die grosse Ausführung
ein Werk dieses Künstlers ist. Sein bräunlicher Ton,
die etwas rauhe Technik und manche Sorglosigkeit in
der Formengebung kommen in dem grossen Bilde deut-
lichst zum Ausdruck, wogegen die geradewegs geist-
reiche Skizze in Hermannstadt bisher nicht auf unsern
De Neve bezogen werden konnte. Denn sonstige Farben-
entwürfe von ihm sind vorläufig nicht bekannt. Man
^ammtßF^ßifuiiß
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde,
Herausgeber: Norbert Ehrlich,
14. Jahrgang. Wien, 1. Dezember 1922. Nr. 19.
Sin .Trans de ffeve im ‘\Brudieniaf’sehen FTluseum zu
Tlermannstadf.
Von Dr. Theodor Frimmel, Wien.
In Siebenbürgen sind mancherlei Kunstschätze zu
finden, die bis auf die neueste Zeit nur selten von
Fremden beachtet werden. Vor Jahren konnte ich
z. B. in Hermannstadt einen reichlichen Fischzug an
Bilderentdeckungen machen. Denn dort waren unter
missverständlichen Benennungen große und kleine
seltene Meister im Bruckental’schen Museum versteckt,
unerkannt in der dazumal noch nicht kritisch geordneten
Bildermasse. Ein kleines Bildnis von Jan van Eyck, das
seither in Brügge und London ausgestellt war und
allgemein anerkannt wird, wurde von mir als ver-
dächtiger Dürer vorgefunden und nach genauer Prüfung
dem . berühmten Altniederländer zugeschrieben. Die
Bilder aus der Glanzzeit der holländischen Malerei des
17. Jahrhunderts boten Gelegenheit zu mehreren kunst-
geschichtlichen Funden. Ein Frans von Mieris sen. sei
als Beispiel angeführt, und aus der Gruppe der flan-
drischen Gesellschaftsmaler des 18. Jahrhunderts, deren
Studium bisher stark vernachlässigt ist, konnten wich-
tige Namen nachgewiesen werden. Mehrere dieser
Funde sind in meinen Kleinen Galeriestudien (Neue
Folge, Heft 1) abgebildet.
Die Bruckental’sche Galerie, die seither prächtig
geordnet und durch Prof. M. Csäki mustergiltig kata-
logisiert worden ist, fesselte mich aber nicht nur beim
ersten Fischzug, sondern blieb mir durch neuerliches
Studium auch bis heute in guter Erinnerung, so dass
ich, ohne die längliche Reise bis Hermannstadt zu
wiederholen, nachträglich noch einige Funde machen
konnte. So wurde während des Krieges ein G. Biliverti
dort festgestellt und für ein vorzügliches Charakterbild
der Name des Düsseldorfers J. Spielberg vorgeschlagen.
In den „Studien u. Skizzen zur Gemäldekunde“ ist
davon Rechenschaft gelegt worden. Heute komme ich
mit einem, wie ich meine, wohl begründeten Wahr-
scheinlichkeitsnachweis, daß Hermannstadt den besten
Frans de Neve besitzt, der bisher bekannt geworden
ist. Es handelt sich um die Farbenskizze mit der be-
liebten Darstellung des Kalt- und warm-bläsers, des
Satyrs in der Bauernfamilie, die als Nr. 537 in den
neuen Auflagen des Kataloges von Csäki verzeichnet
steht. Diese Skizze war bisher von Niemandem als
Werk des Frans de Neve erkannt worden, wie sehr
man sich auch über deren Herkunft aus dem Kreis
der Antwerpener Künstler um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts im klaren war. Jak. Jordaens, dann G. de
Herp wurden vermutungsweise als Urheber genannt.
1894 meinte ich, daß man sich mit dem Ausdruck
„treffliche Skizze von einem Flandrer aus der Spätzeit
des Rubens“ begnügen könne. (Kleine Galeriestudien,
Neue Folge, Lieferung I, S. 54). Dann lernte ich beim
Dresdener, später Wiener Händler Cihlarz sen. eine
mittelgroße Ausführung derselben Komposition kennen,
die mich stark an Guillian de Herp erinnerte, worüber
ich im Repertorium für Kunstwissenschaft (1896, S. 114)
in meiner Geschichte der Wiener Gemäldesammlungen
(Kapitel I, S. 59f) und im Siebenbürgisch-deutschen
Tageblatt (vom 4. Jänner 1896) berichtete. Die mittel-
grosse Ausführung, die 1896 bei Cihlarz vorgefunden
wurde, ist nach ungefähr 23 Jahren wieder zum Vor-
schein gekommen und zwar in der Wawra’schen Ver-
steigerung vom April 1918. Die Darstellung umfasst vier
Figuren. Rechts ganz vorne sitzt vorgebeugt der Bauer,
besonders auffallend durch seine kühn vorspringende
Nase. Er führt eben den Löffel zum Mund, scheint aber
noch darauf hinzublasen. Als Kleidung ist ein Kittel aus
besonders dickem graulichem Stoff anzumerken. Hinter
dem Tisclj steht die Bäuerin mit dem Wickelkind in den
Armen, den Kopf ein wenig gegen die linke Schulter
geneigt. Das Kind guckt gerade gegen den Beschauer.
Links erhebt sich eben der Satyr vom Sitz, die Rechte
auf einen Stab stemmend und seine Linke den Händen
der Bäuerin nähernd. Hintergrund ziemlich dunkel. Nun
fand ich unlängst im Wiener Kunsthandel eine ganz
grosse Ausführung desselben Gegenstandes in derselben
Anordnung, eine breite Leinwand mit etwas mehr als
lebensgrossen Figuren. Der Stil dieses grossen Bildes
liess sich leichter beurteilen als jener der Skizze und
der mittelgrossen Ausführung, und ich kam durch meine
bestimmte Erinnerung an sicher benannte Werke von
Frans de Neve darauf, dass die grosse Ausführung
ein Werk dieses Künstlers ist. Sein bräunlicher Ton,
die etwas rauhe Technik und manche Sorglosigkeit in
der Formengebung kommen in dem grossen Bilde deut-
lichst zum Ausdruck, wogegen die geradewegs geist-
reiche Skizze in Hermannstadt bisher nicht auf unsern
De Neve bezogen werden konnte. Denn sonstige Farben-
entwürfe von ihm sind vorläufig nicht bekannt. Man