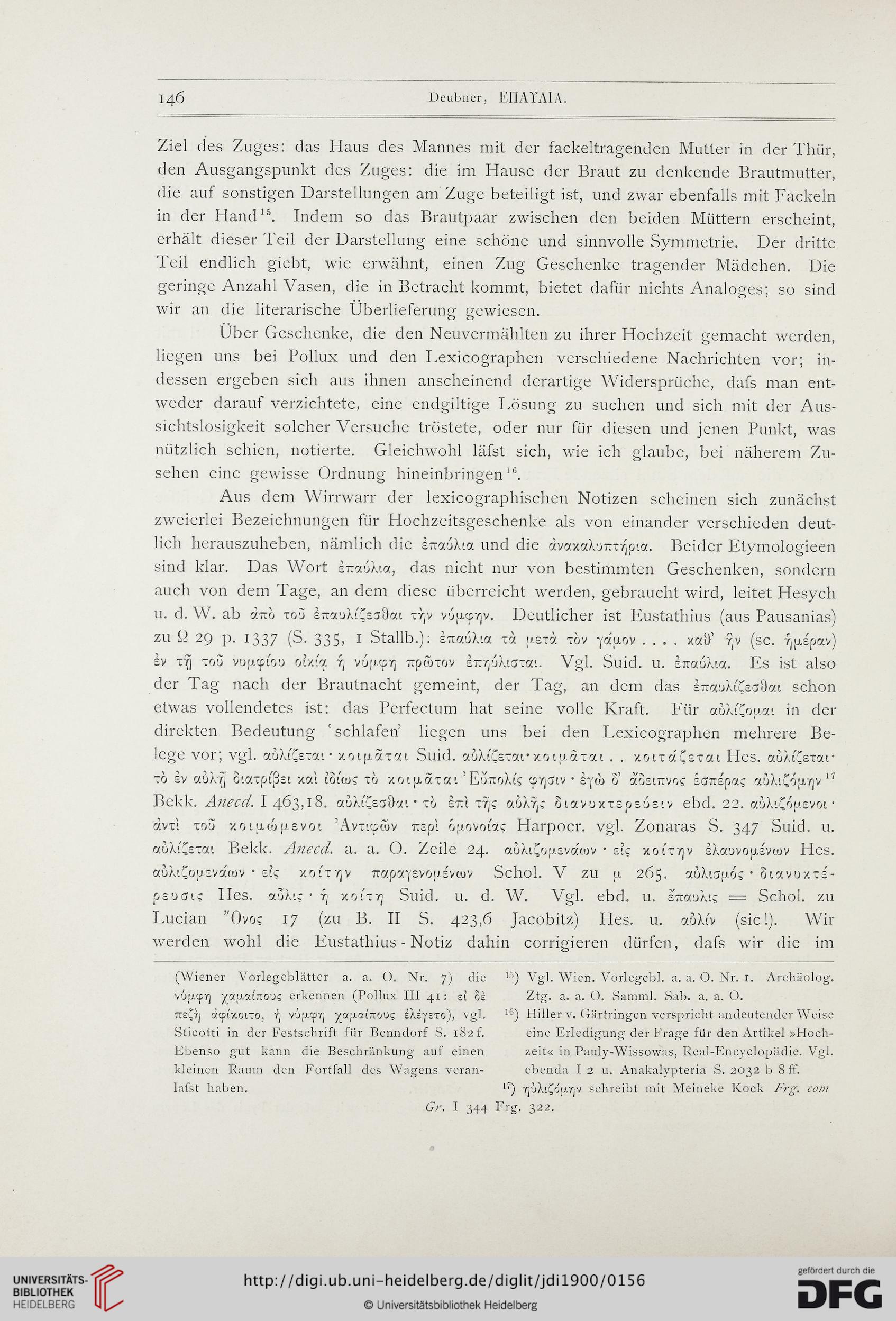146
Deubner, EUATAIA.
Ziel des Zuges: das Haus des Mannes mit der fackeltragenden Mutter in der Thür,
den Ausgangspunkt des Zuges: die im Hause der Braut zu denkende Brautmutter,
die auf sonstigen Darstellungen am Zuge beteiligt ist, und zwar ebenfalls mit Fackeln
in der Hand15. Indem so das Brautpaar zwischen den beiden Müttern erscheint,
erhält dieser Teil der Darstellung eine schöne und sinnvolle Symmetrie. Der dritte
Teil endlich giebt, wie erwähnt, einen Zug Geschenke tragender Mädchen. Die
geringe Anzahl Vasen, die in Betracht kommt, bietet dafür nichts Analoges; so sind
wir an die literarische Überlieferung gewiesen.
Über Geschenke, die den Neuvermählten zu ihrer Hochzeit gemacht werden,
liegen uns bei Pollux und den Lexicographen verschiedene Nachrichten vor; in-
dessen ergeben sich aus ihnen anscheinend derartige Widersprüche, dafs man ent-
weder darauf verzichtete, eine endgiltige Lösung zu suchen und sich mit der Aus-
sichtslosigkeit solcher Versuche tröstete, oder nur für diesen und jenen Punkt, was
nützlich schien, notierte. Gleichwohl läfst sich, wie ich glaube, bei näherem Zu-
sehen eine gewisse Ordnung hineinbringen16.
Aus dem Wirrwarr der lexicographischen Notizen scheinen sich zunächst
zweierlei Bezeichnungen für Flochzeitsgeschenke als von einander verschieden deut-
lich herauszuheben, nämlich die EirauXta und die avaxaXutTX7jpic«. Beider Etymologieen
sind klar. Das Wort smxuXia, das nicht nur von bestimmten Geschenken, sondern
auch von dem Tage, an dem diese überreicht werden, gebraucht wird, leitet Hesych
u. d. W. ab dirö xou s-caAtCesDat xy]v vuycpvp. Deutlicher ist Eustathius (aus Pausanias)
zu Q 29 p. 1337 (S. 335; 1 Stallb.): EtrauXtoc xd [j.exd xov '{d
uov
xaö-’
‘/jV (SC. Tjjxspav
ev x'(j xou vuucpiou otxta 4 vuycpyj rtpöjxov sirrjuXtaxat. Vgl. Suid. u. STrauXta. Es ist also
der Tag nach der Brautnacht gemeint, der Tag, an dem das snauXtCsaöai schon
etwas vollendetes ist: das Perfectum hat seine volle Kraft. Für «uXLopcu in der
direkten Bedeutung 'schlafen’ liegen uns bei den Lexicographen mehrere Be-
lege vor; vgl. auXt'Csxai• xotfxaxat Suid. auXiCexarxotfi.axai . . xotxa£sx«t Hes. auXtCstar
xö sv czuX-fi (kaxpißst xal ioiuK xo xotp-axat ’EuitoXtk cpvjatv • £'(<b 0 aosurvos lairlpa? aoXiCop-Tjv 17
Bekk. Anecd. I 463,18. auXt£sa&cu • xo erd xrtq auXry Stavuxxspsusiv ebd. 22. auXiCop-svoi ■
dtvxt xou xotyatp-Evoi ’Avxicpaiv TTEpl opovotac Harpocr. vgl. Zonaras S. 347 Suid. u.
«uXi'Cexat Bekk. Anecd. a. a. O. Zeile 24. ctöXtCopsvatov • et? xotxvjv sXauvopivtov Hes.
auXiCoaEvdojv • Et? xoixvjv 7rapaY£Vop.£v«>v Schob V zu p. 265. auXtap.07 • Stavuxxs-
psuat? Hes. auXt? • 4 xoixrj Suid. u. d. W. Vgl. ebd. u. eixauXi? = Schob zu
Lucian vOvo? 17 (zu B. II S. 423,6 Jacobitz) Hes. u. auXtv (sic!). Wir
werden wohl die Eustathius - Notiz dahin corrigieren dürfen, dafs wir die im
(Wiener Vorlegeblätter a. a. O. Nr. 7) die
v6p/fr) ya\>.auiou? erkennen (Pollux III 41: ei 5e
7is£t] acpt'xoiTÖ, f] vufxcpy] ^apanrous iXiyexo), vgl.
Sticotti in der Festschrift für Benndorf S. 182b
Ebenso gut kann die Beschränkung auf einen
kleinen Raum den Fortfall des Wagens veran-
lafst haben.
Gr. I 344
15) Vgl. Wien. Vorlegebl. a. a. O. Nr. 1. Archäolog.
Ztg. a. a. O. Samml. Sab. a. a. O.
16) Hiller v. Gärtringen verspricht andeutender Weise
eine Erledigung der Frage für den Artikel »Hoch-
zeit« in Pauly-Wissowas, Real-Encyclopädie. Vgl.
ebenda I 2 u. Anakalypteria S. 2032 b 8 ff.
17) TjuXiCopry schreibt mit Meineke Kock Frg. com
Frg. 322.
Deubner, EUATAIA.
Ziel des Zuges: das Haus des Mannes mit der fackeltragenden Mutter in der Thür,
den Ausgangspunkt des Zuges: die im Hause der Braut zu denkende Brautmutter,
die auf sonstigen Darstellungen am Zuge beteiligt ist, und zwar ebenfalls mit Fackeln
in der Hand15. Indem so das Brautpaar zwischen den beiden Müttern erscheint,
erhält dieser Teil der Darstellung eine schöne und sinnvolle Symmetrie. Der dritte
Teil endlich giebt, wie erwähnt, einen Zug Geschenke tragender Mädchen. Die
geringe Anzahl Vasen, die in Betracht kommt, bietet dafür nichts Analoges; so sind
wir an die literarische Überlieferung gewiesen.
Über Geschenke, die den Neuvermählten zu ihrer Hochzeit gemacht werden,
liegen uns bei Pollux und den Lexicographen verschiedene Nachrichten vor; in-
dessen ergeben sich aus ihnen anscheinend derartige Widersprüche, dafs man ent-
weder darauf verzichtete, eine endgiltige Lösung zu suchen und sich mit der Aus-
sichtslosigkeit solcher Versuche tröstete, oder nur für diesen und jenen Punkt, was
nützlich schien, notierte. Gleichwohl läfst sich, wie ich glaube, bei näherem Zu-
sehen eine gewisse Ordnung hineinbringen16.
Aus dem Wirrwarr der lexicographischen Notizen scheinen sich zunächst
zweierlei Bezeichnungen für Flochzeitsgeschenke als von einander verschieden deut-
lich herauszuheben, nämlich die EirauXta und die avaxaXutTX7jpic«. Beider Etymologieen
sind klar. Das Wort smxuXia, das nicht nur von bestimmten Geschenken, sondern
auch von dem Tage, an dem diese überreicht werden, gebraucht wird, leitet Hesych
u. d. W. ab dirö xou s-caAtCesDat xy]v vuycpvp. Deutlicher ist Eustathius (aus Pausanias)
zu Q 29 p. 1337 (S. 335; 1 Stallb.): EtrauXtoc xd [j.exd xov '{d
uov
xaö-’
‘/jV (SC. Tjjxspav
ev x'(j xou vuucpiou otxta 4 vuycpyj rtpöjxov sirrjuXtaxat. Vgl. Suid. u. STrauXta. Es ist also
der Tag nach der Brautnacht gemeint, der Tag, an dem das snauXtCsaöai schon
etwas vollendetes ist: das Perfectum hat seine volle Kraft. Für «uXLopcu in der
direkten Bedeutung 'schlafen’ liegen uns bei den Lexicographen mehrere Be-
lege vor; vgl. auXt'Csxai• xotfxaxat Suid. auXiCexarxotfi.axai . . xotxa£sx«t Hes. auXtCstar
xö sv czuX-fi (kaxpißst xal ioiuK xo xotp-axat ’EuitoXtk cpvjatv • £'(<b 0 aosurvos lairlpa? aoXiCop-Tjv 17
Bekk. Anecd. I 463,18. auXt£sa&cu • xo erd xrtq auXry Stavuxxspsusiv ebd. 22. auXiCop-svoi ■
dtvxt xou xotyatp-Evoi ’Avxicpaiv TTEpl opovotac Harpocr. vgl. Zonaras S. 347 Suid. u.
«uXi'Cexat Bekk. Anecd. a. a. O. Zeile 24. ctöXtCopsvatov • et? xotxvjv sXauvopivtov Hes.
auXiCoaEvdojv • Et? xoixvjv 7rapaY£Vop.£v«>v Schob V zu p. 265. auXtap.07 • Stavuxxs-
psuat? Hes. auXt? • 4 xoixrj Suid. u. d. W. Vgl. ebd. u. eixauXi? = Schob zu
Lucian vOvo? 17 (zu B. II S. 423,6 Jacobitz) Hes. u. auXtv (sic!). Wir
werden wohl die Eustathius - Notiz dahin corrigieren dürfen, dafs wir die im
(Wiener Vorlegeblätter a. a. O. Nr. 7) die
v6p/fr) ya\>.auiou? erkennen (Pollux III 41: ei 5e
7is£t] acpt'xoiTÖ, f] vufxcpy] ^apanrous iXiyexo), vgl.
Sticotti in der Festschrift für Benndorf S. 182b
Ebenso gut kann die Beschränkung auf einen
kleinen Raum den Fortfall des Wagens veran-
lafst haben.
Gr. I 344
15) Vgl. Wien. Vorlegebl. a. a. O. Nr. 1. Archäolog.
Ztg. a. a. O. Samml. Sab. a. a. O.
16) Hiller v. Gärtringen verspricht andeutender Weise
eine Erledigung der Frage für den Artikel »Hoch-
zeit« in Pauly-Wissowas, Real-Encyclopädie. Vgl.
ebenda I 2 u. Anakalypteria S. 2032 b 8 ff.
17) TjuXiCopry schreibt mit Meineke Kock Frg. com
Frg. 322.