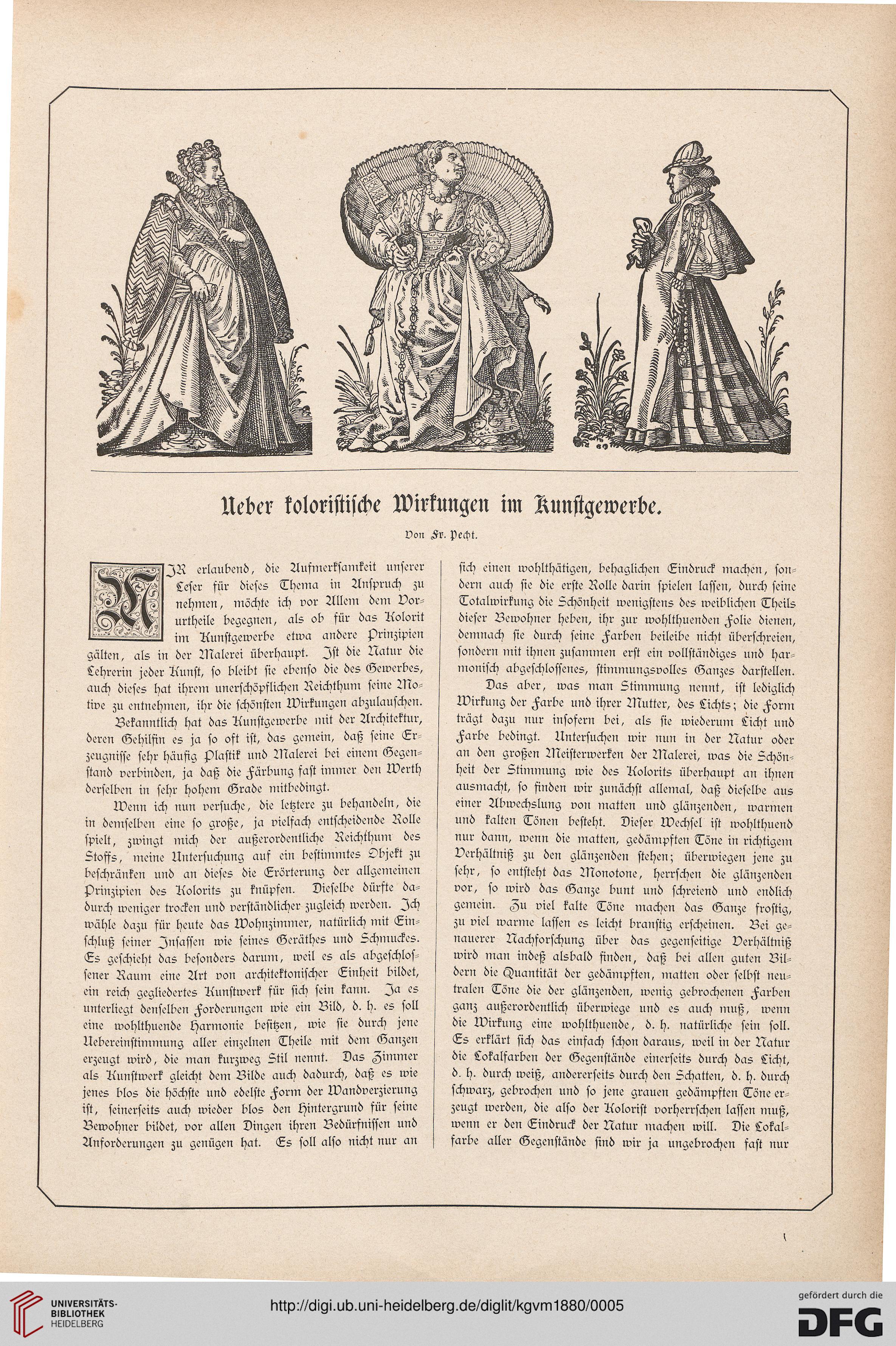Heber koloristische Wirkungen im Lnnstgewerbc.
Don
erlaubend, die Aufmerksanrkeit unserer
Leser für dieses Thema in Anspruch zu
nehmen, möchte ich vor Allem dein Bor-
urtheile begegnen, als ob für das Kolorit
im Kunstgewerbe etwa andere Prinzipien
gälten, als in der Malerei überhaupt. öie Natur die
Lehrerin jeder Kunst, so bleibt sie ebenso die des Gewerbes,
auch dieses hat ihrem unerschöpflichen Reichthum seine Mo-
tive zu entnehmen, ihr die schönsten Wirkungen abzulauschen.
Bekanntlich hat das Kunstgewerbe mit der Architektur,
deren Gehilfin es ja so oft ist, das gemein, daß feine Er
Zeugnisse sehr häufig Elastik und Malerei bei einem Gegen-
stand verbinden, ja daß die Färbung fast immer den Werth
derselben in sehr hohem Grade mitbedingt.
Wenn ich nun versuche, die letztere zu behandeln, die
in demselben eine so große, ja vielfach entscheidende Rolle
spielt, zwingt mich der außerordentliche Reichkhum des
Stoffs, meine Untersuchung auf ein bestimmtes Objekt zu
beschränken und an dieses die Erörterung der allgemeinen
Prinzipien des Kolorits zu knüpfen. Dieselbe dürfte da-
durch weniger trocken und verständlicher zugleich werden. Ich
wähle dazu für heute das Wohnzimmer, natürlich mit Ein-
schluß seiner Insassen wie seines Geräthes und Schmuckes.
Es geschieht das besonders darum, weil es als abgeschlos-
sener Rauin eine Art von architektonischer Einheit bildet,
ein reich gegliedertes Kunstwerk für sich sein kann. Ja es
unterliegt denselben Forderungen ivie ein Bild, d. h. es soll
eine wohlthuende charmonie besitzen, wie sie durch jene
Uebereinstimmung aller einzelnen Theile mit dem Ganzen
erzeugt wird, die man kurzweg Stil nennt. Das Zimmer
als Kunstwerk gleicht dem Bilde auch dadurch, daß es wie
jenes blos die höchste und edelste Form der Wandverzierung
ist, seinerseits auch wieder blos den Hintergrund für seine
Bewohner bildet, vor allen Dingen ihren Bedürfnissen und
Anforderungen zu genügen hat. Es soll also nicht nur an
Fr. pecht.
sich einen wohlthätigen, behaglichen Eindruck machen, son-
dern auch sie die erste Rolle darin spielen lassen, durch seine
Totalwirkung die Schönheit wenigstens des weiblichen Theils
dieser Bewohner heben, ihr zur wohlthuenden Folie dienen,
demnach sie durch seine Farben beileibe nicht überschreien,
sondern mit ihnen zusammen erst ein vollständiges und har-
monisch abgeschlossenes, stimmungsvolles Ganzes darstellen.
Das aber, was man Stimmung nennt, ist lediglich
Wirkung der Farbe und ihrer Mutter, des Lichts; die Form
trägt dazu nur insofern bei, als sie wiederum Licht und
Farbe bedingt. Untersuchen wir nun in der Natur oder
an den großen Meisterwerken der Malerei, was die Schön-
heit der Stimmung wie des Kolorits überhaupt an ihnen
ausmacht, so finden wir zunächst allemal, daß dieselbe aus
einer Abwechslung von matten und glänzenden, warmen
und kalten Tönen besteht. Dieser Wechsel ist wohlthuend
nur dann, wenn die matten, gedämpften Töne in richtigem
Berhältniß zu den glänzenden stehen; überwiegen jene zu
sehr, so entsteht das Monotone, herrschen die glänzenden
vor, so wird das Ganze bunt und schreiend und endlich
gemein. Zu viel kalte Töne machen das Ganze frostig,
zu viel warnie lassen es leicht branstig erscheinen. Bei ge-
nauerer Nachforschung über das gegenseitige Berhältniß
wird man indeß alsbald finden, daß bei allen guten Bil-
dern die Quantität der gedämpften, matten oder selbst neu-
tralen Töne die der glänzenden, wenig gebrochenen Farben
ganz außerordentlich überwiege und es auch muß, wenn
die Wirkung eine wohlthuende, d. h. natürliche sein soll.
Es erklärt sich das einfach schon daraus, weil in der Natur
die Lokalfarben der Gegenstände einerseits durch das Licht,
d. h. durch weiß, andererseits durch den Schatten, d. h. durch
schwarz, gebrochen und so jene grauen gedämpften Töne er-
zeugt werden, die also der Kolorist vorherrschen lassen muß,
wenn er den Eindruck der Natur machen will. Die Lokal-
farbe aller Gegenstände sind wir ja ungebrochen fast nur
t