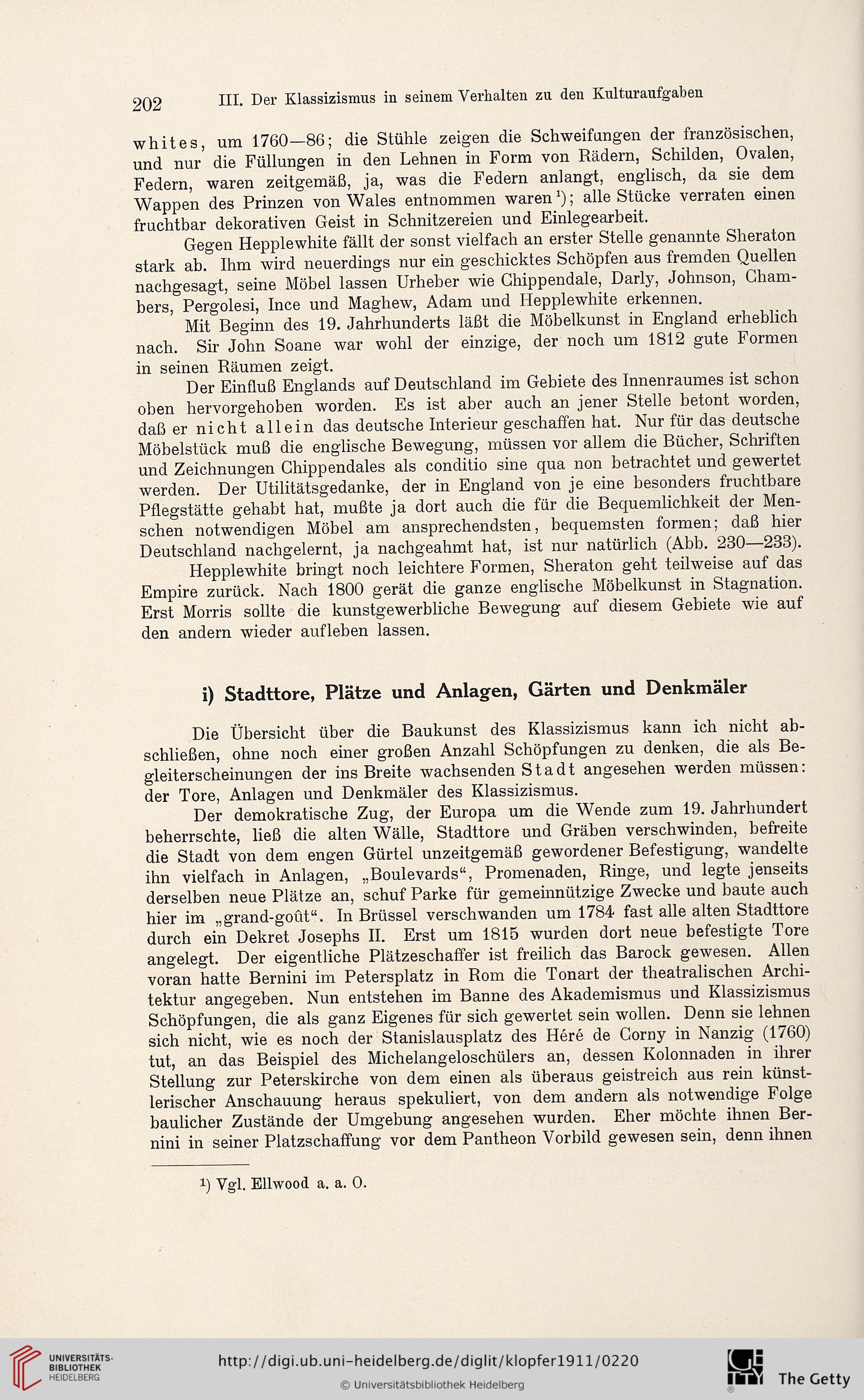202 III. Der Klassizismus in seinem Verhalten zu den Kulturaufgaben
whites, um 1760—86; die Stühle zeigen die Schweifungen der französischen,
und nur die Füllungen in den Lehnen in Form von Rädern, Schilden, Ovalen,
Federn, waren zeitgemäß, ja, was die Federn anlangt, englisch, da sie dem
Wappen des Prinzen von Wales entnommen waren 1); alle Stücke verraten einen
fruchtbar dekorativen Geist in Schnitzereien und Einlegearbeit.
Gegen Hepplewhite fällt der sonst vielfach an erster Stelle genannte Sheraton
stark ab. Ihm wird neuerdings nur ein geschicktes Schöpfen aus fremden Ouellen
nachgesagt, seine Möbel lassen Urheber wie Chippendale, Darly, Johnson, Gham-
bers, Pergolesi, Ince und Maghew, Adam und Hepplewhite erkennen.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts läßt die Möbelkunst in England erheblich
nach. Sir John Soane war wohl der einzige, der noch um 1812 gute Formen
in seinen Räumen zeigt.
Der Einfluß Englands auf Deutschland im Gebiete des Innenraumes ist schon
oben hervorgehoben worden. Es ist aber auch an jener Stelle betont worden,
daß er nicht allein das deutsche Interieur geschasfen hat. Nur für das deutsche
Möbelstück muß die englische Bewegung, müssen vor allem die Bücher, Schriften
und Zeichnungen Chippendales als conditio sine qua non betrachtet und gewertet
werden. Der Utilitätsgedanke, der in England von je eine besonders fruchtbare
Pflegstätte gehabt hat, mußte ja dort auch die für die Bequemlichkeit der Men-
schen notwendigen Möbel am ansprechendsten, bequemsten formen; daß hier
Deutschland nachgelernt, ja nachgeahmt hat, ist nur natürlich (Abb. 230—233).
Hepplewhite bringt noch leichtere Formen, Sheraton geht teilweise auf das
Empire zurück. Nach 1800 gerät die ganze englische Möbelkunst in Stagnation.
Erst Morris sollte die kunstgewerbliche Bewegung auf diesem Gebiete wie auf
den andern wieder aufleben lassen.
i) Stadttore, Plätze und Anlagen, Gärten und Denkmäler
Die Übersicht über die Baukunst des Klassizismus kann ich nicht ab-
schließen, ohne noch einer großen Anzahl Schöpfungen zu denken, die als Be-
gleiterscheinungen der ins Breite wachsenden S t a d t angesehen werden rnüssen:
der Tore, Anlagen und Denkmäler des Klassizismus.
Der demokratische Zug, der Europa um die Wende zum 19. Jahrhundert
beherrschte, ließ die alten Wälle, Stadttore und Gräben verschwinden, befreite
die Stadt von dem engen Gürtel unzeitgemäß gewordener Befestigung, wandelte
ihn vielfach in Anlagen, „Boulevards“, Promenaden, Ringe, und legte jenseits
derselben neue Plätze an, schuf Parke für gemeinnützige Zwecke und baute auch
hier im „grand-goüt“. In Brüssel verschwanden um 1784 fast alle alten Stadttore
durch ein Dekret Josephs II. Erst um 1815 wurden dort neue befestigte Tore
angelegt. Der eigentliche Plätzeschaffer ist freilich das Barock gewesen. Allen
voran hatte Bernini im Petersplatz in Rom die Tonart der theatralischen Archi-
tektur angegeben. Nun entstehen im Banne des Akademismus und Klassizismus
Schöpfungen, die als ganz Eigenes für sich gewertet sein wollen. Denn sie lehnen
sich nicht, wie es noch der Stanislausplatz des Here de Corny in Nanzig (1760)
tut, an das Beispiel des Michelangeloschülers an, dessen Kolonnaden in ihrer
Stellung zur Peterskirche von dem einen als überaus geistreich aus rein künst-
lerischer Anschauung heraus spekuliert, von dem andern als notwendige Folge
baulicher Zustände der Umgebung angesehen wurden. Eher möchte ihnen Ber-
nini in seiner Platzschaffung vor dem Pantheon Vorbild gewesen sein, denn ihnen
!) Vgl. Ellwood a. a. 0.
whites, um 1760—86; die Stühle zeigen die Schweifungen der französischen,
und nur die Füllungen in den Lehnen in Form von Rädern, Schilden, Ovalen,
Federn, waren zeitgemäß, ja, was die Federn anlangt, englisch, da sie dem
Wappen des Prinzen von Wales entnommen waren 1); alle Stücke verraten einen
fruchtbar dekorativen Geist in Schnitzereien und Einlegearbeit.
Gegen Hepplewhite fällt der sonst vielfach an erster Stelle genannte Sheraton
stark ab. Ihm wird neuerdings nur ein geschicktes Schöpfen aus fremden Ouellen
nachgesagt, seine Möbel lassen Urheber wie Chippendale, Darly, Johnson, Gham-
bers, Pergolesi, Ince und Maghew, Adam und Hepplewhite erkennen.
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts läßt die Möbelkunst in England erheblich
nach. Sir John Soane war wohl der einzige, der noch um 1812 gute Formen
in seinen Räumen zeigt.
Der Einfluß Englands auf Deutschland im Gebiete des Innenraumes ist schon
oben hervorgehoben worden. Es ist aber auch an jener Stelle betont worden,
daß er nicht allein das deutsche Interieur geschasfen hat. Nur für das deutsche
Möbelstück muß die englische Bewegung, müssen vor allem die Bücher, Schriften
und Zeichnungen Chippendales als conditio sine qua non betrachtet und gewertet
werden. Der Utilitätsgedanke, der in England von je eine besonders fruchtbare
Pflegstätte gehabt hat, mußte ja dort auch die für die Bequemlichkeit der Men-
schen notwendigen Möbel am ansprechendsten, bequemsten formen; daß hier
Deutschland nachgelernt, ja nachgeahmt hat, ist nur natürlich (Abb. 230—233).
Hepplewhite bringt noch leichtere Formen, Sheraton geht teilweise auf das
Empire zurück. Nach 1800 gerät die ganze englische Möbelkunst in Stagnation.
Erst Morris sollte die kunstgewerbliche Bewegung auf diesem Gebiete wie auf
den andern wieder aufleben lassen.
i) Stadttore, Plätze und Anlagen, Gärten und Denkmäler
Die Übersicht über die Baukunst des Klassizismus kann ich nicht ab-
schließen, ohne noch einer großen Anzahl Schöpfungen zu denken, die als Be-
gleiterscheinungen der ins Breite wachsenden S t a d t angesehen werden rnüssen:
der Tore, Anlagen und Denkmäler des Klassizismus.
Der demokratische Zug, der Europa um die Wende zum 19. Jahrhundert
beherrschte, ließ die alten Wälle, Stadttore und Gräben verschwinden, befreite
die Stadt von dem engen Gürtel unzeitgemäß gewordener Befestigung, wandelte
ihn vielfach in Anlagen, „Boulevards“, Promenaden, Ringe, und legte jenseits
derselben neue Plätze an, schuf Parke für gemeinnützige Zwecke und baute auch
hier im „grand-goüt“. In Brüssel verschwanden um 1784 fast alle alten Stadttore
durch ein Dekret Josephs II. Erst um 1815 wurden dort neue befestigte Tore
angelegt. Der eigentliche Plätzeschaffer ist freilich das Barock gewesen. Allen
voran hatte Bernini im Petersplatz in Rom die Tonart der theatralischen Archi-
tektur angegeben. Nun entstehen im Banne des Akademismus und Klassizismus
Schöpfungen, die als ganz Eigenes für sich gewertet sein wollen. Denn sie lehnen
sich nicht, wie es noch der Stanislausplatz des Here de Corny in Nanzig (1760)
tut, an das Beispiel des Michelangeloschülers an, dessen Kolonnaden in ihrer
Stellung zur Peterskirche von dem einen als überaus geistreich aus rein künst-
lerischer Anschauung heraus spekuliert, von dem andern als notwendige Folge
baulicher Zustände der Umgebung angesehen wurden. Eher möchte ihnen Ber-
nini in seiner Platzschaffung vor dem Pantheon Vorbild gewesen sein, denn ihnen
!) Vgl. Ellwood a. a. 0.