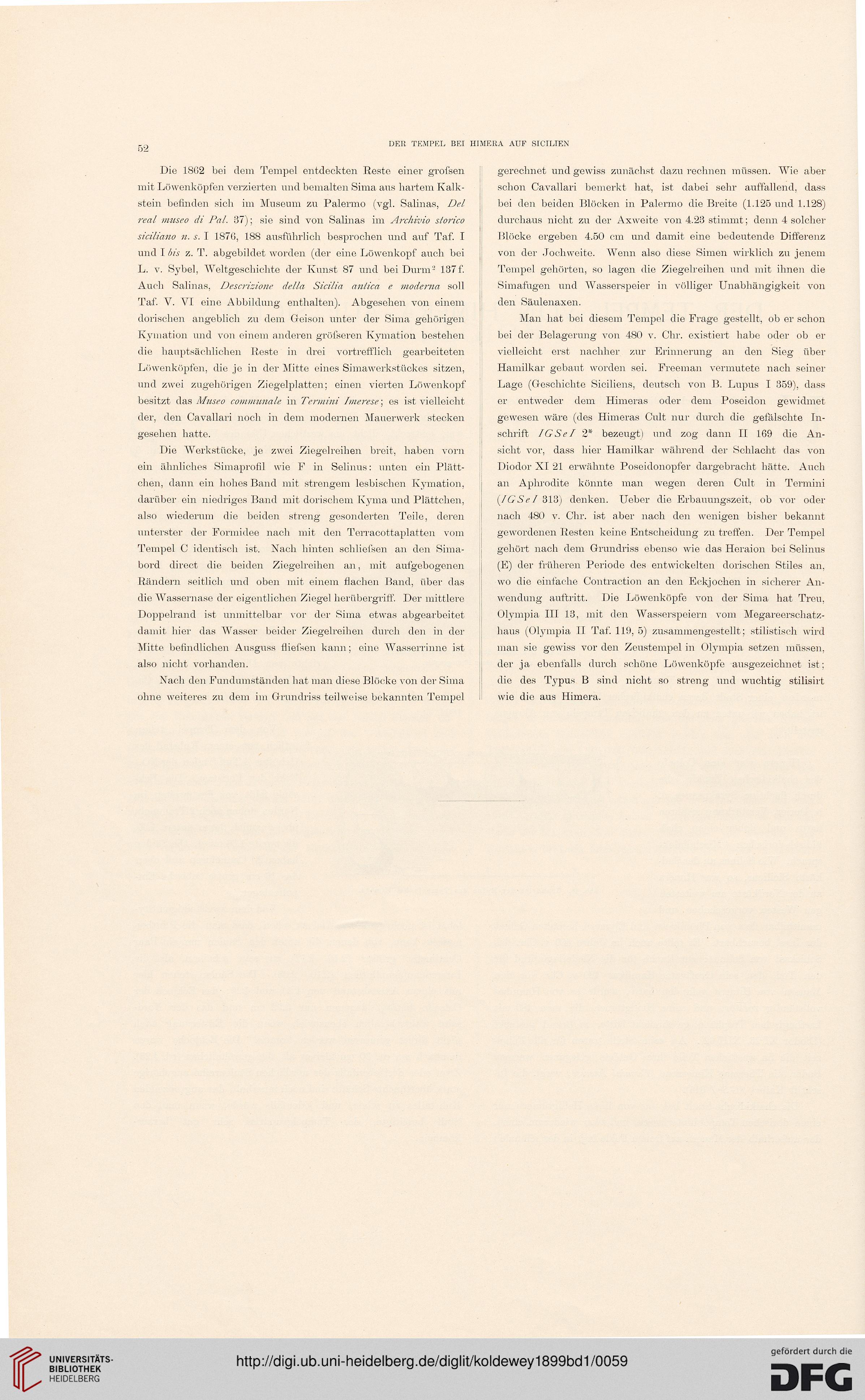52
DER TEMPEL BET HIMEKA AUF SICILTEN
Die 18G2 bei dem Tempel entdeckten Reste einer grof'sen
mit Löwenköpfen verzierten und bemalten Sima aus hartem Kalk-
stein befinden sich im Museum zu Palermo (vgl. Salinas, Del
real museo di Pal. 37); sie sind von Salinas im Archivio storico
siciliano n. s. I 187G, 188 ausführlich besprochen und auf Taf. I
und I bis z. T. abgebildet worden (der eine Löwenkopf auch bei
L. v. Sybel, Weltgeschichte der Kunst 87 und bei Durm- 137f.
Auch Salinas, Descrizione de IIa Sicilia anlica e modema soll
Taf. V. VI eine Abbildung enthalten). Abgesehen von einem
dorischen angeblich zu dem Geison unter der Sima gehörigen
Kymation und von einem anderen grösseren Kymation bestehen
die hauptsächlichen Reste in drei vortrefflich gearbeiteten
Löwenköpfen, die je in der Mitte eines Simawerkstückes sitzen,
und zwei zugehörigen Ziegelplatten; einen vierten Löwenkopf
besitzt das Mttseo communale in Termini Imerese; es ist vielleicht
der, den Cavallari noch in dem modernen Mauerwerk stecken
gesehen hatte.
Die Werkstücke, je zwei Ziegelreihen breit, haben vorn
ein ähnliches Simaprofil wie F in Selinus: unten ein Plätt-
chen, dann ein hohes Band mit strengem lesbischen Kymation,
darüber ein niedriges Band mit dorischem Kyma und Plättchen,
also wiederum die beiden streng gesonderten Teile, deren
unterster der Formidee nach mit den Terracottaplatton vom
Tempel C identisch ist. Nach hinten schliefsen an den Sima-
bord direct die beiden Ziegelreihen an, mit aufgebogenen
Rändern seitlich und oben mit einem flachen Band, über das
die Wassernase der eigentlichen Ziegel herübergriff. Der mittlere
Doppelrand ist unmittelbar vor der Sima etwas abgearbeitet
damit hier das Wasser beider Ziegelreihen durch den in der
Mitte befindlichen Ausguss fliefsen kann; eine Wasserrinne ist
also nicht vorhanden.
Nach den Fundumständen hat man diese Blöcke von der Sima
ohne weiteres zu dem im Grundriss teilweise bekannten Tempel
gerechnet und gewiss zunächst dazu rechnen müssen. Wie aber
schon Cavallari bemerkt hat, ist dabei sehr auffallend, dass
bei den beiden Blöcken in Palermo die Breite (1.125 und 1.128)
durchaus nicht zu der Axweite von 4.23 stimmt; denn 4 solcher
Blöcke ergeben 4.50 cm und damit eine bedeutende Differenz
von der Jochweite. Wenn also diese Simen wirklich zu jenem
Tempel gehörten, so lagen die Ziegelreihen und mit ihnen die
Simafugen und Wasserspeier in völliger Unabhängigkeit von
den Säulenaxen.
Man hat bei diesem Tempel die Frage gestellt, ob er schon
bei der Belagerung von 480 v. Chr. existiert habe oder ob er
vielleicht erst nachher zur Erinnerung an den Sieg über
Hamilkar gebaut worden sei. Freeman vermutete nach seiner
Lage (Geschichte Siciliens, deutsch von B. Lupus I 359), dass
er entweder dem Himeras oder dem Poseidon gewidmet
gewesen wäre (des Himeras Cult nur durch die gefälschte In-
schrift IGSef 2* bezeugt) und zog dann II 169 die An-
sicht vor, dass hier Hamilkar während der Schlacht das von
Diodor XI 21 erwähnte Poseidonopfer dargebracht hätte. Auch
an Aphrodite könnte man wegen deren Cult in Termini
[IGSel 313) denken. Ueber die Erbauungszeit, ob vor oder
nach 480 v. Chr. ist aber nach den wenigen bisher bekannt
gewordenen Resten keine Entscheidung zu treffen. Der Tempel
gehört nach dem Grundriss ebenso wie das Heraion bei Selinus
(E) der früheren Periode des entwickelten dorischen Stiles an,
wo die einfache Contraction an den Eckjochen in sicherer An-
wendung auftritt. Die Löwenköpfe von der Sima hat Treu,
Olympia III 13, mit den Wasserspeiern vom Megareerschatz-
haus (Olympia II Taf. 119, 5) zusammengestellt; stilistisch wird
man sie gewiss vor den Zeustempel in Olympia setzen müssen,
der ja ebenfalls durch schöne Löwenköpf'e ausgezeichnet ist:
die des Typus B sind nicht so streng und wuchtig stilisirt
wie die aus Himera.
DER TEMPEL BET HIMEKA AUF SICILTEN
Die 18G2 bei dem Tempel entdeckten Reste einer grof'sen
mit Löwenköpfen verzierten und bemalten Sima aus hartem Kalk-
stein befinden sich im Museum zu Palermo (vgl. Salinas, Del
real museo di Pal. 37); sie sind von Salinas im Archivio storico
siciliano n. s. I 187G, 188 ausführlich besprochen und auf Taf. I
und I bis z. T. abgebildet worden (der eine Löwenkopf auch bei
L. v. Sybel, Weltgeschichte der Kunst 87 und bei Durm- 137f.
Auch Salinas, Descrizione de IIa Sicilia anlica e modema soll
Taf. V. VI eine Abbildung enthalten). Abgesehen von einem
dorischen angeblich zu dem Geison unter der Sima gehörigen
Kymation und von einem anderen grösseren Kymation bestehen
die hauptsächlichen Reste in drei vortrefflich gearbeiteten
Löwenköpfen, die je in der Mitte eines Simawerkstückes sitzen,
und zwei zugehörigen Ziegelplatten; einen vierten Löwenkopf
besitzt das Mttseo communale in Termini Imerese; es ist vielleicht
der, den Cavallari noch in dem modernen Mauerwerk stecken
gesehen hatte.
Die Werkstücke, je zwei Ziegelreihen breit, haben vorn
ein ähnliches Simaprofil wie F in Selinus: unten ein Plätt-
chen, dann ein hohes Band mit strengem lesbischen Kymation,
darüber ein niedriges Band mit dorischem Kyma und Plättchen,
also wiederum die beiden streng gesonderten Teile, deren
unterster der Formidee nach mit den Terracottaplatton vom
Tempel C identisch ist. Nach hinten schliefsen an den Sima-
bord direct die beiden Ziegelreihen an, mit aufgebogenen
Rändern seitlich und oben mit einem flachen Band, über das
die Wassernase der eigentlichen Ziegel herübergriff. Der mittlere
Doppelrand ist unmittelbar vor der Sima etwas abgearbeitet
damit hier das Wasser beider Ziegelreihen durch den in der
Mitte befindlichen Ausguss fliefsen kann; eine Wasserrinne ist
also nicht vorhanden.
Nach den Fundumständen hat man diese Blöcke von der Sima
ohne weiteres zu dem im Grundriss teilweise bekannten Tempel
gerechnet und gewiss zunächst dazu rechnen müssen. Wie aber
schon Cavallari bemerkt hat, ist dabei sehr auffallend, dass
bei den beiden Blöcken in Palermo die Breite (1.125 und 1.128)
durchaus nicht zu der Axweite von 4.23 stimmt; denn 4 solcher
Blöcke ergeben 4.50 cm und damit eine bedeutende Differenz
von der Jochweite. Wenn also diese Simen wirklich zu jenem
Tempel gehörten, so lagen die Ziegelreihen und mit ihnen die
Simafugen und Wasserspeier in völliger Unabhängigkeit von
den Säulenaxen.
Man hat bei diesem Tempel die Frage gestellt, ob er schon
bei der Belagerung von 480 v. Chr. existiert habe oder ob er
vielleicht erst nachher zur Erinnerung an den Sieg über
Hamilkar gebaut worden sei. Freeman vermutete nach seiner
Lage (Geschichte Siciliens, deutsch von B. Lupus I 359), dass
er entweder dem Himeras oder dem Poseidon gewidmet
gewesen wäre (des Himeras Cult nur durch die gefälschte In-
schrift IGSef 2* bezeugt) und zog dann II 169 die An-
sicht vor, dass hier Hamilkar während der Schlacht das von
Diodor XI 21 erwähnte Poseidonopfer dargebracht hätte. Auch
an Aphrodite könnte man wegen deren Cult in Termini
[IGSel 313) denken. Ueber die Erbauungszeit, ob vor oder
nach 480 v. Chr. ist aber nach den wenigen bisher bekannt
gewordenen Resten keine Entscheidung zu treffen. Der Tempel
gehört nach dem Grundriss ebenso wie das Heraion bei Selinus
(E) der früheren Periode des entwickelten dorischen Stiles an,
wo die einfache Contraction an den Eckjochen in sicherer An-
wendung auftritt. Die Löwenköpfe von der Sima hat Treu,
Olympia III 13, mit den Wasserspeiern vom Megareerschatz-
haus (Olympia II Taf. 119, 5) zusammengestellt; stilistisch wird
man sie gewiss vor den Zeustempel in Olympia setzen müssen,
der ja ebenfalls durch schöne Löwenköpf'e ausgezeichnet ist:
die des Typus B sind nicht so streng und wuchtig stilisirt
wie die aus Himera.