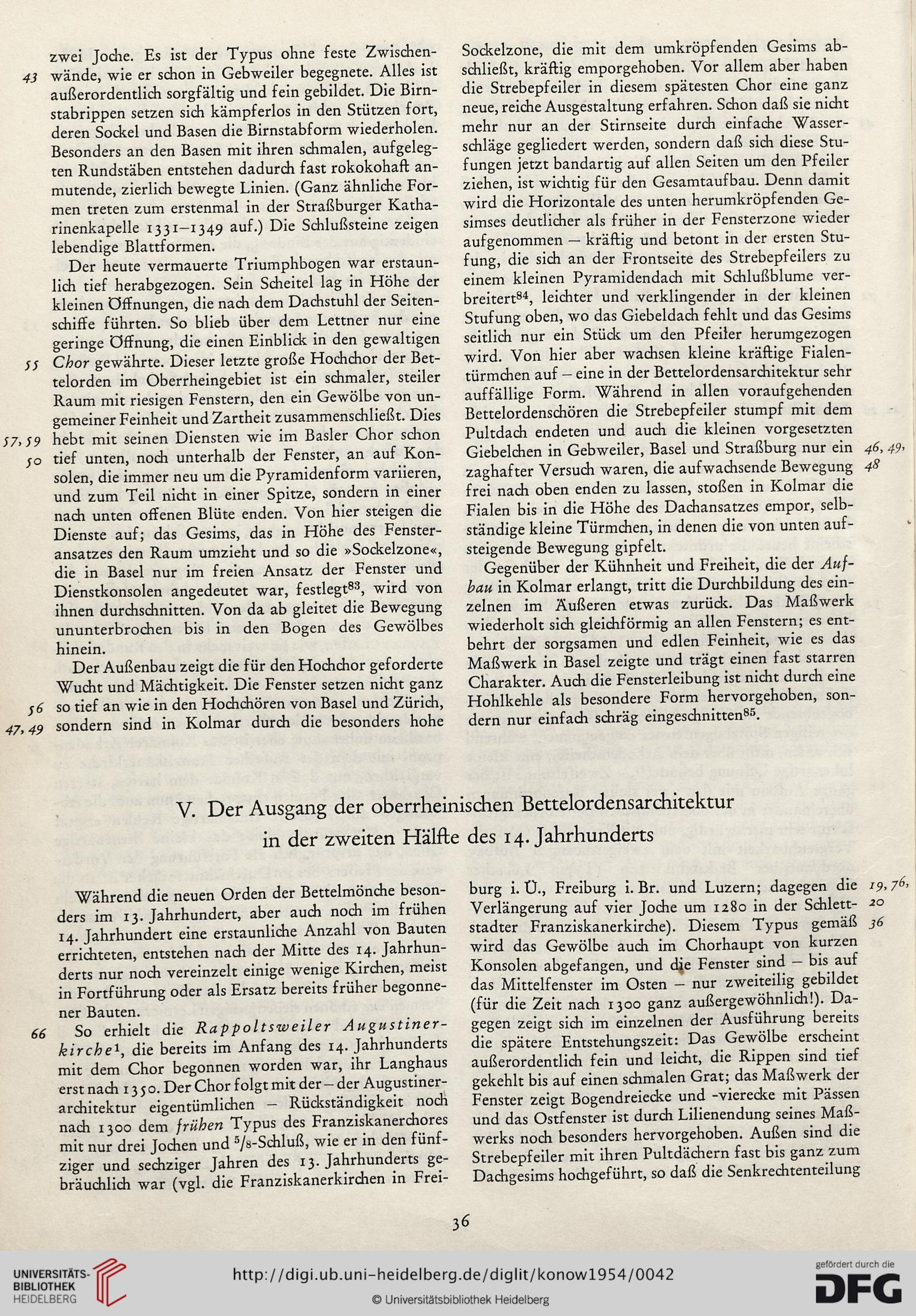zwei Joche. Es ist der Typus ohne feste Zwischen-
43 wände, wie er schon in Gebweiler begegnete. Alles ist
außerordentlich sorgfältig und fein gebildet. Die Birn-
stabrippen setzen sich kämpferlos in den Stützen fort,
deren Sockel und Basen die Birnstabform wiederholen.
Besonders an den Basen mit ihren schmalen, aufgeleg-
ten Rundstäben entstehen dadurch fast rokokohaft an-
mutende, zierlich bewegte Linien. (Ganz ähnlidie For-
men treten zum erstenmal in der Straßburger Katha-
rinenkapelle 1331—1349 auf.) Die Schlußsteine zeigen
lebendige Blattformen.
Der heute vermauerte Triumphbogen war erstaun-
lich tief herabgezogen. Sein Scheitel lag in Höhe der
kleinen öffnungen, die nadi dem Dachstuhl der Seiten-
schiffe fiihrten. So blieb über dem Lettner nur eine
geringe öffnung, die einen Einblick in den gewaltigen
33 Chor gewährte. Dieser letzte große Hochchor der Bet-
telorden im Oberrheingebiet ist ein schmaler, steiler
Raum mit riesigen Fenstern, den ein Gewölbe von un-
gemeiner Feinheit und Zartheit zusammenschließt. Dies
39 hebt mit seinen Diensten wie im Basler Chor schon
30 tief unten, noch unterhalb der Fenster, an auf Kon-
solen, die immer neu um die Pyramidenform variieren,
und zum Teil nicht in einer Spitze, sondern in einer
nach unten offenen Blüte enden. Von hier steigen die
Dienste auf; das Gesims, das in Höhe des Fenster-
ansatzes den Raum umzieht und so die »Sockelzone«,
die in Basel nur im freien Ansatz der Fenster und
Dienstkonsolen angedeutet war, festlegt83, wird von
ihnen durchschnitten. Von da ab gleitet die Bewegung
ununterbrochen bis in den Bogen des Gewölbes
hinein.
Der Außenbau zeigt die für den Hochchor geforderte
Wucht und Mächtigkeit. Die Fenster setzen nicht ganz
36 so tief an wie in den Hochchören von Basel und Zürich,
49 sondern sind in Kolmar durch die besonders hohe
Sockelzone, die mit dem umkröpfenden Gesims ab-
schließt, kräftig emporgehoben. Vor allem aber haben
die Strebepfeiler in diesem spätesten Chor eine ganz
neue, reiche Ausgestaltung erfahren. Schon daß sie nicht
mehr nur an der Stirnseite durch einfache Wasser-
schläge gegliedert werden, sondern daß sich diese Stu-
fungen jetzt bandartig auf allen Seiten um den Pfeiler
ziehen, ist wichtig für den Gesamtaufbau. Denn damit
wird die Horizontale des unten herumkröpfenden Ge-
simses deutlicher als früher in der Fensterzone wieder
aufgenommen — kräftig und betont in der ersten Stu-
fung, die sich an der Frontseite des Strebepfeilers zu
einem kleinen Pyramidendach mit Schlußblume ver-
breitert84, leichter und verklingender in der kleinen
Stufung oben, wo das Giebeldach fehlt und das Gesims
seitlich nur ein Stück um den Pfeiler herumgezogen
wird. Von hier aber wachsen kleine kräftige Fialen-
türmchen auf — eine in der Bettelordensarchitektur sehr
auffällige Form. Während in allen voraufgehenden
Bettelordenschören die Strebepfeiler stumpf mit dem
Pultdach endeten und auch die kleinen vorgesetzten
Giebelchen in Gebweiler, Basel und Straßburg nur ein 46, 49,
zaghafter Versuch waren, die aufwachsende Bewegung 48
frei nach oben enden zu lassen, stoßen in Kolmar die
Fialen bis in die Höhe des Dachansatzes empor, selb-
ständige kleine Türmchen, in denen die von unten auf-
steigende Bewegung gipfelt.
Gegenüber der Kühnheit und Freiheit, die der Auf-
bau in Kolmar erlangt, tritt die Durchbildung des ein-
zelnen im Äußeren etwas zurück. Das Maßwerk
wiederholt sich gleichförmig an allen Fenstern; es ent-
behrt der sorgsamen und edlen Feinheit, wie es das
Maßwerk in Basel zeigte und trägt einen fast starren
Charakter. Auch die Fensterleibung ist nicht durch eine
Hohlkehle als besondere Form hervorgehoben, son-
dern nur einfach schräg eingeschnitten85.
V. Der Ausgang der oberrheinischen Bettelordensarchitektur
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Während die neuen Orden der Bettelmönche beson-
ders im 13. Jahrhundert, aber auch noch im frühen
14. Jahrhundert eine erstaunliche Anzahl von Bauten
errichteten, entstehen nach der Mitte des 14. Jahrhun-
derts nur noch vereinzelt einige wenige Kirchen, meist
in Fortführung oder als Ersatz bereits früher begonne-
ner Bauten.
66 So erhielt die Rappoltsweiler Augustiner-
kirche1, die bereits im Anfang des 14. Jahrhunderts
mit dem Chor begonnen worden war, ihr Langhaus
erst nach 13 5 o. Der Chor folgt mit der - der Augustiner-
architektur eigentümlichen - Rückständigkeit noch
nach 1300 dem frühen Typus des Franziskanerchores
mit nur drei Jochen und 5/s-Schluß, wie er in den fünf-
ziger und sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts ge-
bräuchlich war (vgl. die Franziskanerkirchen in Frei-
burg i. Ü., Freiburg i. Br. und Luzern; dagegen die 19,76'
Verlängerung auf vier Joche um 1280 in der Schlett- *0
stadter Franziskanerkirche). Diesem Typus gemäß 36
wird das Gewölbe auch im Chorhaupt von kurzen
Konsolen abgefangen, und die Fenster sind — bis auf
das Mittelfenster im Osten - nur zweiteilig gebildet
(für die Zeit nach 1300 ganz außergewöhnlich!). Da-
gegen zeigt sidi im einzelnen der Ausführung bereits
die spätere Entstehungszeit: Das Gewölbe erscheint
außerordentlich fein und leicht, die Rippen sind tief
gekehlt bis auf einen sdimalen Grat; das Maßwerk der
Fenster zeigt Bogendreiecke und -vierecke mit Pässen
und das Ostfenster ist durch Lilienendung seines Maß-
werks noch besonders hervorgehoben. Außen sind die
Strebepfeiler mit ihren Pultdächern fast bis ganz zum
Dachgesims hochgeführt, so daß die Senkrechtenteilung
36
43 wände, wie er schon in Gebweiler begegnete. Alles ist
außerordentlich sorgfältig und fein gebildet. Die Birn-
stabrippen setzen sich kämpferlos in den Stützen fort,
deren Sockel und Basen die Birnstabform wiederholen.
Besonders an den Basen mit ihren schmalen, aufgeleg-
ten Rundstäben entstehen dadurch fast rokokohaft an-
mutende, zierlich bewegte Linien. (Ganz ähnlidie For-
men treten zum erstenmal in der Straßburger Katha-
rinenkapelle 1331—1349 auf.) Die Schlußsteine zeigen
lebendige Blattformen.
Der heute vermauerte Triumphbogen war erstaun-
lich tief herabgezogen. Sein Scheitel lag in Höhe der
kleinen öffnungen, die nadi dem Dachstuhl der Seiten-
schiffe fiihrten. So blieb über dem Lettner nur eine
geringe öffnung, die einen Einblick in den gewaltigen
33 Chor gewährte. Dieser letzte große Hochchor der Bet-
telorden im Oberrheingebiet ist ein schmaler, steiler
Raum mit riesigen Fenstern, den ein Gewölbe von un-
gemeiner Feinheit und Zartheit zusammenschließt. Dies
39 hebt mit seinen Diensten wie im Basler Chor schon
30 tief unten, noch unterhalb der Fenster, an auf Kon-
solen, die immer neu um die Pyramidenform variieren,
und zum Teil nicht in einer Spitze, sondern in einer
nach unten offenen Blüte enden. Von hier steigen die
Dienste auf; das Gesims, das in Höhe des Fenster-
ansatzes den Raum umzieht und so die »Sockelzone«,
die in Basel nur im freien Ansatz der Fenster und
Dienstkonsolen angedeutet war, festlegt83, wird von
ihnen durchschnitten. Von da ab gleitet die Bewegung
ununterbrochen bis in den Bogen des Gewölbes
hinein.
Der Außenbau zeigt die für den Hochchor geforderte
Wucht und Mächtigkeit. Die Fenster setzen nicht ganz
36 so tief an wie in den Hochchören von Basel und Zürich,
49 sondern sind in Kolmar durch die besonders hohe
Sockelzone, die mit dem umkröpfenden Gesims ab-
schließt, kräftig emporgehoben. Vor allem aber haben
die Strebepfeiler in diesem spätesten Chor eine ganz
neue, reiche Ausgestaltung erfahren. Schon daß sie nicht
mehr nur an der Stirnseite durch einfache Wasser-
schläge gegliedert werden, sondern daß sich diese Stu-
fungen jetzt bandartig auf allen Seiten um den Pfeiler
ziehen, ist wichtig für den Gesamtaufbau. Denn damit
wird die Horizontale des unten herumkröpfenden Ge-
simses deutlicher als früher in der Fensterzone wieder
aufgenommen — kräftig und betont in der ersten Stu-
fung, die sich an der Frontseite des Strebepfeilers zu
einem kleinen Pyramidendach mit Schlußblume ver-
breitert84, leichter und verklingender in der kleinen
Stufung oben, wo das Giebeldach fehlt und das Gesims
seitlich nur ein Stück um den Pfeiler herumgezogen
wird. Von hier aber wachsen kleine kräftige Fialen-
türmchen auf — eine in der Bettelordensarchitektur sehr
auffällige Form. Während in allen voraufgehenden
Bettelordenschören die Strebepfeiler stumpf mit dem
Pultdach endeten und auch die kleinen vorgesetzten
Giebelchen in Gebweiler, Basel und Straßburg nur ein 46, 49,
zaghafter Versuch waren, die aufwachsende Bewegung 48
frei nach oben enden zu lassen, stoßen in Kolmar die
Fialen bis in die Höhe des Dachansatzes empor, selb-
ständige kleine Türmchen, in denen die von unten auf-
steigende Bewegung gipfelt.
Gegenüber der Kühnheit und Freiheit, die der Auf-
bau in Kolmar erlangt, tritt die Durchbildung des ein-
zelnen im Äußeren etwas zurück. Das Maßwerk
wiederholt sich gleichförmig an allen Fenstern; es ent-
behrt der sorgsamen und edlen Feinheit, wie es das
Maßwerk in Basel zeigte und trägt einen fast starren
Charakter. Auch die Fensterleibung ist nicht durch eine
Hohlkehle als besondere Form hervorgehoben, son-
dern nur einfach schräg eingeschnitten85.
V. Der Ausgang der oberrheinischen Bettelordensarchitektur
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Während die neuen Orden der Bettelmönche beson-
ders im 13. Jahrhundert, aber auch noch im frühen
14. Jahrhundert eine erstaunliche Anzahl von Bauten
errichteten, entstehen nach der Mitte des 14. Jahrhun-
derts nur noch vereinzelt einige wenige Kirchen, meist
in Fortführung oder als Ersatz bereits früher begonne-
ner Bauten.
66 So erhielt die Rappoltsweiler Augustiner-
kirche1, die bereits im Anfang des 14. Jahrhunderts
mit dem Chor begonnen worden war, ihr Langhaus
erst nach 13 5 o. Der Chor folgt mit der - der Augustiner-
architektur eigentümlichen - Rückständigkeit noch
nach 1300 dem frühen Typus des Franziskanerchores
mit nur drei Jochen und 5/s-Schluß, wie er in den fünf-
ziger und sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts ge-
bräuchlich war (vgl. die Franziskanerkirchen in Frei-
burg i. Ü., Freiburg i. Br. und Luzern; dagegen die 19,76'
Verlängerung auf vier Joche um 1280 in der Schlett- *0
stadter Franziskanerkirche). Diesem Typus gemäß 36
wird das Gewölbe auch im Chorhaupt von kurzen
Konsolen abgefangen, und die Fenster sind — bis auf
das Mittelfenster im Osten - nur zweiteilig gebildet
(für die Zeit nach 1300 ganz außergewöhnlich!). Da-
gegen zeigt sidi im einzelnen der Ausführung bereits
die spätere Entstehungszeit: Das Gewölbe erscheint
außerordentlich fein und leicht, die Rippen sind tief
gekehlt bis auf einen sdimalen Grat; das Maßwerk der
Fenster zeigt Bogendreiecke und -vierecke mit Pässen
und das Ostfenster ist durch Lilienendung seines Maß-
werks noch besonders hervorgehoben. Außen sind die
Strebepfeiler mit ihren Pultdächern fast bis ganz zum
Dachgesims hochgeführt, so daß die Senkrechtenteilung
36