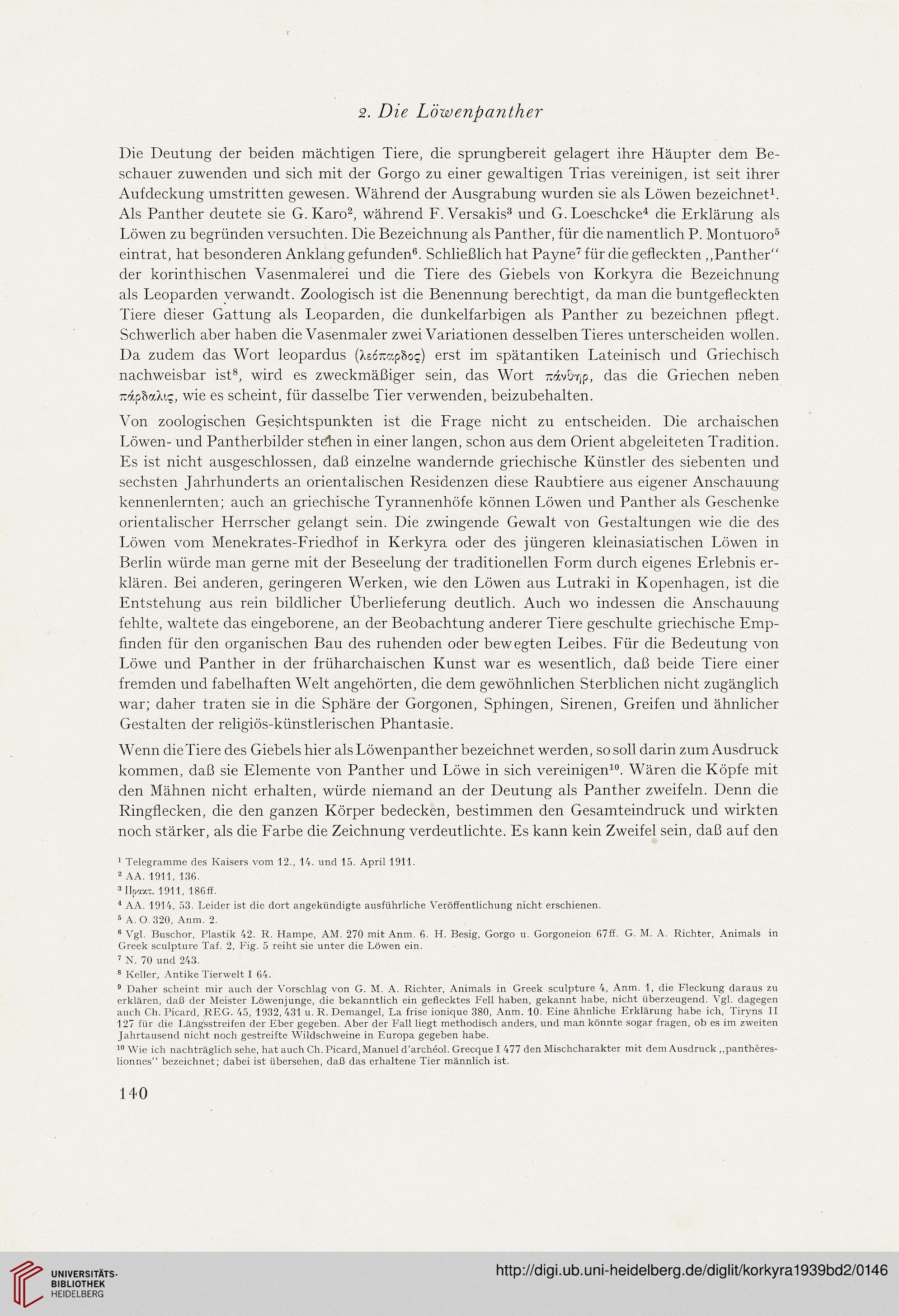2. D ie Löwenpanther
Die Deutung der beiden mächtigen Tiere, die sprungbereit gelagert ihre Häupter dem Be-
schauer zuwenden und sich mit der Gorgo zu einer gewaltigen Trias vereinigen, ist seit ihrer
Aufdeckung umstritten gewesen. Während der Ausgrabung wurden sie als Löwen bezeichnet1.
Als Panther deutete sie G. Karo2, während F.Versakis3 und G. Loeschcke4 die Erklärung als
Löwen zu begründen versuchten. Die Bezeichnung als Panther, für die namentlich P. Montuoro5
eintrat, hat besonderen Anklang gefunden6. Schließlich hat Payne7 für die gefleckten „Panther“
der korinthischen Vasenmalerei und die Tiere des Giebels von Korkyra die Bezeichnung
als Leoparden verwandt. Zoologisch ist die Benennung berechtigt, da man die buntgefleckten
Tiere dieser Gattung als Leoparden, die dunkelfarbigen als Panther zu bezeichnen pflegt.
Schwerlich aber haben die Vasenmaler zwei Variationen desselben Tieres unterscheiden wollen.
Da zudem das Wort leopardus (XsÖ7t«p§og) erst im spätantiken Lateinisch und Griechisch
nachweisbar ist8, wird es zweckmäßiger sein, das Wort Trav&rjp, das die Griechen neben
-ap5>aXic, wie es scheint, für dasselbe Tier verwenden, beizubehalten.
Von zoologischen Gesichtspunkten ist die Frage nicht zu entscheiden. Die archaischen
Löwen- und Pantherbilder stöben in einer langen, schon aus dem Orient abgeleiteten Tradition.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß einzelne wandernde griechische Künstler des siebenten und
sechsten Jahrhunderts an orientalischen Residenzen diese Raubtiere aus eigener Anschauung
kennenlernten; auch an griechische Tyrannenhöfe können Löwen und Panther als Geschenke
orientalischer Herrscher gelangt sein. Die zwingende Gewalt von Gestaltungen wie die des
Löwen vom Menekrates-Friedhof in Kerkyra oder des jüngeren kleinasiatischen Löwen in
Berlin würde man gerne mit der Beseelung der traditionellen Form durch eigenes Erlebnis er-
klären. Bei anderen, geringeren Werken, wie den Löwen aus Lutraki in Kopenhagen, ist die
Entstehung aus rein bildlicher Überlieferung deutlich. Auch wo indessen die Anschauung
fehlte, waltete das eingeborene, an der Beobachtung anderer Tiere geschulte griechische Emp-
finden für den organischen Bau des ruhenden oder bewegten Leibes. Für die Bedeutung von
Löwe und Panther in der früharchaischen Kunst war es wesentlich, daß beide Tiere einer
fremden und fabelhaften Welt angehörten, die dem gewöhnlichen Sterblichen nicht zugänglich
war; daher traten sie in die Sphäre der Gorgonen, Sphingen, Sirenen, Greifen und ähnlicher
Gestalten der religiös-künstlerischen Phantasie.
Wenn dieTiere des Giebels hier als Löwenpanther bezeichnet werden, so soll darin zum Ausdruck
kommen, daß sie Elemente von Panther und Löwe in sich vereinigen10. Wären die Köpfe mit
den Mähnen nicht erhalten, würde niemand an der Deutung als Panther zweifeln. Denn die
Ringflecken, die den ganzen Körper bedecken, bestimmen den Gesamteindruck und wirkten
noch stärker, als die Farbe die Zeichnung verdeutlichte. Es kann kein Zweifel sein, daß auf den
1 Telegramme des Kaisers vom 12., 14. und 15. April 1911.
2 AA. 1911, 136.
3 Ilpct'/T. 1911, 186 ff.
4 AA. 1914, 53. Leider ist die dort angekündigte ausführliche Veröffentlichung nicht erschienen.
5 A. 0.320, Anm. 2.
6 Vgl. Buschor, Plastik 42. R. Hampe, AM. 270 mit Anm. 6. H. Besig, Gorgo u. Gorgoneion 67ff. G. M. A. Richter, Animais in
Greek sculpture Taf. 2, Fig. 5 reiht sie unter die Löwen ein.
7 N. 70 und 243.
8 Keller, Antike Tierwelt I 64.
9 Daher scheint mir auch der Vorschlag von G. M. A. Richter, Animais in Greek sculpture 4, Anm. 1, die Fleckung daraus zu
erklären, daß der Meister Löwenjunge, die bekanntlich ein geflecktes Fell haben, gekannt habe, nicht überzeugend. Vgl. dagegen
auch Ch. Picard, REG. 45, 1932, 431 u. R. Demangel, La frise ionique 380, Anm. 10. Eine ähnliche Erklärung habe ich, Tiryns II
127 für die Längsstreifen der Eber gegeben. Aber der Fall liegt methodisch anders, und man könnte sogar fragen, ob es im zweiten
Jahrtausend nicht noch gestreifte Wildschweine in Europa gegeben habe.
10 Wie ich nachträglich sehe, hat auch Ch. Picard, Manuel d’archeol. Grecque I 477 den Mischcharakter mit dem Ausdruck „pantheres-
lionnes“ bezeichnet; dabei ist übersehen, daß das erhaltene Tier männlich ist.
140
Die Deutung der beiden mächtigen Tiere, die sprungbereit gelagert ihre Häupter dem Be-
schauer zuwenden und sich mit der Gorgo zu einer gewaltigen Trias vereinigen, ist seit ihrer
Aufdeckung umstritten gewesen. Während der Ausgrabung wurden sie als Löwen bezeichnet1.
Als Panther deutete sie G. Karo2, während F.Versakis3 und G. Loeschcke4 die Erklärung als
Löwen zu begründen versuchten. Die Bezeichnung als Panther, für die namentlich P. Montuoro5
eintrat, hat besonderen Anklang gefunden6. Schließlich hat Payne7 für die gefleckten „Panther“
der korinthischen Vasenmalerei und die Tiere des Giebels von Korkyra die Bezeichnung
als Leoparden verwandt. Zoologisch ist die Benennung berechtigt, da man die buntgefleckten
Tiere dieser Gattung als Leoparden, die dunkelfarbigen als Panther zu bezeichnen pflegt.
Schwerlich aber haben die Vasenmaler zwei Variationen desselben Tieres unterscheiden wollen.
Da zudem das Wort leopardus (XsÖ7t«p§og) erst im spätantiken Lateinisch und Griechisch
nachweisbar ist8, wird es zweckmäßiger sein, das Wort Trav&rjp, das die Griechen neben
-ap5>aXic, wie es scheint, für dasselbe Tier verwenden, beizubehalten.
Von zoologischen Gesichtspunkten ist die Frage nicht zu entscheiden. Die archaischen
Löwen- und Pantherbilder stöben in einer langen, schon aus dem Orient abgeleiteten Tradition.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß einzelne wandernde griechische Künstler des siebenten und
sechsten Jahrhunderts an orientalischen Residenzen diese Raubtiere aus eigener Anschauung
kennenlernten; auch an griechische Tyrannenhöfe können Löwen und Panther als Geschenke
orientalischer Herrscher gelangt sein. Die zwingende Gewalt von Gestaltungen wie die des
Löwen vom Menekrates-Friedhof in Kerkyra oder des jüngeren kleinasiatischen Löwen in
Berlin würde man gerne mit der Beseelung der traditionellen Form durch eigenes Erlebnis er-
klären. Bei anderen, geringeren Werken, wie den Löwen aus Lutraki in Kopenhagen, ist die
Entstehung aus rein bildlicher Überlieferung deutlich. Auch wo indessen die Anschauung
fehlte, waltete das eingeborene, an der Beobachtung anderer Tiere geschulte griechische Emp-
finden für den organischen Bau des ruhenden oder bewegten Leibes. Für die Bedeutung von
Löwe und Panther in der früharchaischen Kunst war es wesentlich, daß beide Tiere einer
fremden und fabelhaften Welt angehörten, die dem gewöhnlichen Sterblichen nicht zugänglich
war; daher traten sie in die Sphäre der Gorgonen, Sphingen, Sirenen, Greifen und ähnlicher
Gestalten der religiös-künstlerischen Phantasie.
Wenn dieTiere des Giebels hier als Löwenpanther bezeichnet werden, so soll darin zum Ausdruck
kommen, daß sie Elemente von Panther und Löwe in sich vereinigen10. Wären die Köpfe mit
den Mähnen nicht erhalten, würde niemand an der Deutung als Panther zweifeln. Denn die
Ringflecken, die den ganzen Körper bedecken, bestimmen den Gesamteindruck und wirkten
noch stärker, als die Farbe die Zeichnung verdeutlichte. Es kann kein Zweifel sein, daß auf den
1 Telegramme des Kaisers vom 12., 14. und 15. April 1911.
2 AA. 1911, 136.
3 Ilpct'/T. 1911, 186 ff.
4 AA. 1914, 53. Leider ist die dort angekündigte ausführliche Veröffentlichung nicht erschienen.
5 A. 0.320, Anm. 2.
6 Vgl. Buschor, Plastik 42. R. Hampe, AM. 270 mit Anm. 6. H. Besig, Gorgo u. Gorgoneion 67ff. G. M. A. Richter, Animais in
Greek sculpture Taf. 2, Fig. 5 reiht sie unter die Löwen ein.
7 N. 70 und 243.
8 Keller, Antike Tierwelt I 64.
9 Daher scheint mir auch der Vorschlag von G. M. A. Richter, Animais in Greek sculpture 4, Anm. 1, die Fleckung daraus zu
erklären, daß der Meister Löwenjunge, die bekanntlich ein geflecktes Fell haben, gekannt habe, nicht überzeugend. Vgl. dagegen
auch Ch. Picard, REG. 45, 1932, 431 u. R. Demangel, La frise ionique 380, Anm. 10. Eine ähnliche Erklärung habe ich, Tiryns II
127 für die Längsstreifen der Eber gegeben. Aber der Fall liegt methodisch anders, und man könnte sogar fragen, ob es im zweiten
Jahrtausend nicht noch gestreifte Wildschweine in Europa gegeben habe.
10 Wie ich nachträglich sehe, hat auch Ch. Picard, Manuel d’archeol. Grecque I 477 den Mischcharakter mit dem Ausdruck „pantheres-
lionnes“ bezeichnet; dabei ist übersehen, daß das erhaltene Tier männlich ist.
140