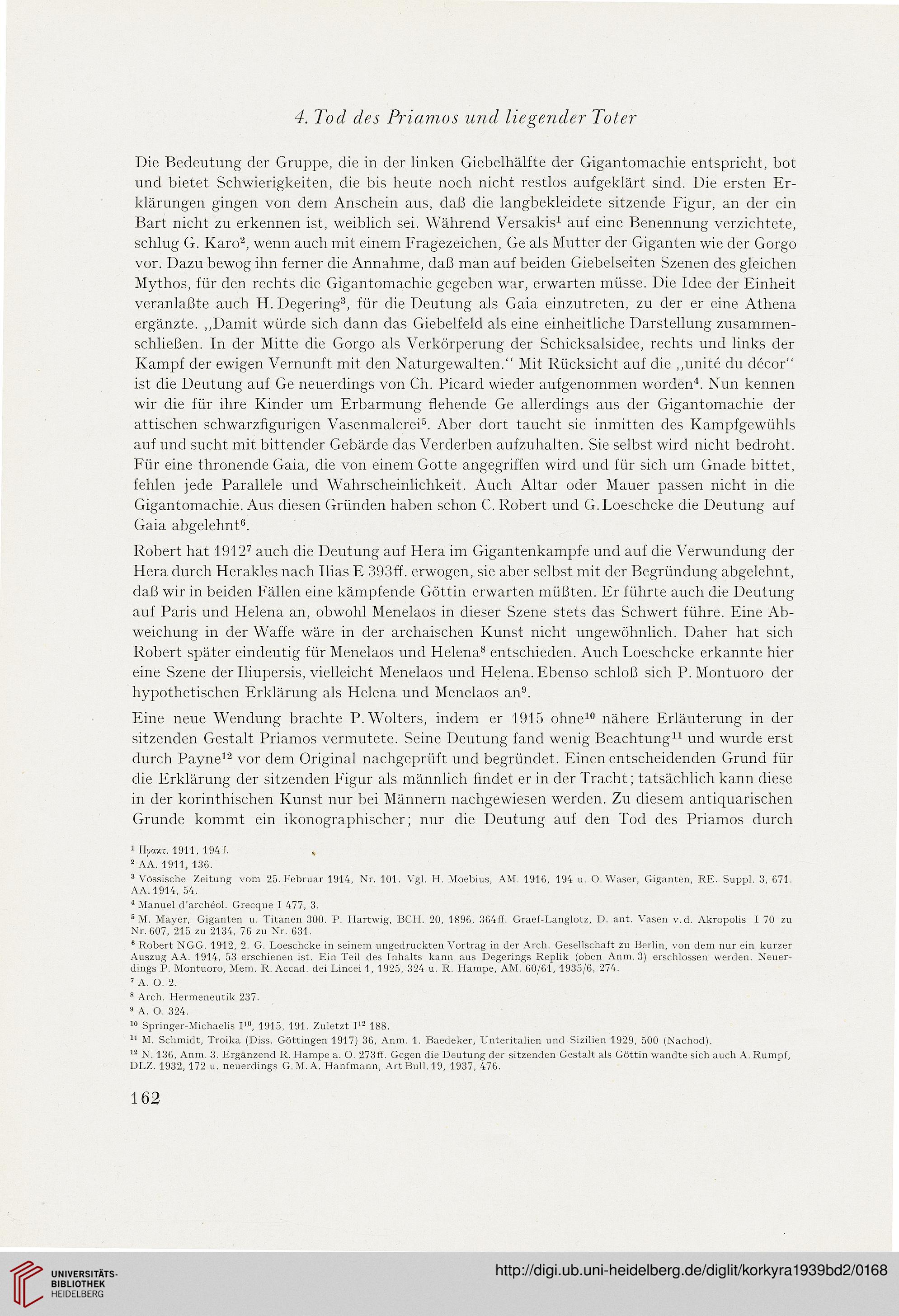4. Tod des Priamos und liegender Toter
Die Bedeutung der Gruppe, die in der linken Giebelhälfte der Gigantomachie entspricht, bot
und bietet Schwierigkeiten, die bis heute noch nicht restlos aufgeklärt sind. Die ersten Er-
klärungen gingen von dem Anschein aus, daß die langbekleidete sitzende Figur, an der ein
Bart nicht zu erkennen ist, weiblich sei. Während Versakis1 auf eine Benennung verzichtete,
schlug G. Karo2, wenn auch mit einem Fragezeichen, Ge als Mutter der Giganten wie der Gorgo
vor. Dazu bewog ihn ferner die Annahme, daß man auf beiden Giebelseiten Szenen des gleichen
Mythos, für den rechts die Gigantomachie gegeben war, erwarten müsse. Die Idee der Einheit
veranlaßte auch H.Degering3, für die Deutung als Gaia einzutreten, zu der er eine Athena
ergänzte. „Damit würde sich dann das Giebelfeld als eine einheitliche Darstellung zusammen-
schließen. In der Mitte die Gorgo als Verkörperung der Schicksalsidee, rechts und links der
Kampf der ewigen Vernunft mit den Naturgewalten.'' Mit Rücksicht auf die „unite du decor“
ist die Deutung auf Ge neuerdings von Ch. Picard wieder aufgenommen worden4. Nun kennen
wir die für ihre Kinder um Erbarmung flehende Ge allerdings aus der Gigantomachie der
attischen schwarzfigurigen Vasenmalerei5. Aber dort taucht sie inmitten des Kampfgewühls
auf und sucht mit bittender Gebärde das Verderben aufzuhalten. Sie selbst wird nicht bedroht.
Für eine thronende Gaia, die von einem Gotte angegriffen wird und für sich um Gnade bittet,
fehlen jede Parallele und Wahrscheinlichkeit. Auch Altar oder Mauer passen nicht in die
Gigantomachie. Aus diesen Gründen haben schon C. Robert und G.Loeschcke die Deutung auf
Gaia abgelehnt6.
Robert hat 19127 auch die Deutung auf Hera im Gigantenkampfe und auf die Verwundung der
Hera durch Herakles nach Ilias E 393ff. erwogen, sie aber selbst mit der Begründung abgelehnt,
daß wir in beiden Fällen eine kämpfende Göttin erwarten müßten. Er führte auch die Deutung
auf Paris und Helena an, obwohl Menelaos in dieser Szene stets das Schwert führe. Eine Ab-
weichung in der Waffe wäre in der archaischen Kunst nicht ungewöhnlich. Daher hat sich
Robert später eindeutig für Menelaos und Helena8 entschieden. Auch Loeschcke erkannte hier
eine Szene der Iliupersis, vielleicht Menelaos und Helena. Ebenso schloß sich P. Montuoro der
hypothetischen Erklärung als Helena und Menelaos an9.
Eine neue Wendung brachte P. Wolters, indem er 1915 ohne10 nähere Erläuterung in der
sitzenden Gestalt Priamos vermutete. Seine Deutung fand wenig Beachtung11 und wurde erst
durch Payne12 vor dem Original nachgeprüft und begründet. Einen entscheidenden Grund für
die Erklärung der sitzenden Figur als männlich findet er in der Tracht; tatsächlich kann diese
in der korinthischen Kunst nur bei Männern nachgewiesen werden. Zu diesem antiquarischen
Grunde kommt ein ikonographischer; nur die Deutung auf den Tod des Priamos durch
1 IIpaxT. 1911. 194 f. ,
2 AA. 1911, 136.
3 Vössische Zeitung vom 25. Februar 1914, Nr. 101. Vgl. H. Moebius, AM. 1916, 194 u. O. Waser, Giganten, RE. Suppl. 3, 671.
AA. 1914, 54.
4 Manuel d’archeol. Grecque I 477, 3.
6 M. Mayer, Giganten u. Titanen 300. P. Hartwig, BCH. 20, 1896, 364ff. Graef-Langlotz, D. ant. Vasen v. d. Akropolis I 70 zu
Nr. 607, 215 zu 2134, 76 zu Nr. 631.
6 Robert NGG. 1912, 2. G. Loeschcke in seinem ungedruckten Vortrag in der Arch. Gesellschaft zu Berlin, von dem nur ein kurzer
Auszug AA. 1914, 53 erschienen ist. Ein Teil des Inhalts kann aus Degerings Replik (oben Anm. 3) erschlossen werden. Neuer-
dings P. Montuoro, Mem. R. Accad. dei Lincei 1, 1925, 324 u. R. Hampe, AM. 60/61, 1935/6, 274.
7 A. O. 2.
8 Arch. Hermeneutik 237.
9 A. O. 324.
10 Springer-Michaelis I10, 1915, 191. Zuletzt I12 188.
11 M. Schmidt, Troika (Diss. Göttingen 1917) 36, Anm. 1. Baedeker, Unteritalien und Sizilien 1929, 500 (Nachod).
12 N. 136, Anm. 3. Ergänzend R. Hampe a. O. 273ff. Gegen die Deutung der sitzenden Gestalt als Göttin wandte sich auch A. Rumpf,
DLZ. 1932, 172 u. neuerdings G.M.A. Hanfmann, Art Bull. 19, 1937, 476.
162
Die Bedeutung der Gruppe, die in der linken Giebelhälfte der Gigantomachie entspricht, bot
und bietet Schwierigkeiten, die bis heute noch nicht restlos aufgeklärt sind. Die ersten Er-
klärungen gingen von dem Anschein aus, daß die langbekleidete sitzende Figur, an der ein
Bart nicht zu erkennen ist, weiblich sei. Während Versakis1 auf eine Benennung verzichtete,
schlug G. Karo2, wenn auch mit einem Fragezeichen, Ge als Mutter der Giganten wie der Gorgo
vor. Dazu bewog ihn ferner die Annahme, daß man auf beiden Giebelseiten Szenen des gleichen
Mythos, für den rechts die Gigantomachie gegeben war, erwarten müsse. Die Idee der Einheit
veranlaßte auch H.Degering3, für die Deutung als Gaia einzutreten, zu der er eine Athena
ergänzte. „Damit würde sich dann das Giebelfeld als eine einheitliche Darstellung zusammen-
schließen. In der Mitte die Gorgo als Verkörperung der Schicksalsidee, rechts und links der
Kampf der ewigen Vernunft mit den Naturgewalten.'' Mit Rücksicht auf die „unite du decor“
ist die Deutung auf Ge neuerdings von Ch. Picard wieder aufgenommen worden4. Nun kennen
wir die für ihre Kinder um Erbarmung flehende Ge allerdings aus der Gigantomachie der
attischen schwarzfigurigen Vasenmalerei5. Aber dort taucht sie inmitten des Kampfgewühls
auf und sucht mit bittender Gebärde das Verderben aufzuhalten. Sie selbst wird nicht bedroht.
Für eine thronende Gaia, die von einem Gotte angegriffen wird und für sich um Gnade bittet,
fehlen jede Parallele und Wahrscheinlichkeit. Auch Altar oder Mauer passen nicht in die
Gigantomachie. Aus diesen Gründen haben schon C. Robert und G.Loeschcke die Deutung auf
Gaia abgelehnt6.
Robert hat 19127 auch die Deutung auf Hera im Gigantenkampfe und auf die Verwundung der
Hera durch Herakles nach Ilias E 393ff. erwogen, sie aber selbst mit der Begründung abgelehnt,
daß wir in beiden Fällen eine kämpfende Göttin erwarten müßten. Er führte auch die Deutung
auf Paris und Helena an, obwohl Menelaos in dieser Szene stets das Schwert führe. Eine Ab-
weichung in der Waffe wäre in der archaischen Kunst nicht ungewöhnlich. Daher hat sich
Robert später eindeutig für Menelaos und Helena8 entschieden. Auch Loeschcke erkannte hier
eine Szene der Iliupersis, vielleicht Menelaos und Helena. Ebenso schloß sich P. Montuoro der
hypothetischen Erklärung als Helena und Menelaos an9.
Eine neue Wendung brachte P. Wolters, indem er 1915 ohne10 nähere Erläuterung in der
sitzenden Gestalt Priamos vermutete. Seine Deutung fand wenig Beachtung11 und wurde erst
durch Payne12 vor dem Original nachgeprüft und begründet. Einen entscheidenden Grund für
die Erklärung der sitzenden Figur als männlich findet er in der Tracht; tatsächlich kann diese
in der korinthischen Kunst nur bei Männern nachgewiesen werden. Zu diesem antiquarischen
Grunde kommt ein ikonographischer; nur die Deutung auf den Tod des Priamos durch
1 IIpaxT. 1911. 194 f. ,
2 AA. 1911, 136.
3 Vössische Zeitung vom 25. Februar 1914, Nr. 101. Vgl. H. Moebius, AM. 1916, 194 u. O. Waser, Giganten, RE. Suppl. 3, 671.
AA. 1914, 54.
4 Manuel d’archeol. Grecque I 477, 3.
6 M. Mayer, Giganten u. Titanen 300. P. Hartwig, BCH. 20, 1896, 364ff. Graef-Langlotz, D. ant. Vasen v. d. Akropolis I 70 zu
Nr. 607, 215 zu 2134, 76 zu Nr. 631.
6 Robert NGG. 1912, 2. G. Loeschcke in seinem ungedruckten Vortrag in der Arch. Gesellschaft zu Berlin, von dem nur ein kurzer
Auszug AA. 1914, 53 erschienen ist. Ein Teil des Inhalts kann aus Degerings Replik (oben Anm. 3) erschlossen werden. Neuer-
dings P. Montuoro, Mem. R. Accad. dei Lincei 1, 1925, 324 u. R. Hampe, AM. 60/61, 1935/6, 274.
7 A. O. 2.
8 Arch. Hermeneutik 237.
9 A. O. 324.
10 Springer-Michaelis I10, 1915, 191. Zuletzt I12 188.
11 M. Schmidt, Troika (Diss. Göttingen 1917) 36, Anm. 1. Baedeker, Unteritalien und Sizilien 1929, 500 (Nachod).
12 N. 136, Anm. 3. Ergänzend R. Hampe a. O. 273ff. Gegen die Deutung der sitzenden Gestalt als Göttin wandte sich auch A. Rumpf,
DLZ. 1932, 172 u. neuerdings G.M.A. Hanfmann, Art Bull. 19, 1937, 476.
162