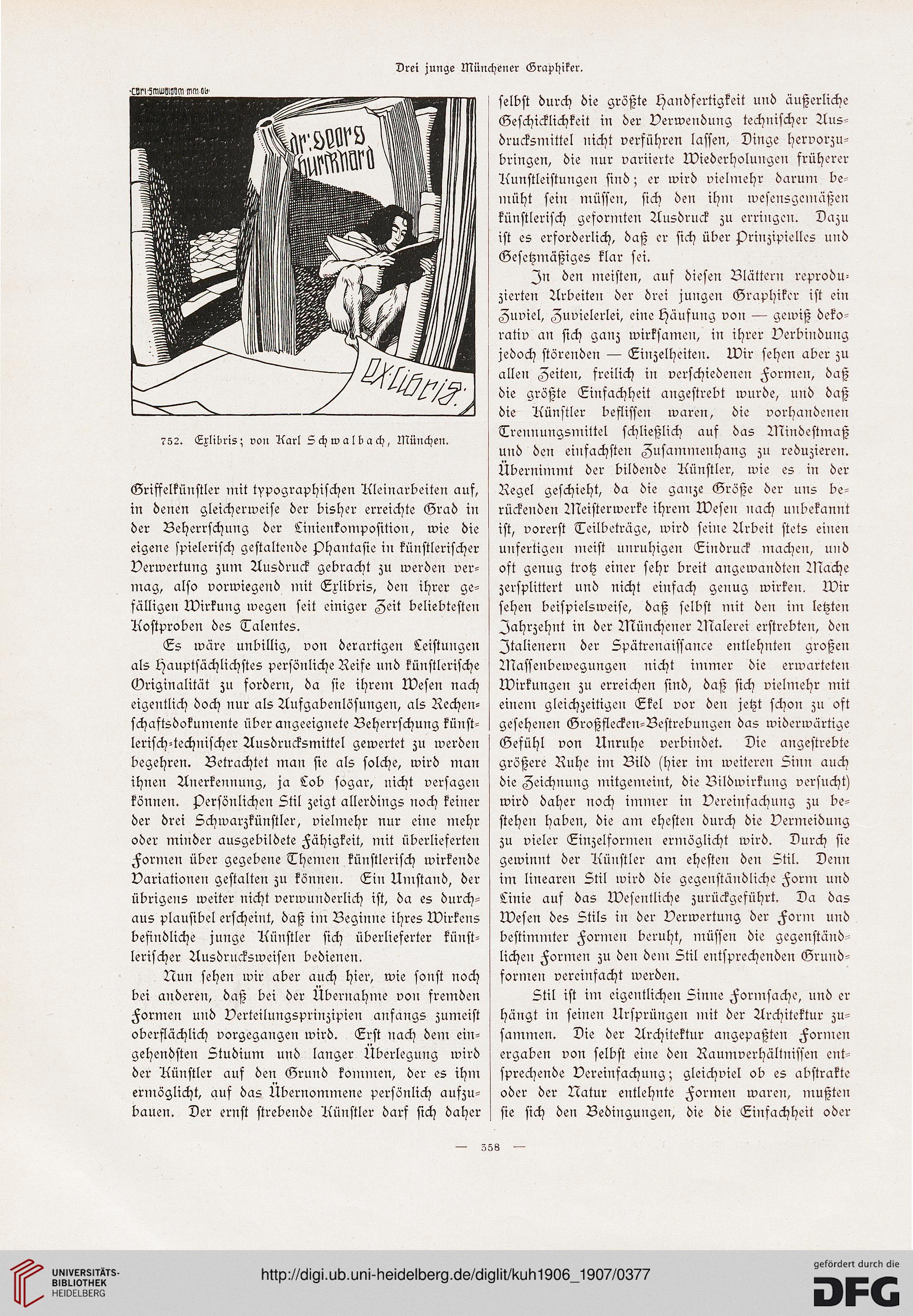Drei junge Münchener Graphiker.
■CBri'SmMtram
752. Exlibris; von Karl Schwalbach, München.
Griffelkünstler mit typographischen Aleinarbeiten auf,
in denen gleicherweise der bisher erreichte Grad in
der Beherrschung der Linienkomposition, wie die
eigene spielerisch gestaltende Phantasie in künstlerischer
Verwertung zum Ausdruck gebracht zu werden ver-
mag, also vorwiegend mit Exlibris, den ihrer ge-
fälligen Wirkung wegen feit einiger Zeit beliebtesten
Aostproben des Talentes.
Es wäre unbillig, von derartigen Leistungen
als hauptsächlichstes persönliche Reise und künstlerische
Originalität zu fordern, da sie ihrem Wesen nach
eigentlich doch nur als Aufgabenlösungen, als Rechen-
schaftsdokumente über angeeignete Beherrschung künst-
lerisch-technischer Ausdrucksmittel gewertet zu werden
begehren. Betrachtet man sie als solche, wird man
ihnen Anerkennung, ja Lob sogar, nicht versagen
können, persönlichen Stil zeigt allerdings noch keiner
der drei Schwarzkünstler, vielmehr nur eine mehr
oder minder ausgebildete Fähigkeit, mit überlieferten
Formen über gegebene Themen künstlerisch wirkende
Variationen gestalten zu können. Ein Umstand, der
übrigens weiter nicht verwunderlich ist, da es durch-
aus plausibel erscheint, daß im Beginne ihres Wirkens
befindliche junge Aünstler sich überlieferter künst-
lerischer Ausdrucksweisen bedienen.
Nun sehen wir aber auch hier, wie sonst noch
bei anderen, daß bei der Übernahme von fremden
Formen und Verteilungsprinzipien anfangs zumeist
oberfiächlich vorgegangen wird. Erst nach dem ein-
gehendsten Studium und langer Überlegung wird
der Aünstler auf den Grund kommen, der es ihm
ermöglicht, auf das Übernommene persönlich aufzu-
bauen. Der ernst strebende Aünstler darf sich daher
selbst durch die größte Handfertigkeit und äußerliche
Geschicklichkeit in der Verwendung technischer Aus-
drucksmittel nicht verführen lassen, Dinge hervorzu-
bringen, die nur variierte Wiederholungen früherer
Aunstleistungen sind; er wird vielmehr darum be-
inüht sein müssen, sich den ihm wesensgemäßen
künstlerisch geformten Ausdruck zu erringen. Dazu
ist es erforderlich, daß er sich über Prinzipielles und
Gesetznräßiges klar sei.
In den meisten, auf diesen Blättern reprodu-
zierten Arbeiten der drei jungen Graphiker ist ein
Zuviel, Zuvielerlei, eine Häufung von — gewiß deko-
rativ an sich ganz wirksamen, in ihrer Verbindung
jedoch störenden — Einzelheiten. Wir sehen aber zu
allen Zeiten, freilich in verschiedenen Formen, daß
die größte Einfachheit angestrebt wurde, und daß
die Aünstler beflissen waren, die vorhandenen
Trennungsmittel schließlich auf das Mindestmaß
und den einfachsten Zusammenhang zu reduziere».
Übernimmt der bildende Aünstler, wie es in der
Regel geschieht, da die ganze Größe der uns be-
rückenden Meisterwerke ihren: Wesen nach unbekannt
ist, vorerst Teilbeträge, wird seine Arbeit stets einen
unfertigen meist unruhigen Eindruck machen, und
oft genug trotz einer sehr breit angewandten Wache
zersplittert und nicht einfach genug wirken. Wir
sehen beispielsweise, daß selbst mit den in: letzten
Jahrzehnt in der Münchener Malerei erstrebten, den
Italienern der Spätrenaissance entlehnten großen
Massenbewegungen nicht immer die erwarteten
Wirkungen zu erreichen sind, daß sich vielmehr mit
einem gleichzeitigen Ekel vor den jetzt schon zu oft
gesehenen Großflecken-Bestrebungen das widerwärtige
Gefühl von Unruhe verbindet. Die angestrebte
größere Ruhe in: Bild (hier im weiteren Sinn auch
die Zeichnung mitgemeint, die Bildwirkung versucht)
wird daher noch immer in Vereinfachung zu be-
stehen haben, die am ehesten durch die Vermeidung
zu vieler Einzelsormen erinöglicht wird. Durch sie
gewinnt der Aünstler am ehesten den Stil. Denn
in: linearen Stil wird die gegenständliche Forn: und
Linie auf das Wesentliche zurückgeführt. Da das
Wesen des Stils in der Verwertung der Form und
bestimmter Formen beruht, müssen die gegenständ-
lichen Formen zu den den: Stil entsprechenden Grund-
formen vereinfacht werden.
Stil ist in: eigentlichen Sinne Formsache, und er
hängt in seinen Ursprüngen mit der Architektur zu-
sammen. Die der Architektur angepaßten Forn:en
ergaben von selbst eine den Raumverhältnissen ent-
sprechende Vereinfachung; gleichviel ob es abstrakte
oder der Natur entlehnte Formen waren, mußten
sie sich den Bedingungen, die die Einfachheit oder
258
■CBri'SmMtram
752. Exlibris; von Karl Schwalbach, München.
Griffelkünstler mit typographischen Aleinarbeiten auf,
in denen gleicherweise der bisher erreichte Grad in
der Beherrschung der Linienkomposition, wie die
eigene spielerisch gestaltende Phantasie in künstlerischer
Verwertung zum Ausdruck gebracht zu werden ver-
mag, also vorwiegend mit Exlibris, den ihrer ge-
fälligen Wirkung wegen feit einiger Zeit beliebtesten
Aostproben des Talentes.
Es wäre unbillig, von derartigen Leistungen
als hauptsächlichstes persönliche Reise und künstlerische
Originalität zu fordern, da sie ihrem Wesen nach
eigentlich doch nur als Aufgabenlösungen, als Rechen-
schaftsdokumente über angeeignete Beherrschung künst-
lerisch-technischer Ausdrucksmittel gewertet zu werden
begehren. Betrachtet man sie als solche, wird man
ihnen Anerkennung, ja Lob sogar, nicht versagen
können, persönlichen Stil zeigt allerdings noch keiner
der drei Schwarzkünstler, vielmehr nur eine mehr
oder minder ausgebildete Fähigkeit, mit überlieferten
Formen über gegebene Themen künstlerisch wirkende
Variationen gestalten zu können. Ein Umstand, der
übrigens weiter nicht verwunderlich ist, da es durch-
aus plausibel erscheint, daß im Beginne ihres Wirkens
befindliche junge Aünstler sich überlieferter künst-
lerischer Ausdrucksweisen bedienen.
Nun sehen wir aber auch hier, wie sonst noch
bei anderen, daß bei der Übernahme von fremden
Formen und Verteilungsprinzipien anfangs zumeist
oberfiächlich vorgegangen wird. Erst nach dem ein-
gehendsten Studium und langer Überlegung wird
der Aünstler auf den Grund kommen, der es ihm
ermöglicht, auf das Übernommene persönlich aufzu-
bauen. Der ernst strebende Aünstler darf sich daher
selbst durch die größte Handfertigkeit und äußerliche
Geschicklichkeit in der Verwendung technischer Aus-
drucksmittel nicht verführen lassen, Dinge hervorzu-
bringen, die nur variierte Wiederholungen früherer
Aunstleistungen sind; er wird vielmehr darum be-
inüht sein müssen, sich den ihm wesensgemäßen
künstlerisch geformten Ausdruck zu erringen. Dazu
ist es erforderlich, daß er sich über Prinzipielles und
Gesetznräßiges klar sei.
In den meisten, auf diesen Blättern reprodu-
zierten Arbeiten der drei jungen Graphiker ist ein
Zuviel, Zuvielerlei, eine Häufung von — gewiß deko-
rativ an sich ganz wirksamen, in ihrer Verbindung
jedoch störenden — Einzelheiten. Wir sehen aber zu
allen Zeiten, freilich in verschiedenen Formen, daß
die größte Einfachheit angestrebt wurde, und daß
die Aünstler beflissen waren, die vorhandenen
Trennungsmittel schließlich auf das Mindestmaß
und den einfachsten Zusammenhang zu reduziere».
Übernimmt der bildende Aünstler, wie es in der
Regel geschieht, da die ganze Größe der uns be-
rückenden Meisterwerke ihren: Wesen nach unbekannt
ist, vorerst Teilbeträge, wird seine Arbeit stets einen
unfertigen meist unruhigen Eindruck machen, und
oft genug trotz einer sehr breit angewandten Wache
zersplittert und nicht einfach genug wirken. Wir
sehen beispielsweise, daß selbst mit den in: letzten
Jahrzehnt in der Münchener Malerei erstrebten, den
Italienern der Spätrenaissance entlehnten großen
Massenbewegungen nicht immer die erwarteten
Wirkungen zu erreichen sind, daß sich vielmehr mit
einem gleichzeitigen Ekel vor den jetzt schon zu oft
gesehenen Großflecken-Bestrebungen das widerwärtige
Gefühl von Unruhe verbindet. Die angestrebte
größere Ruhe in: Bild (hier im weiteren Sinn auch
die Zeichnung mitgemeint, die Bildwirkung versucht)
wird daher noch immer in Vereinfachung zu be-
stehen haben, die am ehesten durch die Vermeidung
zu vieler Einzelsormen erinöglicht wird. Durch sie
gewinnt der Aünstler am ehesten den Stil. Denn
in: linearen Stil wird die gegenständliche Forn: und
Linie auf das Wesentliche zurückgeführt. Da das
Wesen des Stils in der Verwertung der Form und
bestimmter Formen beruht, müssen die gegenständ-
lichen Formen zu den den: Stil entsprechenden Grund-
formen vereinfacht werden.
Stil ist in: eigentlichen Sinne Formsache, und er
hängt in seinen Ursprüngen mit der Architektur zu-
sammen. Die der Architektur angepaßten Forn:en
ergaben von selbst eine den Raumverhältnissen ent-
sprechende Vereinfachung; gleichviel ob es abstrakte
oder der Natur entlehnte Formen waren, mußten
sie sich den Bedingungen, die die Einfachheit oder
258