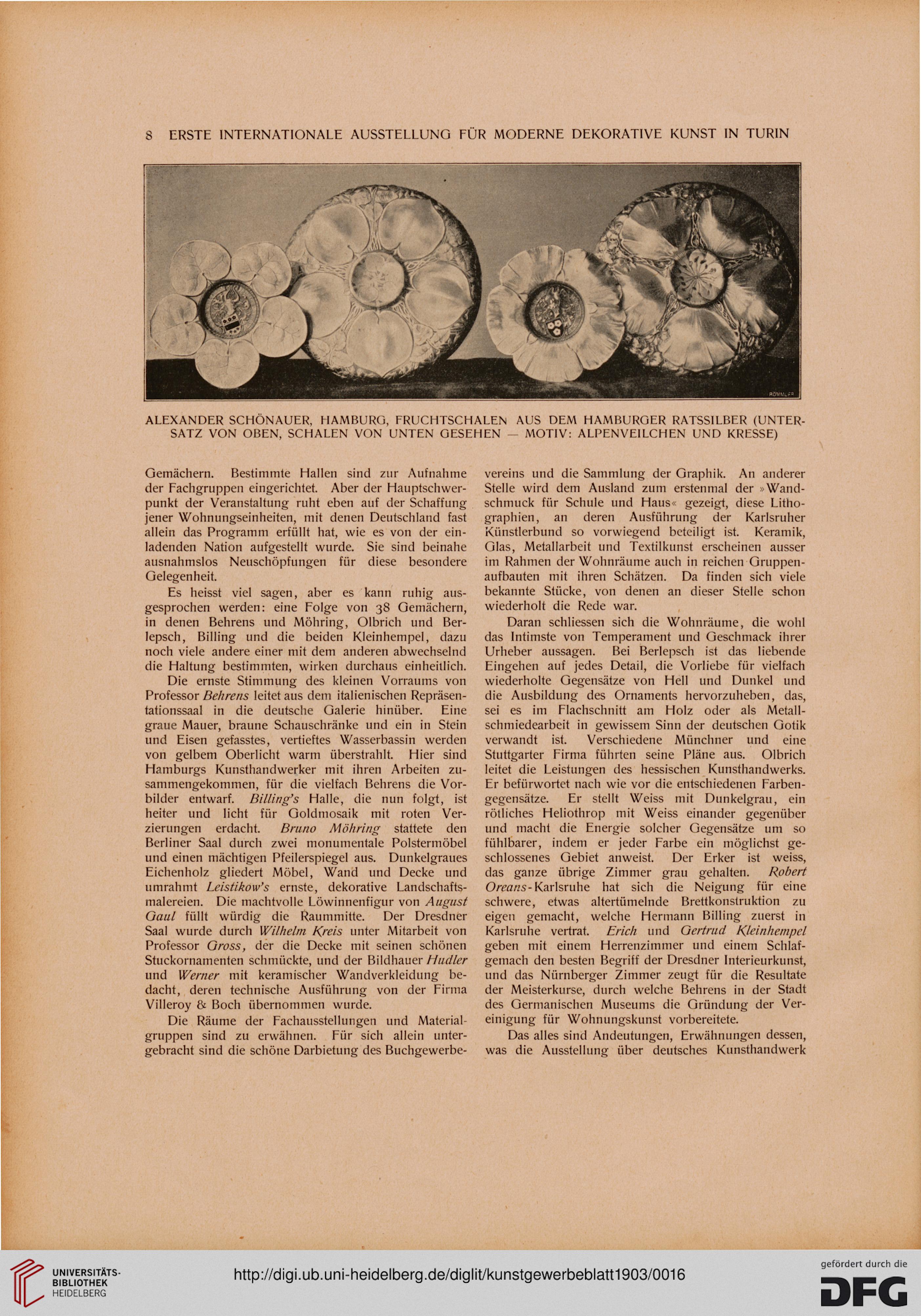S ERSTE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR MODERNE DEKORATIVE KUNST IN TURIN
ALEXANDER SCHÖNAUER, HAMBURG, FRUCHTSCHALEN AUS DEM HAMBURGER RATSSILBER (UNTER-
SATZ VON OBEN, SCHALEN VON UNTEN GESEHEN - MOTIV: ALPENVEILCHEN UND KRESSE)
Gemächern. Bestimmte Hallen sind zur Aufnahme
der Fachgruppen eingerichtet. Aber der Hauptschwer-
punkt der Veranstaltung ruht eben auf der Schaffung
jener Wohnungseinheiten, mit denen Deutschland fast
allein das Programm erfüllt hat, wie es von der ein-
ladenden Nation aufgestellt wurde. Sie sind beinahe
ausnahmslos Neuschöpfungen für diese besondere
Gelegenheit.
Es heisst viel sagen, aber es kann ruhig aus-
gesprochen werden: eine Folge von 38 Gemächern,
in denen Behrens und Möhring, Olbrich und Ber-
lepsch, Billing und die beiden Kleinhempel, dazu
noch viele andere einer mit dem anderen abwechselnd
die Haltung bestimmten, wirken durchaus einheitlich.
Die ernste Stimmung des kleinen Vorraums von
Professor Behrens leitet aus dem italienischen Repräsen-
tationssaal in die deutsche Galerie hinüber. Eine
graue Mauer, braune Schauschränke und ein in Stein
und Eisen gefasstes, vertieftes Wasserbassin werden
von gelbem Oberlicht warm überstrahlt. Hier sind
Hamburgs Kunsthandwerker mit ihren Arbeiten zu-
sammengekommen, für die vielfach Behrens die Vor-
bilder entwarf. Billing's Halle, die nun folgt, ist
heiter und licht für Goldmosaik mit roten Ver-
zierungen erdacht. Bruno Möhring stattete den
Berliner Saal durch zwei monumentale Polstermöbel
und einen mächtigen Pfeilerspiegel aus. Dunkelgraues
Eichenholz gliedert Möbel, Wand und Decke und
umrahmt Leistikow's ernste, dekorative Landschafts-
malereien. Die machtvolle Löwinnenfigur von August
Gaul füllt würdig die Raummitte. Der Dresdner
Saal wurde durch Wilhelm Kreis unter Mitarbeit von
Professor Gross, der die Decke mit seinen schönen
Stuckornamenten schmückte, und der Bildhauer Hudler
und Werner mit keramischer Wandverkleidung be-
dacht, deren technische Ausführung von der Firma
Villeroy & Boch übernommen wurde.
Die Räume der Fachausstellungen und Material-
gruppen sind zu erwähnen. Für sich allein unter-
gebracht sind die schöne Darbietung des Buchgewerbe-
vereins und die Sammlung der Graphik. An anderer
Stelle wird dem Ausland zum erstenmal der »Wand-
schmuck für Schule und Haus« gezeigt, diese Litho-
graphien, an deren Ausführung der Karlsruher
Künstlerbund so vorwiegend beteiligt ist. Keramik,
Glas, Metallarbeit und Textilkunst erscheinen ausser
im Rahmen der Wohnräume auch in reichen Gruppen-
aufbauten mit ihren Schätzen. Da finden sich viele
bekannte Stücke, von denen an dieser Stelle schon
wiederholt die Rede war.
Daran schliessen sich die Wohnräume, die wohl
das Intimste von Temperament und Geschmack ihrer
Urheber aussagen. Bei Berlepsch ist das liebende
Eingehen auf jedes Detail, die Vorliebe für vielfach
wiederholte Gegensätze von Hell und Dunkel und
die Ausbildung des Ornaments hervorzuheben, das,
sei es im Flachschnitt am Holz oder als Metall-
schmiedearbeit in gewissem Sinn der deutschen Gotik
verwandt ist. Verschiedene Münchner und eine
Stuttgarter Firma führten seine Pläne aus. Olbrich
leitet die Leistungen des hessischen Kunsthandwerks.
Er befürwortet nach wie vor die entschiedenen Farben-
gegensätze. Er stellt Weiss mit Dunkelgrau, ein
rötliches Heliothrop mit Weiss einander gegenüber
und macht die Energie solcher Gegensätze um so
fühlbarer, indem er jeder Farbe ein möglichst ge-
schlossenes Gebiet anweist. Der Erker ist weiss,
das ganze übrige Zimmer grau gehalten. Robert
Oreans- Karlsruhe hat sich die Neigung für eine
schwere, etwas altertümelnde Brettkonstruktion zu
eigen gemacht, welche Hermann Billing zuerst in
Karlsruhe vertrat. Erich und Gertrud Kleinhempel
geben mit einem Herrenzimmer und einem Schlaf-
gemach den besten Begriff der Dresdner Interieurkunst,
und das Nürnberger Zimmer zeugt für die Resultate
der Meisterkurse, durch welche Behrens in der Stadt
des Germanischen Museums die Gründung der Ver-
einigung für Wohnungskunst vorbereitete.
Das alles sind Andeutungen, Erwähnungen dessen,
was die Ausstellung über deutsches Kunsthandwerk
ALEXANDER SCHÖNAUER, HAMBURG, FRUCHTSCHALEN AUS DEM HAMBURGER RATSSILBER (UNTER-
SATZ VON OBEN, SCHALEN VON UNTEN GESEHEN - MOTIV: ALPENVEILCHEN UND KRESSE)
Gemächern. Bestimmte Hallen sind zur Aufnahme
der Fachgruppen eingerichtet. Aber der Hauptschwer-
punkt der Veranstaltung ruht eben auf der Schaffung
jener Wohnungseinheiten, mit denen Deutschland fast
allein das Programm erfüllt hat, wie es von der ein-
ladenden Nation aufgestellt wurde. Sie sind beinahe
ausnahmslos Neuschöpfungen für diese besondere
Gelegenheit.
Es heisst viel sagen, aber es kann ruhig aus-
gesprochen werden: eine Folge von 38 Gemächern,
in denen Behrens und Möhring, Olbrich und Ber-
lepsch, Billing und die beiden Kleinhempel, dazu
noch viele andere einer mit dem anderen abwechselnd
die Haltung bestimmten, wirken durchaus einheitlich.
Die ernste Stimmung des kleinen Vorraums von
Professor Behrens leitet aus dem italienischen Repräsen-
tationssaal in die deutsche Galerie hinüber. Eine
graue Mauer, braune Schauschränke und ein in Stein
und Eisen gefasstes, vertieftes Wasserbassin werden
von gelbem Oberlicht warm überstrahlt. Hier sind
Hamburgs Kunsthandwerker mit ihren Arbeiten zu-
sammengekommen, für die vielfach Behrens die Vor-
bilder entwarf. Billing's Halle, die nun folgt, ist
heiter und licht für Goldmosaik mit roten Ver-
zierungen erdacht. Bruno Möhring stattete den
Berliner Saal durch zwei monumentale Polstermöbel
und einen mächtigen Pfeilerspiegel aus. Dunkelgraues
Eichenholz gliedert Möbel, Wand und Decke und
umrahmt Leistikow's ernste, dekorative Landschafts-
malereien. Die machtvolle Löwinnenfigur von August
Gaul füllt würdig die Raummitte. Der Dresdner
Saal wurde durch Wilhelm Kreis unter Mitarbeit von
Professor Gross, der die Decke mit seinen schönen
Stuckornamenten schmückte, und der Bildhauer Hudler
und Werner mit keramischer Wandverkleidung be-
dacht, deren technische Ausführung von der Firma
Villeroy & Boch übernommen wurde.
Die Räume der Fachausstellungen und Material-
gruppen sind zu erwähnen. Für sich allein unter-
gebracht sind die schöne Darbietung des Buchgewerbe-
vereins und die Sammlung der Graphik. An anderer
Stelle wird dem Ausland zum erstenmal der »Wand-
schmuck für Schule und Haus« gezeigt, diese Litho-
graphien, an deren Ausführung der Karlsruher
Künstlerbund so vorwiegend beteiligt ist. Keramik,
Glas, Metallarbeit und Textilkunst erscheinen ausser
im Rahmen der Wohnräume auch in reichen Gruppen-
aufbauten mit ihren Schätzen. Da finden sich viele
bekannte Stücke, von denen an dieser Stelle schon
wiederholt die Rede war.
Daran schliessen sich die Wohnräume, die wohl
das Intimste von Temperament und Geschmack ihrer
Urheber aussagen. Bei Berlepsch ist das liebende
Eingehen auf jedes Detail, die Vorliebe für vielfach
wiederholte Gegensätze von Hell und Dunkel und
die Ausbildung des Ornaments hervorzuheben, das,
sei es im Flachschnitt am Holz oder als Metall-
schmiedearbeit in gewissem Sinn der deutschen Gotik
verwandt ist. Verschiedene Münchner und eine
Stuttgarter Firma führten seine Pläne aus. Olbrich
leitet die Leistungen des hessischen Kunsthandwerks.
Er befürwortet nach wie vor die entschiedenen Farben-
gegensätze. Er stellt Weiss mit Dunkelgrau, ein
rötliches Heliothrop mit Weiss einander gegenüber
und macht die Energie solcher Gegensätze um so
fühlbarer, indem er jeder Farbe ein möglichst ge-
schlossenes Gebiet anweist. Der Erker ist weiss,
das ganze übrige Zimmer grau gehalten. Robert
Oreans- Karlsruhe hat sich die Neigung für eine
schwere, etwas altertümelnde Brettkonstruktion zu
eigen gemacht, welche Hermann Billing zuerst in
Karlsruhe vertrat. Erich und Gertrud Kleinhempel
geben mit einem Herrenzimmer und einem Schlaf-
gemach den besten Begriff der Dresdner Interieurkunst,
und das Nürnberger Zimmer zeugt für die Resultate
der Meisterkurse, durch welche Behrens in der Stadt
des Germanischen Museums die Gründung der Ver-
einigung für Wohnungskunst vorbereitete.
Das alles sind Andeutungen, Erwähnungen dessen,
was die Ausstellung über deutsches Kunsthandwerk