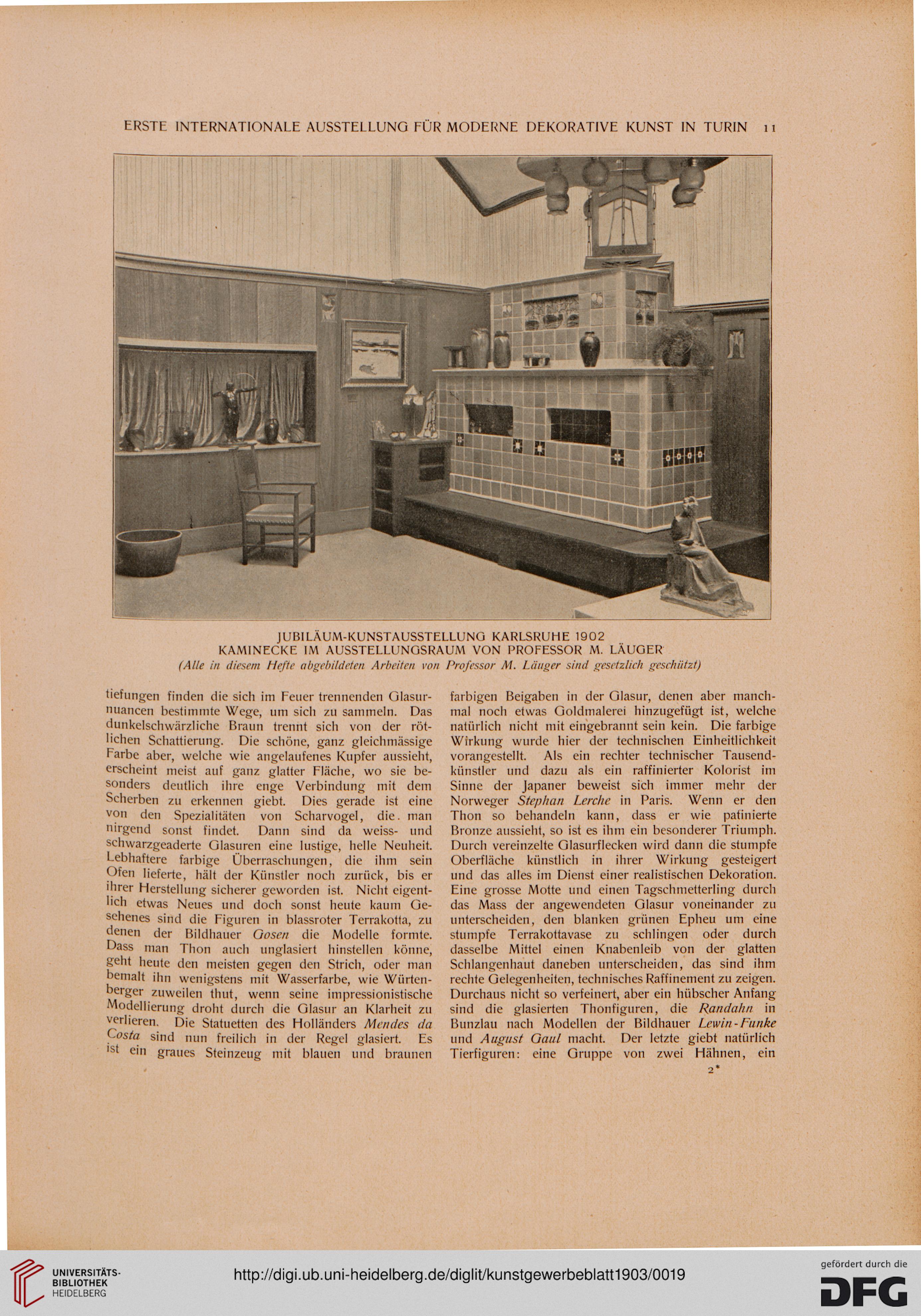ERSTE INTERNATIONALE AUSSTELLUNG FÜR MODERNE DEKORATIVE KUNST IN TURIN 11
JUBILÄUM-KUNSTAUSSTELLUNO KARLSRUHE 1902
KAMINECKE IM AUSSTELLUNGSRAUM VON PROFESSOR M. LÄUGER
(Alle in diesem ließe abgebildeten Arbeiten von Professor M. Länger sind gesetzlich geschützt)
tiefungen finden die sich im Feuer trennenden Glasur-
iiuancen bestimmte Wege, um sich zu sammeln. Das
dunkelschwärzliche Braun trennt sich von der röt-
lichen Schattierung. Die schöne, ganz gleichmässige
Farbe aber, welche wie angelaufenes Kupfer aussieht,
erscheint meist auf ganz glatter Fläche, wo sie be-
sonders deutlich ihre enge Verbindung mit dem
Scherben zu erkennen giebt. Dies gerade ist eine
von den Spezialitäten von Scharvogel, die. man
»irgend sonst findet. Dann sind da weiss- und
schwarzgeaderte Glasuren eine lustige, helle Neuheit.
Lebhaftere farbige Überraschungen, die ihm sein
Ofen lieferte, hält der Künstler noch zurück, bis er
ihrer Herstellung sicherer geworden ist. Nicht eigent-
lich etwas Neues und doch sonst heute kaum Ge-
sehenes sind die Figuren in blassroter Terrakotta, zu
denen der Bildhauer Qoscn die Modelle formte.
Dass man Thon auch unglasiert hinstellen könne,
geht heute den meisten gegen den Strich, oder man
bemalt ihn wenigstens mit Wasserfarbe, wie Würten-
berger zuweilen thut, wenn seine impressionistische
Modellierung droht durch die Glasur an Klarheit zu
verlieren. Die Statuetten des Holländers Mendes da
Costa sind nun freilich in der Regel glasiert. Es
■st ein graues Steinzeug mit blauen und braunen
künstler und dazu
Sinne der Japaner
Norweger Stephan
farbigen Beigaben in der Glasur, denen aber manch-
mal noch etwas Goldmalerei hinzugefügt ist, welche
natürlich nicht mit eingebrannt sein kein. Die farbige
Wirkung wurde hier der technischen Einheitlichkeit
vorangestellt. Als ein rechter technischer Tausend-
als ein raffinierter Kolorist im
beweist sich immer mehr der
Lerche in Paris. Wenn er den
Thon so behandeln kann, dass er wie patinierte
Bronze aussieht, so ist es ihm ein besonderer Triumph.
Durch vereinzelte Glasurflecken wird dann die stumpfe
Oberfläche künstlich in ihrer Wirkung gesteigert
und das alles im Dienst einer realistischen Dekoration.
Eine grosse Motte und einen Tagschmetterling durch
das Mass der angewendeten Glasur voneinander zu
unterscheiden, den blanken grünen Epheu um eine
stumpfe Terrakottavase zu schlingen oder durch
dasselbe Mittel einen Knabenleib von der glatten
Schlangenhaut daneben unterscheiden, das sind ihm
rechte Gelegenheiten, technisches Raffinement zu zeigen.
Durchaus nicht so verfeinert, aber ein hübscher Anfang
sind die glasierten Thonfiguren, die Randahn in
Bunzlau nach Modellen der Bildhauer Lewin-Funke
und August Oaul macht. Der letzte giebt natürlich
Tierfiguren: eine Gruppe von zwei Hähnen, ein
JUBILÄUM-KUNSTAUSSTELLUNO KARLSRUHE 1902
KAMINECKE IM AUSSTELLUNGSRAUM VON PROFESSOR M. LÄUGER
(Alle in diesem ließe abgebildeten Arbeiten von Professor M. Länger sind gesetzlich geschützt)
tiefungen finden die sich im Feuer trennenden Glasur-
iiuancen bestimmte Wege, um sich zu sammeln. Das
dunkelschwärzliche Braun trennt sich von der röt-
lichen Schattierung. Die schöne, ganz gleichmässige
Farbe aber, welche wie angelaufenes Kupfer aussieht,
erscheint meist auf ganz glatter Fläche, wo sie be-
sonders deutlich ihre enge Verbindung mit dem
Scherben zu erkennen giebt. Dies gerade ist eine
von den Spezialitäten von Scharvogel, die. man
»irgend sonst findet. Dann sind da weiss- und
schwarzgeaderte Glasuren eine lustige, helle Neuheit.
Lebhaftere farbige Überraschungen, die ihm sein
Ofen lieferte, hält der Künstler noch zurück, bis er
ihrer Herstellung sicherer geworden ist. Nicht eigent-
lich etwas Neues und doch sonst heute kaum Ge-
sehenes sind die Figuren in blassroter Terrakotta, zu
denen der Bildhauer Qoscn die Modelle formte.
Dass man Thon auch unglasiert hinstellen könne,
geht heute den meisten gegen den Strich, oder man
bemalt ihn wenigstens mit Wasserfarbe, wie Würten-
berger zuweilen thut, wenn seine impressionistische
Modellierung droht durch die Glasur an Klarheit zu
verlieren. Die Statuetten des Holländers Mendes da
Costa sind nun freilich in der Regel glasiert. Es
■st ein graues Steinzeug mit blauen und braunen
künstler und dazu
Sinne der Japaner
Norweger Stephan
farbigen Beigaben in der Glasur, denen aber manch-
mal noch etwas Goldmalerei hinzugefügt ist, welche
natürlich nicht mit eingebrannt sein kein. Die farbige
Wirkung wurde hier der technischen Einheitlichkeit
vorangestellt. Als ein rechter technischer Tausend-
als ein raffinierter Kolorist im
beweist sich immer mehr der
Lerche in Paris. Wenn er den
Thon so behandeln kann, dass er wie patinierte
Bronze aussieht, so ist es ihm ein besonderer Triumph.
Durch vereinzelte Glasurflecken wird dann die stumpfe
Oberfläche künstlich in ihrer Wirkung gesteigert
und das alles im Dienst einer realistischen Dekoration.
Eine grosse Motte und einen Tagschmetterling durch
das Mass der angewendeten Glasur voneinander zu
unterscheiden, den blanken grünen Epheu um eine
stumpfe Terrakottavase zu schlingen oder durch
dasselbe Mittel einen Knabenleib von der glatten
Schlangenhaut daneben unterscheiden, das sind ihm
rechte Gelegenheiten, technisches Raffinement zu zeigen.
Durchaus nicht so verfeinert, aber ein hübscher Anfang
sind die glasierten Thonfiguren, die Randahn in
Bunzlau nach Modellen der Bildhauer Lewin-Funke
und August Oaul macht. Der letzte giebt natürlich
Tierfiguren: eine Gruppe von zwei Hähnen, ein