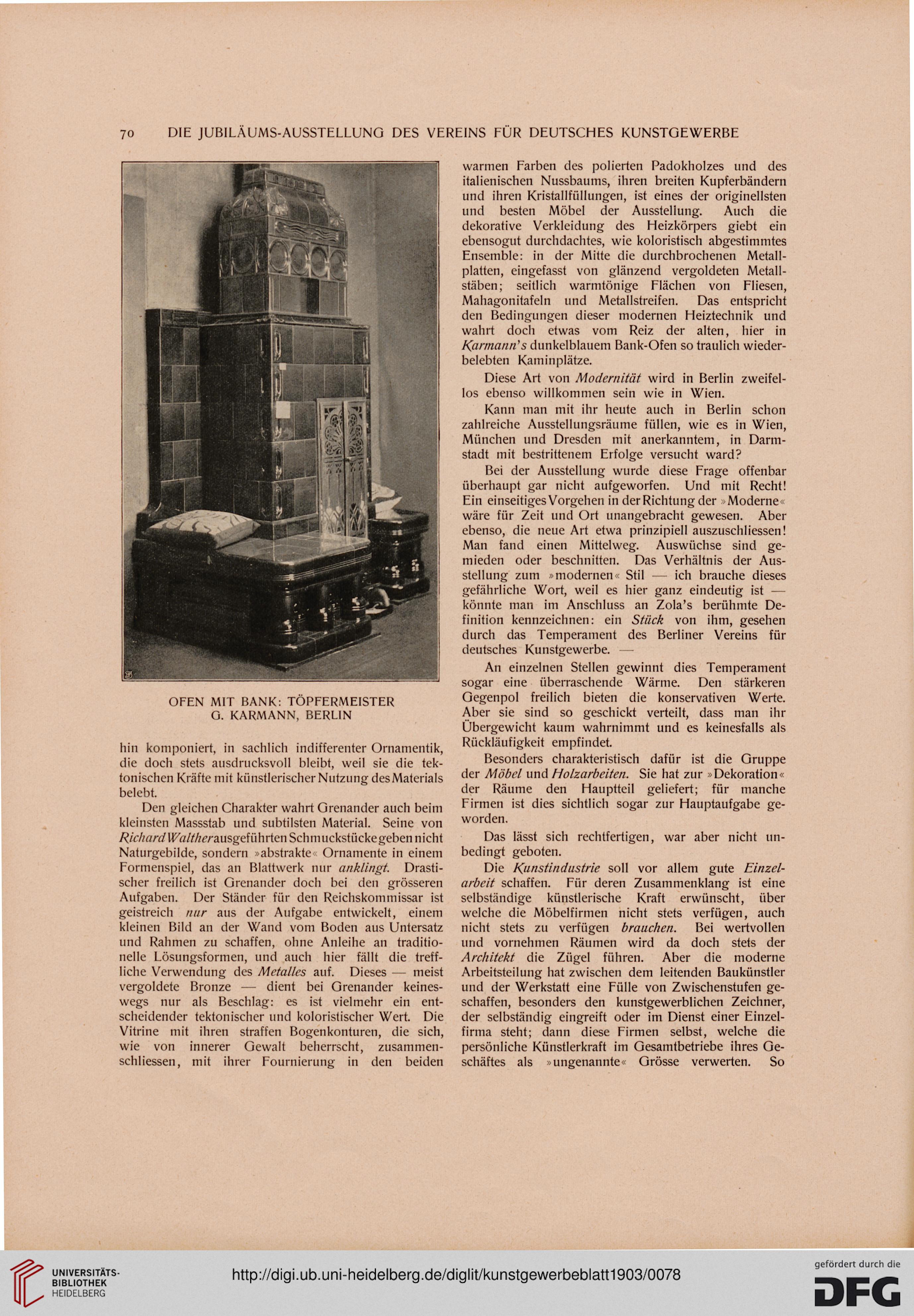70
DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE
OFEN MIT BANK: TOPFERMEISTER
G. KARMANN, BERLIN
hin komponiert, in sachlich indifferenter Ornamentik,
die doch stets ausdrucksvoll bleibt, weil sie die tek-
tonischen Kräfte mit künstlerischer Nutzung des Materials
belebt.
Den gleichen Charakter wahrt Grenander auch beim
kleinsten Massstab und subtilsten Material. Seine von
Richard Waltherausgdührten Schmuckstückegeben nicht
Naturgebilde, sondern »abstrakte Ornamente in einem
Formenspiel, das an Blattwerk nur anklingt Drasti-
scher freilich ist Grenander doch bei den grösseren
Aufgaben. Der Ständer für den Reichskommissar ist
geistreich nur aus der Aufgabe entwickelt, einem
kleinen Bild an der Wand vom Boden aus Untersatz
und Rahmen zu schaffen, ohne Anleihe an traditio-
nelle Lösungsformen, und auch hier fällt die treff-
liche Verwendung des Metalles auf. Dieses — meist
vergoldete Bronze — dient bei Grenander keines-
wegs nur als Beschlag: es ist vielmehr ein ent-
scheidender tektonischer und koloristischer Wert. Die
Vitrine mit ihren straffen Bogenkonturen, die sich,
wie von innerer Gewalt beherrscht, zusammen-
schliessen, mit ihrer Fournierung in den beiden
warmen Farben des polierten Padokholzes und des
italienischen Nussbaums, ihren breiten Kupferbändern
und ihren Kristallfüllungen, ist eines der originellsten
und besten Möbel der Ausstellung. Auch die
dekorative Verkleidung des Heizkörpers giebt ein
ebensogut durchdachtes, wie koloristisch abgestimmtes
Ensemble: in der Mitte die durchbrochenen Metall-
platten, eingefasst von glänzend vergoldeten Metall-
stäben; seitlich warmtönige Flächen von Fliesen,
Mahagonitafeln und Metallstreifen. Das entspricht
den Bedingungen dieser modernen Heiztechnik und
wahrt doch etwas vom Reiz der alten, hier in
Karmann's dunkelblauem Bank-Ofen so traulich wieder-
belebten Kaminplätze.
Diese Art von Modernität wird in Berlin zweifel-
los ebenso willkommen sein wie in Wien.
Kann man mit ihr heute auch in Berlin schon
zahlreiche Ausstellungsräume füllen, wie es in Wien,
München und Dresden mit anerkanntem, in Darm-
stadt mit bestrittenem Erfolge versucht ward?
Bei der Ausstellung wurde diese Frage offenbar
überhaupt gar nicht aufgeworfen. Und mit Recht!
Ein einseitiges Vorgehen in der Richtung der Moderne*
wäre für Zeit und Ort unangebracht gewesen. Aber
ebenso, die neue Art etwa prinzipiell auszuschliessen!
Man fand einen Mittelweg. Auswüchse sind ge-
mieden oder beschnitten. Das Verhältnis der Aus-
stellung zum »modernen« Stil — ich brauche dieses
gefährliche Wort, weil es hier ganz eindeutig ist —
könnte man im Anschluss an Zola's berühmte De-
finition kennzeichnen: ein Stück von ihm, gesehen
durch das Temperament des Berliner Vereins für
deutsches Kunstgewerbe. —
An einzelnen Stellen gewinnt dies Temperament
sogar eine überraschende Wärme. Den stärkeren
Gegenpol freilich bieten die konservativen Werte.
Aber sie sind so geschickt verteilt, dass man ihr
Übergewicht kaum wahrnimmt und es keinesfalls als
Rückläufigkeit empfindet.
Besonders charakteristisch dafür ist die Gruppe
der Möbel und Holzarbeiten. Sie hat zur »Dekoration«
der Räume den Hauptteil geliefert; für manche
Firmen ist dies sichtlich sogar zur Hauptaufgabe ge-
worden.
Das Iässt sich rechtfertigen, war aber nicht un-
bedingt geboten.
Die Kunstindustrie soll vor allem gute Einzel-
arbeit schaffen. Für deren Zusammenklang ist eine
selbständige künstlerische Kraft erwünscht, über
welche die Möbelfirmen nicht stets verfügen, auch
nicht stets zu verfügen brauchen. Bei wertvollen
und vornehmen Räumen wird da doch stets der
Architekt die Zügel führen. Aber die moderne
Arbeitsteilung hat zwischen dem leitenden Baukünstler
und der Werkstatt eine Fülle von Zwischenstufen ge-
schaffen, besonders den kunstgewerblichen Zeichner,
der selbständig eingreift oder im Dienst einer Einzel-
firma steht; dann diese Firmen selbst, welche die
persönliche Künstlerkraft im Gesamtbetriebe ihres Ge-
schäftes als »ungenannte« Grösse verwerten. So
DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE
OFEN MIT BANK: TOPFERMEISTER
G. KARMANN, BERLIN
hin komponiert, in sachlich indifferenter Ornamentik,
die doch stets ausdrucksvoll bleibt, weil sie die tek-
tonischen Kräfte mit künstlerischer Nutzung des Materials
belebt.
Den gleichen Charakter wahrt Grenander auch beim
kleinsten Massstab und subtilsten Material. Seine von
Richard Waltherausgdührten Schmuckstückegeben nicht
Naturgebilde, sondern »abstrakte Ornamente in einem
Formenspiel, das an Blattwerk nur anklingt Drasti-
scher freilich ist Grenander doch bei den grösseren
Aufgaben. Der Ständer für den Reichskommissar ist
geistreich nur aus der Aufgabe entwickelt, einem
kleinen Bild an der Wand vom Boden aus Untersatz
und Rahmen zu schaffen, ohne Anleihe an traditio-
nelle Lösungsformen, und auch hier fällt die treff-
liche Verwendung des Metalles auf. Dieses — meist
vergoldete Bronze — dient bei Grenander keines-
wegs nur als Beschlag: es ist vielmehr ein ent-
scheidender tektonischer und koloristischer Wert. Die
Vitrine mit ihren straffen Bogenkonturen, die sich,
wie von innerer Gewalt beherrscht, zusammen-
schliessen, mit ihrer Fournierung in den beiden
warmen Farben des polierten Padokholzes und des
italienischen Nussbaums, ihren breiten Kupferbändern
und ihren Kristallfüllungen, ist eines der originellsten
und besten Möbel der Ausstellung. Auch die
dekorative Verkleidung des Heizkörpers giebt ein
ebensogut durchdachtes, wie koloristisch abgestimmtes
Ensemble: in der Mitte die durchbrochenen Metall-
platten, eingefasst von glänzend vergoldeten Metall-
stäben; seitlich warmtönige Flächen von Fliesen,
Mahagonitafeln und Metallstreifen. Das entspricht
den Bedingungen dieser modernen Heiztechnik und
wahrt doch etwas vom Reiz der alten, hier in
Karmann's dunkelblauem Bank-Ofen so traulich wieder-
belebten Kaminplätze.
Diese Art von Modernität wird in Berlin zweifel-
los ebenso willkommen sein wie in Wien.
Kann man mit ihr heute auch in Berlin schon
zahlreiche Ausstellungsräume füllen, wie es in Wien,
München und Dresden mit anerkanntem, in Darm-
stadt mit bestrittenem Erfolge versucht ward?
Bei der Ausstellung wurde diese Frage offenbar
überhaupt gar nicht aufgeworfen. Und mit Recht!
Ein einseitiges Vorgehen in der Richtung der Moderne*
wäre für Zeit und Ort unangebracht gewesen. Aber
ebenso, die neue Art etwa prinzipiell auszuschliessen!
Man fand einen Mittelweg. Auswüchse sind ge-
mieden oder beschnitten. Das Verhältnis der Aus-
stellung zum »modernen« Stil — ich brauche dieses
gefährliche Wort, weil es hier ganz eindeutig ist —
könnte man im Anschluss an Zola's berühmte De-
finition kennzeichnen: ein Stück von ihm, gesehen
durch das Temperament des Berliner Vereins für
deutsches Kunstgewerbe. —
An einzelnen Stellen gewinnt dies Temperament
sogar eine überraschende Wärme. Den stärkeren
Gegenpol freilich bieten die konservativen Werte.
Aber sie sind so geschickt verteilt, dass man ihr
Übergewicht kaum wahrnimmt und es keinesfalls als
Rückläufigkeit empfindet.
Besonders charakteristisch dafür ist die Gruppe
der Möbel und Holzarbeiten. Sie hat zur »Dekoration«
der Räume den Hauptteil geliefert; für manche
Firmen ist dies sichtlich sogar zur Hauptaufgabe ge-
worden.
Das Iässt sich rechtfertigen, war aber nicht un-
bedingt geboten.
Die Kunstindustrie soll vor allem gute Einzel-
arbeit schaffen. Für deren Zusammenklang ist eine
selbständige künstlerische Kraft erwünscht, über
welche die Möbelfirmen nicht stets verfügen, auch
nicht stets zu verfügen brauchen. Bei wertvollen
und vornehmen Räumen wird da doch stets der
Architekt die Zügel führen. Aber die moderne
Arbeitsteilung hat zwischen dem leitenden Baukünstler
und der Werkstatt eine Fülle von Zwischenstufen ge-
schaffen, besonders den kunstgewerblichen Zeichner,
der selbständig eingreift oder im Dienst einer Einzel-
firma steht; dann diese Firmen selbst, welche die
persönliche Künstlerkraft im Gesamtbetriebe ihres Ge-
schäftes als »ungenannte« Grösse verwerten. So