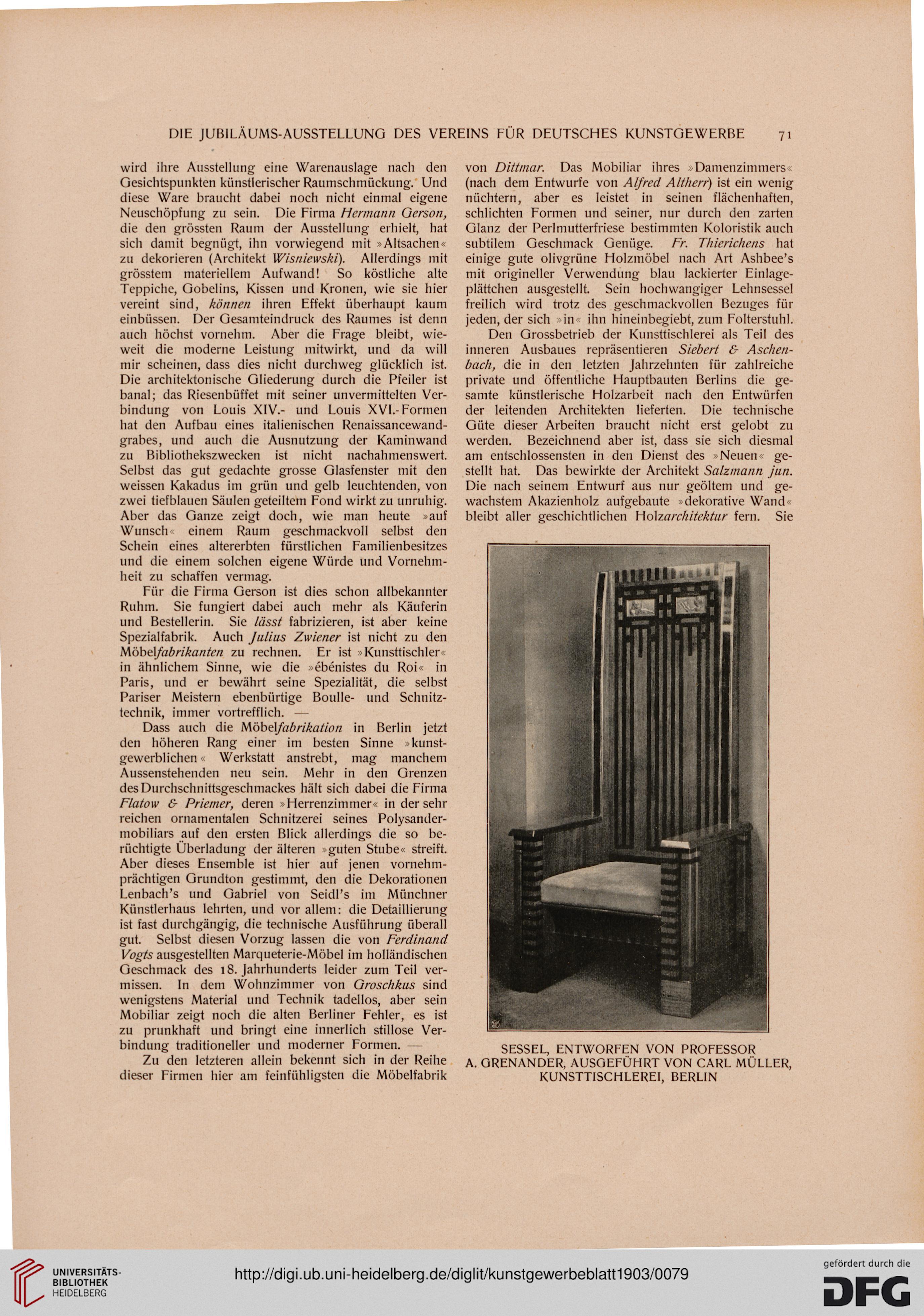DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE 71
wird ihre Ausstellung eine Warenauslage nach den
Gesichtspunkten künstlerischer Raumschmückung. Und
diese Ware braucht dabei noch nicht einmal eigene
Neuschöpfung zu sein. Die Firma Hermann Gerson,
die den grössten Raum der Ausstellung erhielt, hat
sich damit begnügt, ihn vorwiegend mit »Altsachen«
zu dekorieren (Architekt Wisniewski). Allerdings mit
grösstem materiellem Aufwand! So köstliche alte
Teppiche, Gobelins, Kissen und Kronen, wie sie hier
vereint sind, können ihren Effekt überhaupt kaum
einbüssen. Der Gesamteindruck des Raumes ist denn
auch höchst vornehm. Aber die Frage bleibt, wie-
weit die moderne Leistung mitwirkt, und da will
mir scheinen, dass dies nicht durchweg glücklich ist.
Die architektonische Gliederung durch die Pfeiler ist
banal; das Riesenbüffet mit seiner unvermittelten Ver-
bindung von Louis XIV.- und Louis XVI.-Formen
hat den Aufbau eines italienischen Renaissancewand-
grabes, und auch die Ausnutzung der Kaminwand
zu Bibliothekszwecken ist nicht nachahmenswert.
Selbst das gut gedachte grosse Glasfenster mit den
weissen Kakadus im grün und gelb leuchtenden, von
zwei tiefblauen Säulen geteiltem Fond wirkt zu unruhig.
Aber das Ganze zeigt doch, wie man heute »auf
Wunsch einem Raum geschmackvoll selbst den
Schein eines altererbten fürstlichen Familienbesitzes
und die einem solchen eigene Würde und Vornehm-
heit zu schaffen vermag.
Für die Firma Gerson ist dies schon allbekannter
Ruhm. Sie fungiert dabei auch mehr als Käuferin
und Bestellerin. Sie lässt fabrizieren, ist aber keine
Spezialfabrik. Auch Julius Zwiener ist nicht zu den
Möbe\fabrikanten zu rechnen. Er ist »Kunsttischler«
in ähnlichem Sinne, wie die
Paris, und er bewährt seine
Pariser Meistern ebenbürtige
technik, immer vortrefflich. —
Dass auch die Möbetfabrikation in Berlin jetzt
den höheren Rang einer im besten Sinne kunst-
gewerblichen Werkstatt anstrebt, mag manchem
Aussenstehenden neu sein. Mehr in den Grenzen
des Durchschnittsgeschmackes hält sich dabei die Firma
Flatow & Priemer, deren »Herrenzimmer« in der sehr
reichen ornamentalen Schnitzerei seines Polysander-
mobiliars auf den ersten Blick allerdings die so be-
rüchtigte Überladung der älteren »guten Stube« streift.
Aber dieses Ensemble ist hier auf jenen vornehm-
prächtigen Grundton gestimmt, den die Dekorationen
Lenbach's und Gabriel von Seidl's im Münchner
Künstlerhaus lehrten, und vor allem: die Detaillierung
ist fast durchgängig, die technische Ausführung überall
gut. Selbst diesen Vorzug lassen die von Ferdinand
Vogts ausgestellten Marqueterie-Möbel im holländischen
Geschmack des 18. Jahrhunderts leider zum Teil ver-
missen. In dem Wohnzimmer von Groschkus sind
wenigstens Material und Technik tadellos, aber sein
Mobiliar zeigt noch die alten Berliner Fehler, es ist
zu prunkhaft und bringt eine innerlich stillose Ver-
bindung traditioneller und moderner Formen.
Zu den letzteren allein bekennt sich in der Reihe
dieser Firmen hier am feinfühligsten die Möbelfabrik
ebenistes du Roi« in
Spezialität, die selbst
Boulle- und Schnitz-
von Dittmar. Das Mobiliar ihres Damenzimmers
(nach dem Entwürfe von Alfred Altherr) ist ein wenig
nüchtern, aber es leistet in seinen flächenhaften,
schlichten Formen und seiner, nur durch den zarten
Glanz der Perlmutterfriese bestimmten Koloristik auch
subtilem Geschmack Genüge. Fr. Thierichens hat
einige gute olivgrüne Holzmöbel nach Art Ashbee's
mit origineller Verwendung blau lackierter Einlage-
plättchen ausgestellt. Sein hochwangiger Lehnsessel
freilich wird trotz des geschmackvollen Bezuges für
jeden, der sich in ihn hineinbegiebt, zum Folterstuhl.
Den Grossbetrieb der Kunsttischlerei als Teil des
inneren Ausbaues repräsentieren Siebert & Aschen-
bach, die in den letzten Jahrzehnten für zahlreiche
private und öffentliche Hauptbauten Berlins die ge-
samte künstlerische Holzarbeit nach den Entwürfen
der leitenden Architekten lieferten. Die technische
Güte dieser Arbeiten braucht nicht erst gelobt zu
werden. Bezeichnend aber ist, dass sie sich diesmal
am entschlossensten in den Dienst des »Neuen« ge-
stellt hat. Das bewirkte der Architekt Salzmann jun.
Die nach seinem Entwurf aus nur geöltem und ge-
wachstem Akazienholz aufgebaute »dekorative Wand<
bleibt aller geschichtlichen Ho\zarchitektur fern. Sie
SESSEL, ENTWORFEN VON PROFESSOR
A. GRENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,
KUNSTTISCHLEREI, BERLIN
wird ihre Ausstellung eine Warenauslage nach den
Gesichtspunkten künstlerischer Raumschmückung. Und
diese Ware braucht dabei noch nicht einmal eigene
Neuschöpfung zu sein. Die Firma Hermann Gerson,
die den grössten Raum der Ausstellung erhielt, hat
sich damit begnügt, ihn vorwiegend mit »Altsachen«
zu dekorieren (Architekt Wisniewski). Allerdings mit
grösstem materiellem Aufwand! So köstliche alte
Teppiche, Gobelins, Kissen und Kronen, wie sie hier
vereint sind, können ihren Effekt überhaupt kaum
einbüssen. Der Gesamteindruck des Raumes ist denn
auch höchst vornehm. Aber die Frage bleibt, wie-
weit die moderne Leistung mitwirkt, und da will
mir scheinen, dass dies nicht durchweg glücklich ist.
Die architektonische Gliederung durch die Pfeiler ist
banal; das Riesenbüffet mit seiner unvermittelten Ver-
bindung von Louis XIV.- und Louis XVI.-Formen
hat den Aufbau eines italienischen Renaissancewand-
grabes, und auch die Ausnutzung der Kaminwand
zu Bibliothekszwecken ist nicht nachahmenswert.
Selbst das gut gedachte grosse Glasfenster mit den
weissen Kakadus im grün und gelb leuchtenden, von
zwei tiefblauen Säulen geteiltem Fond wirkt zu unruhig.
Aber das Ganze zeigt doch, wie man heute »auf
Wunsch einem Raum geschmackvoll selbst den
Schein eines altererbten fürstlichen Familienbesitzes
und die einem solchen eigene Würde und Vornehm-
heit zu schaffen vermag.
Für die Firma Gerson ist dies schon allbekannter
Ruhm. Sie fungiert dabei auch mehr als Käuferin
und Bestellerin. Sie lässt fabrizieren, ist aber keine
Spezialfabrik. Auch Julius Zwiener ist nicht zu den
Möbe\fabrikanten zu rechnen. Er ist »Kunsttischler«
in ähnlichem Sinne, wie die
Paris, und er bewährt seine
Pariser Meistern ebenbürtige
technik, immer vortrefflich. —
Dass auch die Möbetfabrikation in Berlin jetzt
den höheren Rang einer im besten Sinne kunst-
gewerblichen Werkstatt anstrebt, mag manchem
Aussenstehenden neu sein. Mehr in den Grenzen
des Durchschnittsgeschmackes hält sich dabei die Firma
Flatow & Priemer, deren »Herrenzimmer« in der sehr
reichen ornamentalen Schnitzerei seines Polysander-
mobiliars auf den ersten Blick allerdings die so be-
rüchtigte Überladung der älteren »guten Stube« streift.
Aber dieses Ensemble ist hier auf jenen vornehm-
prächtigen Grundton gestimmt, den die Dekorationen
Lenbach's und Gabriel von Seidl's im Münchner
Künstlerhaus lehrten, und vor allem: die Detaillierung
ist fast durchgängig, die technische Ausführung überall
gut. Selbst diesen Vorzug lassen die von Ferdinand
Vogts ausgestellten Marqueterie-Möbel im holländischen
Geschmack des 18. Jahrhunderts leider zum Teil ver-
missen. In dem Wohnzimmer von Groschkus sind
wenigstens Material und Technik tadellos, aber sein
Mobiliar zeigt noch die alten Berliner Fehler, es ist
zu prunkhaft und bringt eine innerlich stillose Ver-
bindung traditioneller und moderner Formen.
Zu den letzteren allein bekennt sich in der Reihe
dieser Firmen hier am feinfühligsten die Möbelfabrik
ebenistes du Roi« in
Spezialität, die selbst
Boulle- und Schnitz-
von Dittmar. Das Mobiliar ihres Damenzimmers
(nach dem Entwürfe von Alfred Altherr) ist ein wenig
nüchtern, aber es leistet in seinen flächenhaften,
schlichten Formen und seiner, nur durch den zarten
Glanz der Perlmutterfriese bestimmten Koloristik auch
subtilem Geschmack Genüge. Fr. Thierichens hat
einige gute olivgrüne Holzmöbel nach Art Ashbee's
mit origineller Verwendung blau lackierter Einlage-
plättchen ausgestellt. Sein hochwangiger Lehnsessel
freilich wird trotz des geschmackvollen Bezuges für
jeden, der sich in ihn hineinbegiebt, zum Folterstuhl.
Den Grossbetrieb der Kunsttischlerei als Teil des
inneren Ausbaues repräsentieren Siebert & Aschen-
bach, die in den letzten Jahrzehnten für zahlreiche
private und öffentliche Hauptbauten Berlins die ge-
samte künstlerische Holzarbeit nach den Entwürfen
der leitenden Architekten lieferten. Die technische
Güte dieser Arbeiten braucht nicht erst gelobt zu
werden. Bezeichnend aber ist, dass sie sich diesmal
am entschlossensten in den Dienst des »Neuen« ge-
stellt hat. Das bewirkte der Architekt Salzmann jun.
Die nach seinem Entwurf aus nur geöltem und ge-
wachstem Akazienholz aufgebaute »dekorative Wand<
bleibt aller geschichtlichen Ho\zarchitektur fern. Sie
SESSEL, ENTWORFEN VON PROFESSOR
A. GRENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,
KUNSTTISCHLEREI, BERLIN