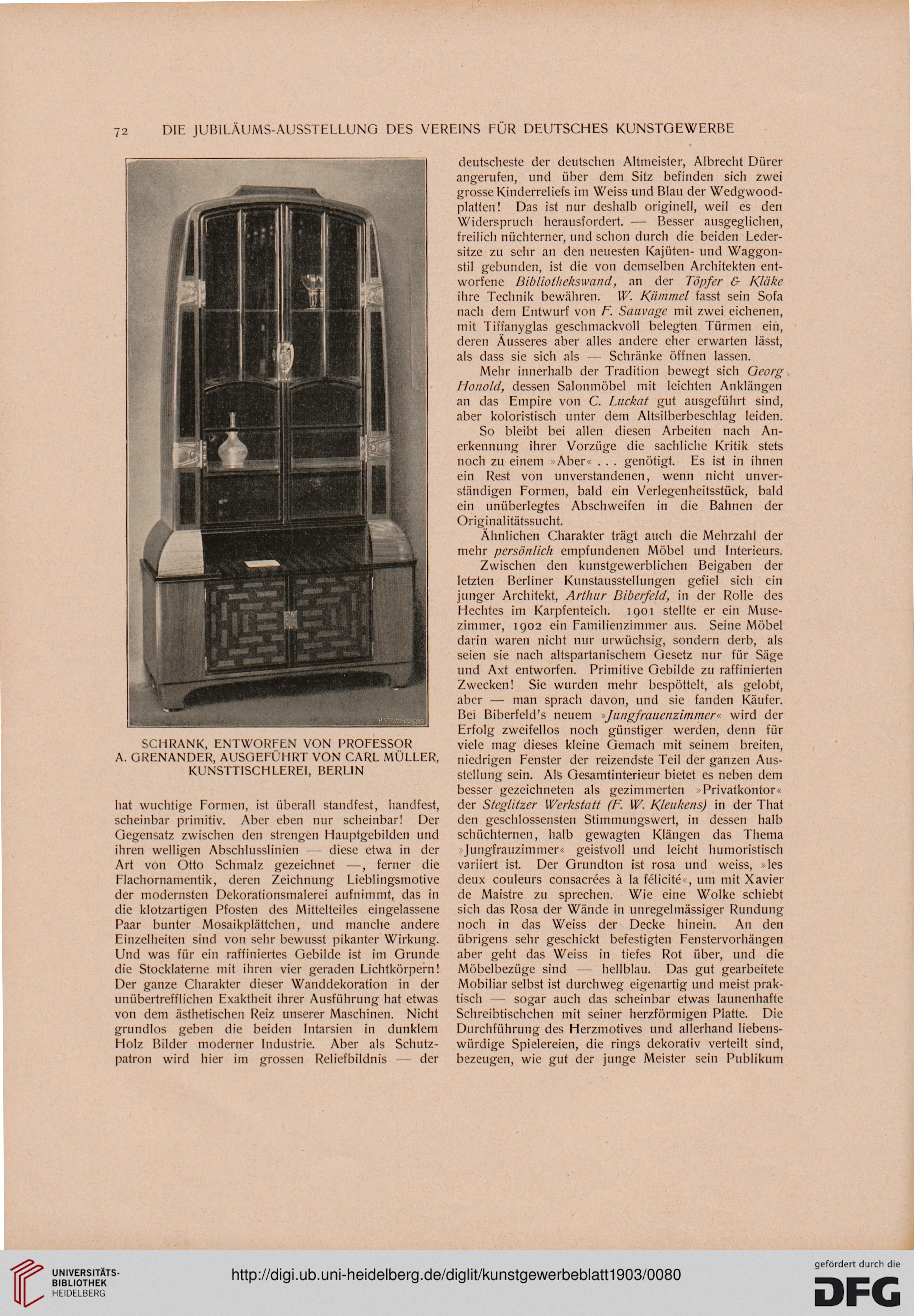72 DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE
SCHRANK, ENTWORFEN VON PROFESSOR
A. ORENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,
KUNSTTISCHLEREI, BERLIN
hat wuchtige Formen, ist überall standfest, handfest,
scheinbar primitiv. Aber eben nur scheinbar! Der
Gegensatz zwischen den strengen Hauptgebilden und
ihren welligen Abschlusslinien diese etwa in der
Art von Otto Schmalz gezeichnet —, ferner die
Flachornamentik, deren Zeichnung Lieblingsmotive
der modernsten Dekorationsmalerei aufnimmt, das in
die klotzartigen Pfosten des Mittelteiles eingelassene
Paar bunter Mosaikplättchen, und manche andere
Einzelheiten sind von sehr bewusst pikanter Wirkung.
Und was für ein raffiniertes Gebilde ist im Grunde
die Stocklaterne mit ihren vier geraden Lichtkörpern!
Der ganze Charakter dieser Wanddekoration in der
unübertrefflichen Exaktheit ihrer Ausführung hat etwas
von dem ästhetischen Reiz unserer Maschinen. Nicht
grundlos geben die beiden Intarsien in dunklem
Holz Bilder moderner Industrie. Aber als Schutz-
patron wird hier im grossen Reliefbildnis - - der
deutscheste der deutschen Altmeister, Albrecht Dürer
angerufen, und über dem Sitz befinden sich zwei
grosse Kinderreliefs im Weiss und Blau der Wedgwood-
platten! Das ist nur deshalb originell, weil es den
Widerspruch herausfordert. — Besser ausgeglichen,
freilich nüchterner, und schon durch die beiden Leder-
sitze zu sehr an den neuesten Kajüten- und Waggon-
stil gebunden, ist die von demselben Architekten ent-
worfene Bibliothekswand, an der Töpfer & Kläke
ihre Technik bewähren. W. Kümmel fasst sein Sofa
nach dem Entwurf von F. Sauvage mit zwei eichenen,
mit Tiffanyglas geschmackvoll belegten Türmen ein,
deren Äusseres aber alles andere eher erwarten lässt,
als dass sie sich als - Schränke öffnen lassen.
Mehr innerhalb der Tradition bewegt sich Georg
Honold, dessen Salonmöbel mit leichten Anklängen
an das Empire von C. Luckat gut ausgeführt sind,
aber koloristisch unter dem Altsilberbeschlag leiden.
So bleibt bei allen diesen Arbeiten nach An-
erkennung ihrer Vorzüge die sachliche Kritik stets
noch zu einem Aber« . . . genötigt. Es ist in ihnen
ein Rest von unverstandenen, wenn nicht unver-
ständigen Formen, bald ein Verlegenheitsstück, bald
ein unüberlegtes Abschweifen in die Bahnen der
Originalitätssucht.
Ähnlichen Charakter trägt auch die Mehrzahl der
mehr persönlich empfundenen Möbel und Interieurs.
Zwischen den kunstgewerblichen Beigaben der
letzten Berliner Kunstausstellungen gefiel sich ein
junger Architekt, Arthur Biberfeld, in der Rolle des
Hechtes im Karpfenteich. 1901 stellte er ein Muse-
zimmer, 1902 ein Familienzimmer aus. Seine Möbel
darin waren nicht nur urwüchsig, sondern derb, als
seien sie nach altspartanischem Gesetz nur für Säge
und Axt entworfen. Primitive Gebilde zu raffinierten
Zwecken! Sie wurden mehr bespöttelt, als gelobt,
aber — man sprach davon, und sie fanden Käufer.
Bei Biberfeld's neuem »Jungfrauenzimmer« wird der
Erfolg zweifellos noch günstiger werden, denn für
viele mag dieses kleine Gemach mit seinem breiten,
niedrigen Fenster der reizendste Teil der ganzen Aus-
stellung sein. Als Gesamtinterieur bietet es neben dem
besser gezeichneten als gezimmerten Privatkontor«
der Steglitzer Werkstatt (F. W. Kleukcns) in der That
den geschlossensten Stimmungswert, in dessen halb
schüchternen, halb gewagten Klängen das Thema
Jungfrauzimmer« geistvoll und leicht humoristisch
variiert ist. Der Grundton ist rosa und weiss, »les
deux couleurs consacrees ä la felicite , um mit Xavier
de Maistre zu sprechen. Wie eine Wolke schiebt
sich das Rosa der Wände in unregelmässiger Rundung
noch in das Weiss der Decke hinein. An den
übrigens sehr geschickt befestigten Fenstervorllängen
aber geht das Weiss in tiefes Rot über, und die
Möbelbezüge sind hellblau. Das gut gearbeitete
Mobiliar selbst ist durchweg eigenartig und meist prak-
tisch - sogar auch das scheinbar etwas launenhafte
Schreibtischchen mit seiner herzförmigen Platte. Die
Durchführung des Herzmotives und allerhand liebens-
würdige Spielereien, die rings dekorativ verteilt sind,
bezeugen, wie gut der junge Meister sein Publikum
SCHRANK, ENTWORFEN VON PROFESSOR
A. ORENANDER, AUSGEFÜHRT VON CARL MÜLLER,
KUNSTTISCHLEREI, BERLIN
hat wuchtige Formen, ist überall standfest, handfest,
scheinbar primitiv. Aber eben nur scheinbar! Der
Gegensatz zwischen den strengen Hauptgebilden und
ihren welligen Abschlusslinien diese etwa in der
Art von Otto Schmalz gezeichnet —, ferner die
Flachornamentik, deren Zeichnung Lieblingsmotive
der modernsten Dekorationsmalerei aufnimmt, das in
die klotzartigen Pfosten des Mittelteiles eingelassene
Paar bunter Mosaikplättchen, und manche andere
Einzelheiten sind von sehr bewusst pikanter Wirkung.
Und was für ein raffiniertes Gebilde ist im Grunde
die Stocklaterne mit ihren vier geraden Lichtkörpern!
Der ganze Charakter dieser Wanddekoration in der
unübertrefflichen Exaktheit ihrer Ausführung hat etwas
von dem ästhetischen Reiz unserer Maschinen. Nicht
grundlos geben die beiden Intarsien in dunklem
Holz Bilder moderner Industrie. Aber als Schutz-
patron wird hier im grossen Reliefbildnis - - der
deutscheste der deutschen Altmeister, Albrecht Dürer
angerufen, und über dem Sitz befinden sich zwei
grosse Kinderreliefs im Weiss und Blau der Wedgwood-
platten! Das ist nur deshalb originell, weil es den
Widerspruch herausfordert. — Besser ausgeglichen,
freilich nüchterner, und schon durch die beiden Leder-
sitze zu sehr an den neuesten Kajüten- und Waggon-
stil gebunden, ist die von demselben Architekten ent-
worfene Bibliothekswand, an der Töpfer & Kläke
ihre Technik bewähren. W. Kümmel fasst sein Sofa
nach dem Entwurf von F. Sauvage mit zwei eichenen,
mit Tiffanyglas geschmackvoll belegten Türmen ein,
deren Äusseres aber alles andere eher erwarten lässt,
als dass sie sich als - Schränke öffnen lassen.
Mehr innerhalb der Tradition bewegt sich Georg
Honold, dessen Salonmöbel mit leichten Anklängen
an das Empire von C. Luckat gut ausgeführt sind,
aber koloristisch unter dem Altsilberbeschlag leiden.
So bleibt bei allen diesen Arbeiten nach An-
erkennung ihrer Vorzüge die sachliche Kritik stets
noch zu einem Aber« . . . genötigt. Es ist in ihnen
ein Rest von unverstandenen, wenn nicht unver-
ständigen Formen, bald ein Verlegenheitsstück, bald
ein unüberlegtes Abschweifen in die Bahnen der
Originalitätssucht.
Ähnlichen Charakter trägt auch die Mehrzahl der
mehr persönlich empfundenen Möbel und Interieurs.
Zwischen den kunstgewerblichen Beigaben der
letzten Berliner Kunstausstellungen gefiel sich ein
junger Architekt, Arthur Biberfeld, in der Rolle des
Hechtes im Karpfenteich. 1901 stellte er ein Muse-
zimmer, 1902 ein Familienzimmer aus. Seine Möbel
darin waren nicht nur urwüchsig, sondern derb, als
seien sie nach altspartanischem Gesetz nur für Säge
und Axt entworfen. Primitive Gebilde zu raffinierten
Zwecken! Sie wurden mehr bespöttelt, als gelobt,
aber — man sprach davon, und sie fanden Käufer.
Bei Biberfeld's neuem »Jungfrauenzimmer« wird der
Erfolg zweifellos noch günstiger werden, denn für
viele mag dieses kleine Gemach mit seinem breiten,
niedrigen Fenster der reizendste Teil der ganzen Aus-
stellung sein. Als Gesamtinterieur bietet es neben dem
besser gezeichneten als gezimmerten Privatkontor«
der Steglitzer Werkstatt (F. W. Kleukcns) in der That
den geschlossensten Stimmungswert, in dessen halb
schüchternen, halb gewagten Klängen das Thema
Jungfrauzimmer« geistvoll und leicht humoristisch
variiert ist. Der Grundton ist rosa und weiss, »les
deux couleurs consacrees ä la felicite , um mit Xavier
de Maistre zu sprechen. Wie eine Wolke schiebt
sich das Rosa der Wände in unregelmässiger Rundung
noch in das Weiss der Decke hinein. An den
übrigens sehr geschickt befestigten Fenstervorllängen
aber geht das Weiss in tiefes Rot über, und die
Möbelbezüge sind hellblau. Das gut gearbeitete
Mobiliar selbst ist durchweg eigenartig und meist prak-
tisch - sogar auch das scheinbar etwas launenhafte
Schreibtischchen mit seiner herzförmigen Platte. Die
Durchführung des Herzmotives und allerhand liebens-
würdige Spielereien, die rings dekorativ verteilt sind,
bezeugen, wie gut der junge Meister sein Publikum