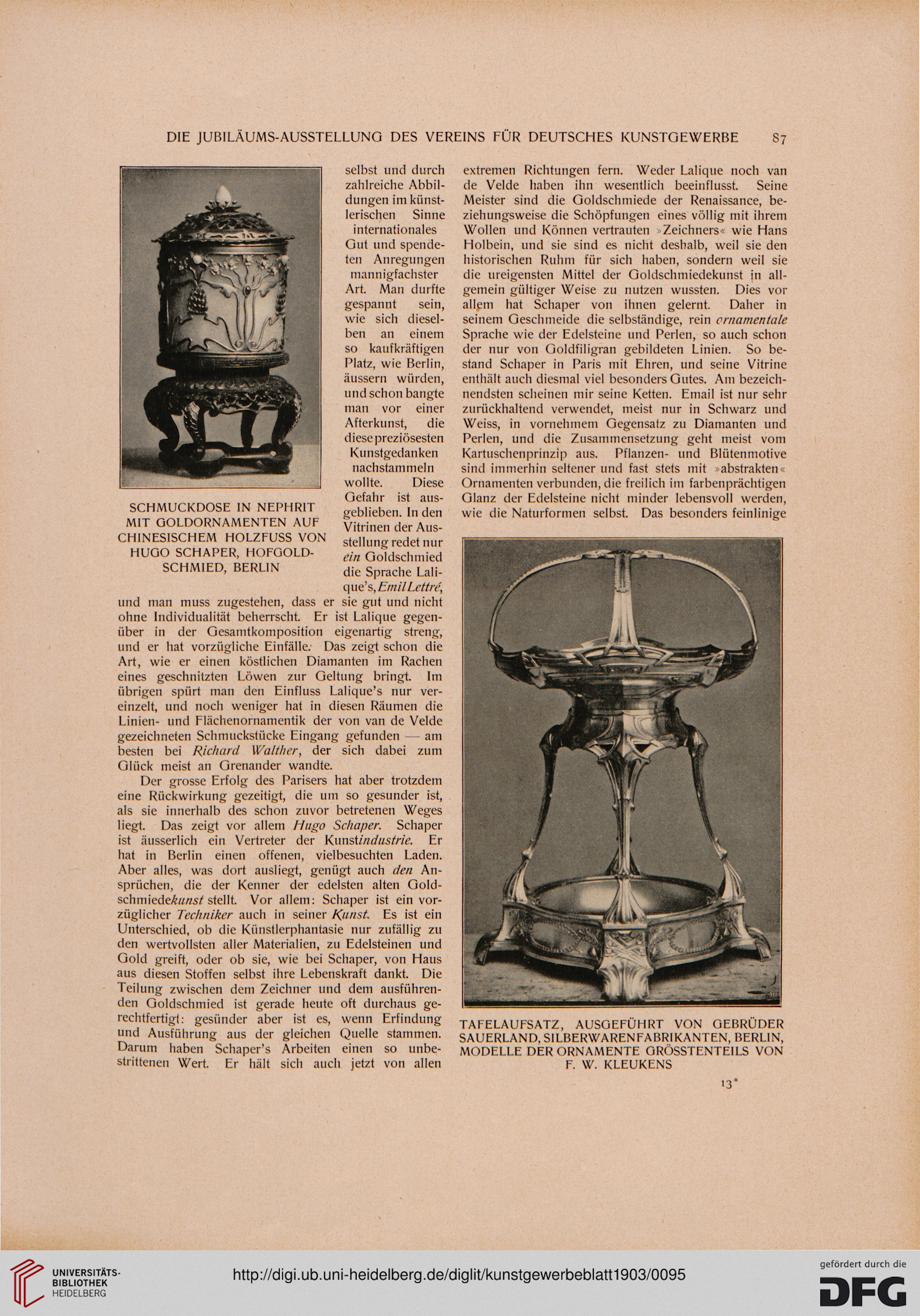DIE JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG DES VEREINS FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE 87
SCHMUCKDOSE IN NEPHRIT
MIT GOLDORNAMENTEN AUF
CHINESISCHEM HOLZFUSS VON
HUGO SCHAPER, HOFGOLD-
SCHMIED, BERLIN
selbst und durch
zahlreiche Abbil-
dungen im künst-
lerischen Sinne
internationales
Gut und spende-
ten Anregungen
mannigfachster
Art. Man durfte
gespannt sein,
wie sich diesel-
ben an einem
so kaufkräftigen
Platz, wie Berlin,
äussern würden,
und schon bangte
man vor einer
Afterkunst, die
diese preziösesten
Kunstgedanken
nachstammeln
wollte. Diese
Gefahr ist aus-
geblieben. In den
Vitrinen der Aus-
stellung redet nur
ein Goldschmied
die Sprache Lali-
que's, Emil Lettre,
und man muss zugestehen, dass er sie gut und nicht
ohne Individualität beherrscht. Er ist Lalique gegen-
über in der Gesamtkomposition eigenartig streng,
und er hat vorzügliche Einfälle. Das zeigt schon die
Art, wie er einen köstlichen Diamanten im Rachen
eines geschnitzten Löwen zur Geltung bringt. Im
übrigen spürt man den Einfluss Lalique's nur ver-
einzelt, und noch weniger hat in diesen Räumen die
Linien- und Flächenornamentik der von van de Velde
gezeichneten Schmuckstücke Eingang gefunden -- am
besten bei Richard Walther, der sich dabei zum
Glück meist an Grenander wandte.
Der grosse Erfolg des Parisers hat aber trotzdem
eine Rückwirkung gezeitigt, die um so gesunder ist,
als sie innerhalb des schon zuvor betretenen Weges
liegt. Das zeigt vor allem Hugo Schaper. Schaper
ist äusserlich ein Vertreter der Kunstindustrie. Er
hat in Berlin einen offenen, vielbesuchten Laden.
Aber alles, was dort ausliegt, genügt auch den An-
sprüchen, die der Kenner der edelsten alten Gold-
schmxedzkunst stellt. Vor allem: Schaper ist ein vor-
züglicher Techniker auch in seiner Kunst. Es ist ein
Unterschied, ob die Künstlerphantasie nur zufällig zu
den wertvollsten aller Materialien, zu Edelsteinen und
Gold greift, oder ob sie, wie bei Schaper, von Haus
aus diesen Stoffen selbst ihre Lebenskraft dankt. Die
Teilung zwischen dem Zeichner und dem ausführen-
den Goldschmied ist gerade heute oft durchaus ge-
rechtfertigt: gesünder aber ist es, wenn Erfindung
und Ausführung aus der gleichen Quelle stammen.
Darum haben Schaper's Arbeiten einen so unbe-
strittenen Wert. Er hält sich auch jetzt von allen
extremen Richtungen fern. Weder Lalique noch van
de Velde haben ihn wesentlich beeinflusst. Seine
Meister sind die Goldschmiede der Renaissance, be-
ziehungsweise die Schöpfungen eines völlig mit ihrem
Wollen und Können vertrauten Zeichners« wie Hans
Holbein, und sie sind es nicht deshalb, weil sie den
historischen Ruhm für sich haben, sondern weil sie
die ureigensten Mittel der Goldschmiedekunst in all-
gemein gültiger Weise zu nutzen wussten. Dies vor
allem hat Schaper von ihnen gelernt. Daher in
seinem Geschmeide die selbständige, rein ornamentale
Sprache wie der Edelsteine und Perlen, so auch schon
der nur von Goldfiligran gebildeten Linien. So be-
stand Schaper in Paris mit Ehren, und seine Vitrine
enthält auch diesmal viel besonders Gutes. Am bezeich-
nendsten scheinen mir seine Ketten. Email ist nur sehr
zurückhaltend verwendet, meist nur in Schwarz und
Weiss, in vornehmem Gegensatz zu Diamanten und
Perlen, und die Zusammensetzung geht meist vom
Kartuschenprinzip aus. Pflanzen- und Blütenmotive
sind immerhin seltener und fast stets mit »abstrakten«
Ornamenten verbunden, die freilich im farbenprächtigen
Glanz der Edelsteine nicht minder lebensvoll werden,
wie die Naturformen selbst. Das besonders feinlinige
TAFELAUFSATZ, AUSGEFÜHRT VON GEBRUDER
SAUERLAND, SILBERWARENFABRIKANTEN, BERLIN,
MODELLE DER ORNAMENTE GRÖSSTENTEILS VON
F. W. KLEUKENS
13*
SCHMUCKDOSE IN NEPHRIT
MIT GOLDORNAMENTEN AUF
CHINESISCHEM HOLZFUSS VON
HUGO SCHAPER, HOFGOLD-
SCHMIED, BERLIN
selbst und durch
zahlreiche Abbil-
dungen im künst-
lerischen Sinne
internationales
Gut und spende-
ten Anregungen
mannigfachster
Art. Man durfte
gespannt sein,
wie sich diesel-
ben an einem
so kaufkräftigen
Platz, wie Berlin,
äussern würden,
und schon bangte
man vor einer
Afterkunst, die
diese preziösesten
Kunstgedanken
nachstammeln
wollte. Diese
Gefahr ist aus-
geblieben. In den
Vitrinen der Aus-
stellung redet nur
ein Goldschmied
die Sprache Lali-
que's, Emil Lettre,
und man muss zugestehen, dass er sie gut und nicht
ohne Individualität beherrscht. Er ist Lalique gegen-
über in der Gesamtkomposition eigenartig streng,
und er hat vorzügliche Einfälle. Das zeigt schon die
Art, wie er einen köstlichen Diamanten im Rachen
eines geschnitzten Löwen zur Geltung bringt. Im
übrigen spürt man den Einfluss Lalique's nur ver-
einzelt, und noch weniger hat in diesen Räumen die
Linien- und Flächenornamentik der von van de Velde
gezeichneten Schmuckstücke Eingang gefunden -- am
besten bei Richard Walther, der sich dabei zum
Glück meist an Grenander wandte.
Der grosse Erfolg des Parisers hat aber trotzdem
eine Rückwirkung gezeitigt, die um so gesunder ist,
als sie innerhalb des schon zuvor betretenen Weges
liegt. Das zeigt vor allem Hugo Schaper. Schaper
ist äusserlich ein Vertreter der Kunstindustrie. Er
hat in Berlin einen offenen, vielbesuchten Laden.
Aber alles, was dort ausliegt, genügt auch den An-
sprüchen, die der Kenner der edelsten alten Gold-
schmxedzkunst stellt. Vor allem: Schaper ist ein vor-
züglicher Techniker auch in seiner Kunst. Es ist ein
Unterschied, ob die Künstlerphantasie nur zufällig zu
den wertvollsten aller Materialien, zu Edelsteinen und
Gold greift, oder ob sie, wie bei Schaper, von Haus
aus diesen Stoffen selbst ihre Lebenskraft dankt. Die
Teilung zwischen dem Zeichner und dem ausführen-
den Goldschmied ist gerade heute oft durchaus ge-
rechtfertigt: gesünder aber ist es, wenn Erfindung
und Ausführung aus der gleichen Quelle stammen.
Darum haben Schaper's Arbeiten einen so unbe-
strittenen Wert. Er hält sich auch jetzt von allen
extremen Richtungen fern. Weder Lalique noch van
de Velde haben ihn wesentlich beeinflusst. Seine
Meister sind die Goldschmiede der Renaissance, be-
ziehungsweise die Schöpfungen eines völlig mit ihrem
Wollen und Können vertrauten Zeichners« wie Hans
Holbein, und sie sind es nicht deshalb, weil sie den
historischen Ruhm für sich haben, sondern weil sie
die ureigensten Mittel der Goldschmiedekunst in all-
gemein gültiger Weise zu nutzen wussten. Dies vor
allem hat Schaper von ihnen gelernt. Daher in
seinem Geschmeide die selbständige, rein ornamentale
Sprache wie der Edelsteine und Perlen, so auch schon
der nur von Goldfiligran gebildeten Linien. So be-
stand Schaper in Paris mit Ehren, und seine Vitrine
enthält auch diesmal viel besonders Gutes. Am bezeich-
nendsten scheinen mir seine Ketten. Email ist nur sehr
zurückhaltend verwendet, meist nur in Schwarz und
Weiss, in vornehmem Gegensatz zu Diamanten und
Perlen, und die Zusammensetzung geht meist vom
Kartuschenprinzip aus. Pflanzen- und Blütenmotive
sind immerhin seltener und fast stets mit »abstrakten«
Ornamenten verbunden, die freilich im farbenprächtigen
Glanz der Edelsteine nicht minder lebensvoll werden,
wie die Naturformen selbst. Das besonders feinlinige
TAFELAUFSATZ, AUSGEFÜHRT VON GEBRUDER
SAUERLAND, SILBERWARENFABRIKANTEN, BERLIN,
MODELLE DER ORNAMENTE GRÖSSTENTEILS VON
F. W. KLEUKENS
13*