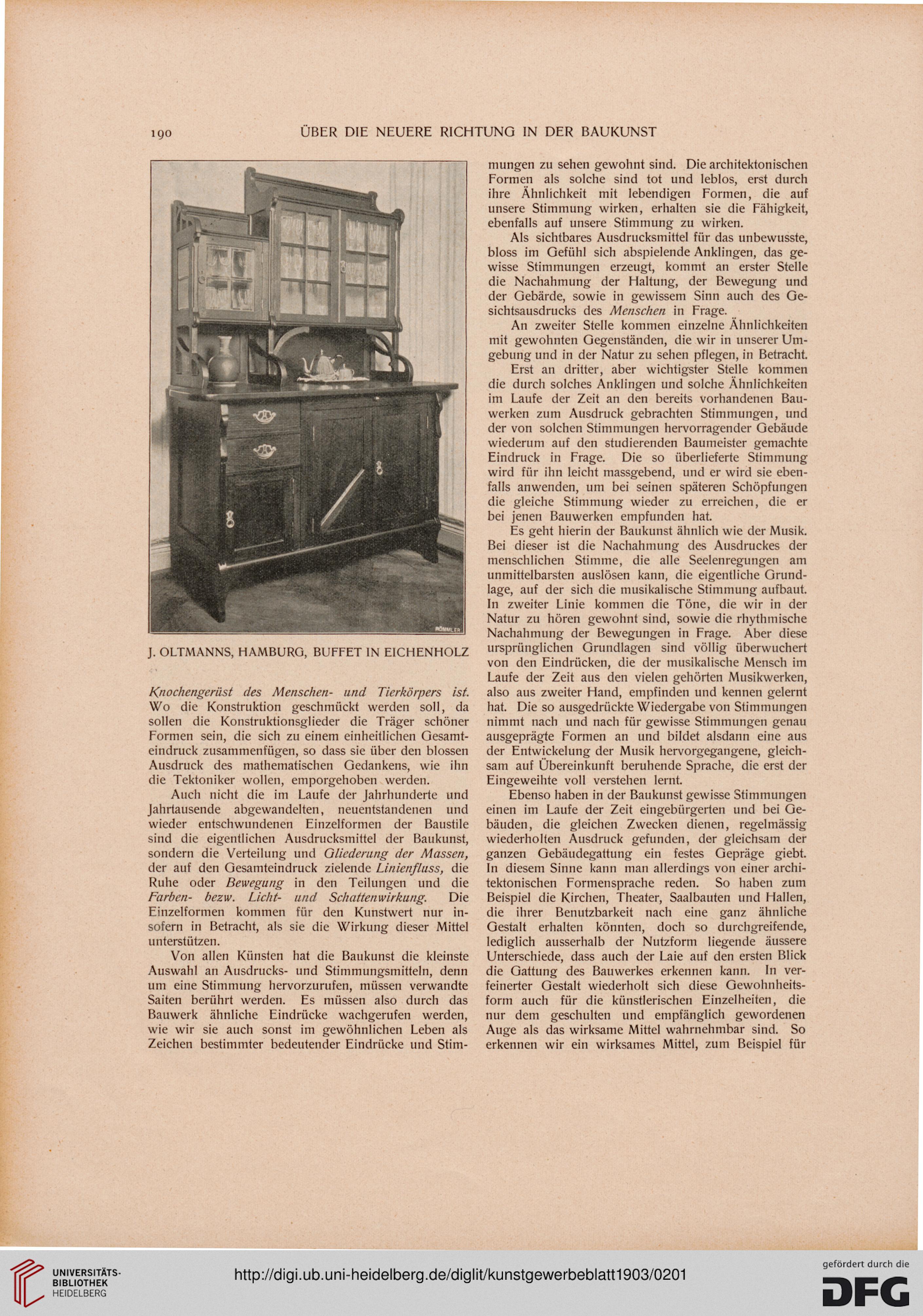190
ÜBER DIE NEUERE RICHTUNG IN DER BAUKUNST
J. OLTMANNS, HAMBURG, BÜFFET IN EICHENHOLZ
Knochengerüst des Menschen- und Tierkörpers ist.
Wo die Konstruktion geschmückt werden soll, da
sollen die Konstruktionsglieder die Träger schöner
Formen sein, die sich zu einem einheitlichen Gesamt-
eindruck zusammenfügen, so dass sie über den blossen
Ausdruck des mathematischen Gedankens, wie ihn
die Tektoniker wollen, emporgehoben werden.
Auch nicht die im Laufe der Jahrhunderte und
Jahrtausende abgewandelten, neuentstandenen und
wieder entschwundenen Einzelformen der Baustile
sind die eigentlichen Ausdrucksmittel der Baukunst,
sondern die Verteilung und Gliederung der Massen,
der auf den Gesamteindruck zielende Linienfluss, die
Ruhe oder Bewegung in den Teilungen und die
Farben- bezw. Licht- und Schattenwirkung. Die
Einzelformen kommen für den Kunstwert nur in-
sofern in Betracht, als sie die Wirkung dieser Mittel
unterstützen.
Von allen Künsten hat die Baukunst die kleinste
Auswahl an Ausdrucks- und Stimmungsmitteln, denn
um eine Stimmung hervorzurufen, müssen verwandte
Saiten berührt werden. Es müssen also durch das
Bauwerk ähnliche Eindrücke wachgerufen werden,
wie wir sie auch sonst im gewöhnlichen Leben als
Zeichen bestimmter bedeutender Eindrücke und Stim-
mungen zu sehen gewohnt sind. Die architektonischen
Formen als solche sind tot und leblos, erst durch
ihre Ähnlichkeit mit lebendigen Formen, die auf
unsere Stimmung wirken, erhalten sie die Fähigkeit,
ebenfalls auf unsere Stimmung zu wirken.
Als sichtbares Ausdrucksmittel für das unbewusste,
bloss im Gefühl sich abspielende Anklingen, das ge-
wisse Stimmungen erzeugt, kommt an erster Stelle
die Nachahmung der Haltung, der Bewegung und
der Gebärde, sowie in gewissem Sinn auch des Ge-
sichtsausdrucks des Menschen in Frage.
An zweiter Stelle kommen einzelne Ähnlichkeiten
mit gewohnten Gegenständen, die wir in unserer Um-
gebung und in der Natur zu sehen pflegen, in Betracht.
Erst an dritter, aber wichtigster Stelle kommen
die durch solches Anklingen und solche Ähnlichkeiten
im Laufe der Zeit an den bereits vorhandenen Bau-
werken zum Ausdruck gebrachten Stimmungen, und
der von solchen Stimmungen hervorragender Gebäude
wiederum auf den studierenden Baumeister gemachte
Eindruck in Frage. Die so überlieferte Stimmung
wird für ihn leicht massgebend, und er wird sie eben-
falls anwenden, um bei seinen späteren Schöpfungen
die gleiche Stimmung wieder zu erreichen, die er
bei jenen Bauwerken empfunden hat.
Es geht hierin der Baukunst ähnlich wie der Musik.
Bei dieser ist die Nachahmung des Ausdruckes der
menschlichen Stimme, die alle Seelenregungen am
unmittelbarsten auslösen kann, die eigentliche Grund-
lage, auf der sich die musikalische Stimmung aufbaut.
In zweiter Linie kommen die Töne, die wir in der
Natur zu hören gewohnt sind, sowie die rhythmische
Nachahmung der Bewegungen in Frage. Aber diese
ursprünglichen Grundlagen sind völlig überwuchert
von den Eindrücken, die der musikalische Mensch im
Laufe der Zeit aus den vielen gehörten Musikwerken,
also aus zweiter Hand, empfinden und kennen gelernt
hat. Die so ausgedrückte Wiedergabe von Stimmungen
nimmt nach und nach für gewisse Stimmungen genau
ausgeprägte Formen an und bildet alsdann eine aus
der Entwickelung der Musik hervorgegangene, gleich-
sam auf Übereinkunft beruhende Sprache, die erst der
Eingeweihte voll verstehen lernt.
Ebenso haben in der Baukunst gewisse Stimmungen
einen im Laufe der Zeit eingebürgerten und bei Ge-
bäuden, die gleichen Zwecken dienen, regelmässig
wiederholten Ausdruck gefunden, der gleichsam der
ganzen Gebäudegattung ein festes Gepräge giebt.
In diesem Sinne kann man allerdings von einer archi-
tektonischen Formensprache reden. So haben zum
Beispiel die Kirchen, Theater, Saalbauten und Hallen,
die ihrer Benutzbarkeit nach eine ganz ähnliche
Gestalt erhalten könnten, doch so durchgreifende,
lediglich ausserhalb der Nutzform liegende äussere
Unterschiede, dass auch der Laie auf den ersten Blick
die Gattung des Bauwerkes erkennen kann. In ver-
feinerter Gestalt wiederholt sich diese Gewohnheits-
form auch für die künstlerischen Einzelheiten, die
nur dem geschulten und empfänglich gewordenen
Auge als das wirksame Mittel wahrnehmbar sind. So
erkennen wir ein wirksames Mittel, zum Beispiel für
ÜBER DIE NEUERE RICHTUNG IN DER BAUKUNST
J. OLTMANNS, HAMBURG, BÜFFET IN EICHENHOLZ
Knochengerüst des Menschen- und Tierkörpers ist.
Wo die Konstruktion geschmückt werden soll, da
sollen die Konstruktionsglieder die Träger schöner
Formen sein, die sich zu einem einheitlichen Gesamt-
eindruck zusammenfügen, so dass sie über den blossen
Ausdruck des mathematischen Gedankens, wie ihn
die Tektoniker wollen, emporgehoben werden.
Auch nicht die im Laufe der Jahrhunderte und
Jahrtausende abgewandelten, neuentstandenen und
wieder entschwundenen Einzelformen der Baustile
sind die eigentlichen Ausdrucksmittel der Baukunst,
sondern die Verteilung und Gliederung der Massen,
der auf den Gesamteindruck zielende Linienfluss, die
Ruhe oder Bewegung in den Teilungen und die
Farben- bezw. Licht- und Schattenwirkung. Die
Einzelformen kommen für den Kunstwert nur in-
sofern in Betracht, als sie die Wirkung dieser Mittel
unterstützen.
Von allen Künsten hat die Baukunst die kleinste
Auswahl an Ausdrucks- und Stimmungsmitteln, denn
um eine Stimmung hervorzurufen, müssen verwandte
Saiten berührt werden. Es müssen also durch das
Bauwerk ähnliche Eindrücke wachgerufen werden,
wie wir sie auch sonst im gewöhnlichen Leben als
Zeichen bestimmter bedeutender Eindrücke und Stim-
mungen zu sehen gewohnt sind. Die architektonischen
Formen als solche sind tot und leblos, erst durch
ihre Ähnlichkeit mit lebendigen Formen, die auf
unsere Stimmung wirken, erhalten sie die Fähigkeit,
ebenfalls auf unsere Stimmung zu wirken.
Als sichtbares Ausdrucksmittel für das unbewusste,
bloss im Gefühl sich abspielende Anklingen, das ge-
wisse Stimmungen erzeugt, kommt an erster Stelle
die Nachahmung der Haltung, der Bewegung und
der Gebärde, sowie in gewissem Sinn auch des Ge-
sichtsausdrucks des Menschen in Frage.
An zweiter Stelle kommen einzelne Ähnlichkeiten
mit gewohnten Gegenständen, die wir in unserer Um-
gebung und in der Natur zu sehen pflegen, in Betracht.
Erst an dritter, aber wichtigster Stelle kommen
die durch solches Anklingen und solche Ähnlichkeiten
im Laufe der Zeit an den bereits vorhandenen Bau-
werken zum Ausdruck gebrachten Stimmungen, und
der von solchen Stimmungen hervorragender Gebäude
wiederum auf den studierenden Baumeister gemachte
Eindruck in Frage. Die so überlieferte Stimmung
wird für ihn leicht massgebend, und er wird sie eben-
falls anwenden, um bei seinen späteren Schöpfungen
die gleiche Stimmung wieder zu erreichen, die er
bei jenen Bauwerken empfunden hat.
Es geht hierin der Baukunst ähnlich wie der Musik.
Bei dieser ist die Nachahmung des Ausdruckes der
menschlichen Stimme, die alle Seelenregungen am
unmittelbarsten auslösen kann, die eigentliche Grund-
lage, auf der sich die musikalische Stimmung aufbaut.
In zweiter Linie kommen die Töne, die wir in der
Natur zu hören gewohnt sind, sowie die rhythmische
Nachahmung der Bewegungen in Frage. Aber diese
ursprünglichen Grundlagen sind völlig überwuchert
von den Eindrücken, die der musikalische Mensch im
Laufe der Zeit aus den vielen gehörten Musikwerken,
also aus zweiter Hand, empfinden und kennen gelernt
hat. Die so ausgedrückte Wiedergabe von Stimmungen
nimmt nach und nach für gewisse Stimmungen genau
ausgeprägte Formen an und bildet alsdann eine aus
der Entwickelung der Musik hervorgegangene, gleich-
sam auf Übereinkunft beruhende Sprache, die erst der
Eingeweihte voll verstehen lernt.
Ebenso haben in der Baukunst gewisse Stimmungen
einen im Laufe der Zeit eingebürgerten und bei Ge-
bäuden, die gleichen Zwecken dienen, regelmässig
wiederholten Ausdruck gefunden, der gleichsam der
ganzen Gebäudegattung ein festes Gepräge giebt.
In diesem Sinne kann man allerdings von einer archi-
tektonischen Formensprache reden. So haben zum
Beispiel die Kirchen, Theater, Saalbauten und Hallen,
die ihrer Benutzbarkeit nach eine ganz ähnliche
Gestalt erhalten könnten, doch so durchgreifende,
lediglich ausserhalb der Nutzform liegende äussere
Unterschiede, dass auch der Laie auf den ersten Blick
die Gattung des Bauwerkes erkennen kann. In ver-
feinerter Gestalt wiederholt sich diese Gewohnheits-
form auch für die künstlerischen Einzelheiten, die
nur dem geschulten und empfänglich gewordenen
Auge als das wirksame Mittel wahrnehmbar sind. So
erkennen wir ein wirksames Mittel, zum Beispiel für