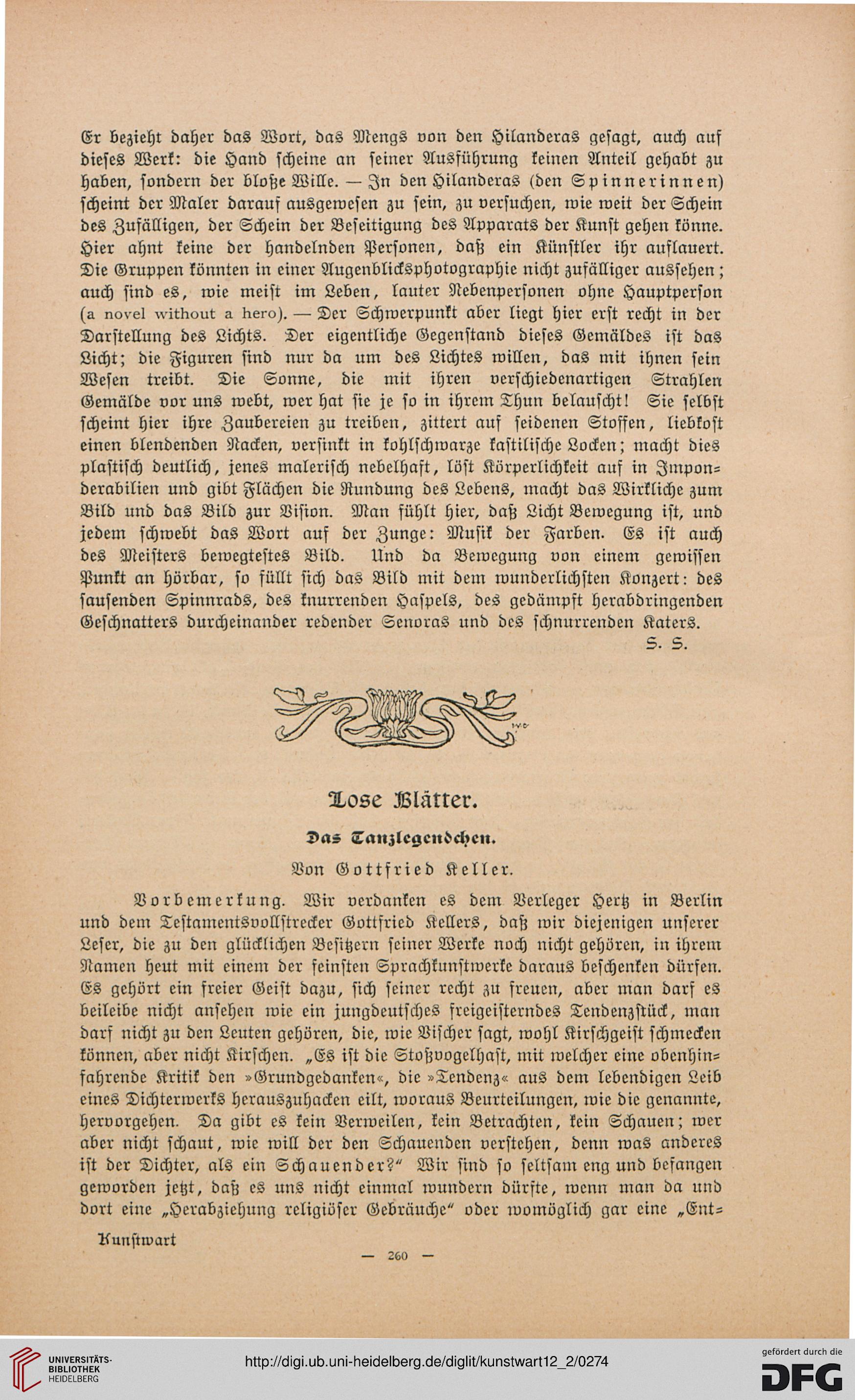Er bezieht daher das Wort, das Mengs von den Hilanderas gesagt, auch auf
dieses Werk: die Hand scheine an seiner Ausführung keinen Anteil gehabt zu
haben, sondern der bloße Wille. — Jn den Hilanderas (den Spinnerinnen)
scheint der Maler darauf ausgewesen zu sein, zu versuchen, wie weit der Schein
des Zufälligen, der Schein der Beseitigung des Apparats der Kunst gehen könne.
Hier ahnt keine der handelnden Personen, daß ein Künstler ihr auflauert.
Die Gruppen könnten in einer Augenblicksphotographie nicht zufälliger aussehen;
auch sind es, wie meist im Leben, lauter Nebenpersonen ohne Hauptperson
(a novel rvitbout L beio). — Der Schwcrpunkt aber licgt hier erst recht in der
Darstellung des Lichts. Der eigentliche Gegenstand dieses Gemäldes ist das
Licht; die Figuren sind nur da um des Lichtes willen, das mit ihnen sein
Wesen treibt. Die Sonne, die mit ihren verschiedenartigen Strahlen
Gemälde vor uns webt, wer hat sie je so in ihrem Thun belauschtl Sie selbst
scheint hier ihre Zaubereien zu treiben, zittert auf seidenen Stoffen, liebkost
einen blendenden Nacken, versinkt in kohlschwarze kastilische Locken; macht dies
plastisch deutlich, jenes malerisch nebelhaft, löst Kürperlichkeit auf in Jmpon-
derabilien und gibt Flächen die Rundung des Lebens, macht das Wirkliche zum
Bild und das Bild zur Vision. Man fühlt hier, daß Licht Bewegung ist, und
jedem schwebt das Wort auf der Zunge: Musik der Farben. Es ist auch
des Meisters bewegtestes Bild. Und da Bewegung von einem gewissen
Punkt an hörbar, so füllt sich das Bild mit dem rvunderlichsten Konzert: des
sausenden Spinnrads, des knurrenden Haspels, des gedämpft herabdringenden
Geschnatters durcheinander redender Senoras und des schnurrenden Katers.
s. s.
Lose Klärrer.
Das Tanzlegcndcl'en.
Von Gottfried Keller.
Vorb cmerkung. Wir verdanken es dem Verleger Hertz in Berlin
und dem Testamentsvollstrecker Gottfried Kellers, daß ivir diejenigen unserer
Leser, die zu den glücklichen Besitzern seiner Werke noch nicht gehören, in ihrem
Namen heut mit einem der feinsten Sprachkunstwerke daraus beschenken dürfen.
Es gehört ein freier Geist dazu, sich seiner recht zu freuen, aber man darf es
beileibe nicht ansehen wie ein jungdeutsches freigeisterndes Tendenzstück, man
darf nicht zu den Leuten gehüren, die, wie Vischer sagt, wohl Kirschgeist schmecken
können, aber nicht Kirschen. „Es ist die Stoßvogelhast, mit welcher eine obenhin-
fahrende Kritik den »Grundgedanken«, die »Tendenz« aus dem lebendigen Leib
eincs Dichterwerks herauszuhacken eilt, woraus Beurteilungen, wie die genannte,
hervorgehen. Da gibt es kein Verweilen, kein Betrachten, kein Schauen; wer
aber nicht schaut, wie will der den Schauendcn verstchen, denn was anderes
ist der Dichter, als ein Schauender?" Wir sind so seltsam eng und befangen
geworden jetzt, daß es uns nicht einmal wundern dürfte, wenn man da und
dort eine „Herabziehung religiöser Gebrüuche" oder womöglich gar eine ,Ent-
Kunstmart
dieses Werk: die Hand scheine an seiner Ausführung keinen Anteil gehabt zu
haben, sondern der bloße Wille. — Jn den Hilanderas (den Spinnerinnen)
scheint der Maler darauf ausgewesen zu sein, zu versuchen, wie weit der Schein
des Zufälligen, der Schein der Beseitigung des Apparats der Kunst gehen könne.
Hier ahnt keine der handelnden Personen, daß ein Künstler ihr auflauert.
Die Gruppen könnten in einer Augenblicksphotographie nicht zufälliger aussehen;
auch sind es, wie meist im Leben, lauter Nebenpersonen ohne Hauptperson
(a novel rvitbout L beio). — Der Schwcrpunkt aber licgt hier erst recht in der
Darstellung des Lichts. Der eigentliche Gegenstand dieses Gemäldes ist das
Licht; die Figuren sind nur da um des Lichtes willen, das mit ihnen sein
Wesen treibt. Die Sonne, die mit ihren verschiedenartigen Strahlen
Gemälde vor uns webt, wer hat sie je so in ihrem Thun belauschtl Sie selbst
scheint hier ihre Zaubereien zu treiben, zittert auf seidenen Stoffen, liebkost
einen blendenden Nacken, versinkt in kohlschwarze kastilische Locken; macht dies
plastisch deutlich, jenes malerisch nebelhaft, löst Kürperlichkeit auf in Jmpon-
derabilien und gibt Flächen die Rundung des Lebens, macht das Wirkliche zum
Bild und das Bild zur Vision. Man fühlt hier, daß Licht Bewegung ist, und
jedem schwebt das Wort auf der Zunge: Musik der Farben. Es ist auch
des Meisters bewegtestes Bild. Und da Bewegung von einem gewissen
Punkt an hörbar, so füllt sich das Bild mit dem rvunderlichsten Konzert: des
sausenden Spinnrads, des knurrenden Haspels, des gedämpft herabdringenden
Geschnatters durcheinander redender Senoras und des schnurrenden Katers.
s. s.
Lose Klärrer.
Das Tanzlegcndcl'en.
Von Gottfried Keller.
Vorb cmerkung. Wir verdanken es dem Verleger Hertz in Berlin
und dem Testamentsvollstrecker Gottfried Kellers, daß ivir diejenigen unserer
Leser, die zu den glücklichen Besitzern seiner Werke noch nicht gehören, in ihrem
Namen heut mit einem der feinsten Sprachkunstwerke daraus beschenken dürfen.
Es gehört ein freier Geist dazu, sich seiner recht zu freuen, aber man darf es
beileibe nicht ansehen wie ein jungdeutsches freigeisterndes Tendenzstück, man
darf nicht zu den Leuten gehüren, die, wie Vischer sagt, wohl Kirschgeist schmecken
können, aber nicht Kirschen. „Es ist die Stoßvogelhast, mit welcher eine obenhin-
fahrende Kritik den »Grundgedanken«, die »Tendenz« aus dem lebendigen Leib
eincs Dichterwerks herauszuhacken eilt, woraus Beurteilungen, wie die genannte,
hervorgehen. Da gibt es kein Verweilen, kein Betrachten, kein Schauen; wer
aber nicht schaut, wie will der den Schauendcn verstchen, denn was anderes
ist der Dichter, als ein Schauender?" Wir sind so seltsam eng und befangen
geworden jetzt, daß es uns nicht einmal wundern dürfte, wenn man da und
dort eine „Herabziehung religiöser Gebrüuche" oder womöglich gar eine ,Ent-
Kunstmart