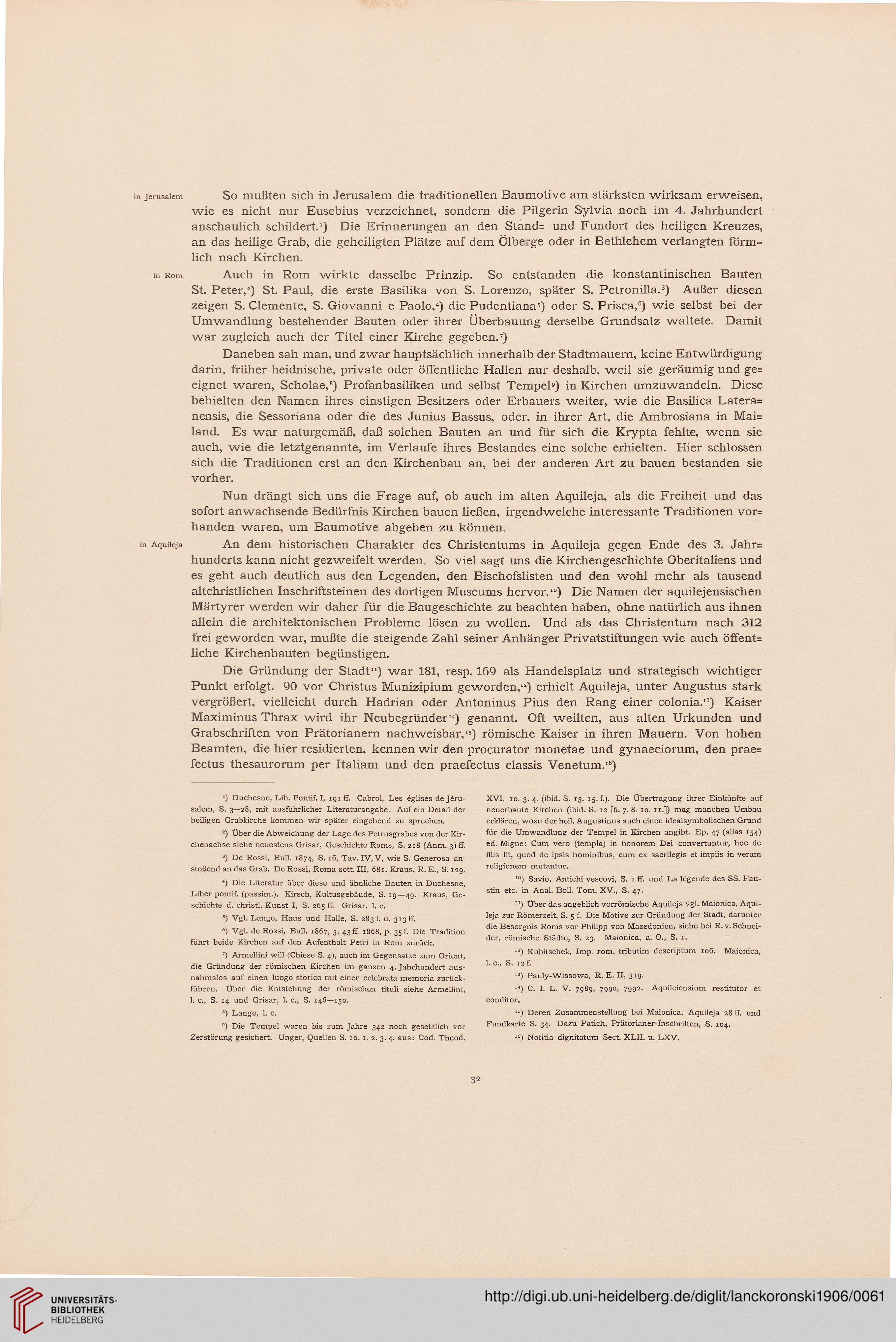in Jerusalem So mußten sich in Jerusalem die traditionellen Baumotive am stärksten wirksam erweisen,
wie es nicht nur Eusebius verzeichnet, sondern die Pilgerin Sylvia noch im 4. Jahrhundert
anschaulich schildert.1) Die Erinnerungen an den Stand= und Fundort des heiligen Kreuzes,
an das heilige Grab, die geheiligten Plätze auf dem Ölberge oder in Bethlehem verlangten förm-
lich nach Kirchen.
in Rom Auch in Rom wirkte dasselbe Prinzip. So entstanden die konstantinischen Bauten
St. Peter,2) St. Paul, die erste Basilika von S. Lorenzo, später S. Petronilla.3) Außer diesen
zeigen S. demente, S. Giovanni e Paolo,4) die Pudentiana5) oder S. Prisca,6) wie selbst bei der
Umwandlung bestehender Bauten oder ihrer Überbauung derselbe Grundsatz waltete. Damit
war zugleich auch der Titel einer Kirche gegeben.7)
Daneben sah man, und zwar hauptsächlich innerhalb der Stadtmauern, keine Entwürdigung
darin, früher heidnische, private oder öffentliche Hallen nur deshalb, weil sie geräumig und ge-
eignet waren, Scholae,8) Profanbasiliken und selbst Tempel9) in Kirchen umzuwandeln. Diese
behielten den Namen ihres einstigen Besitzers oder Erbauers weiter, wie die Basilica Latera-
nensis, die Sessoriana oder die des Junius Bassus, oder, in ihrer Art, die Ambrosiana in Mai-
land. Es war naturgemäß, daß solchen Bauten an und für sich die Krypta fehlte, wenn sie
auch, wie die letztgenannte, im Verlaufe ihres Bestandes eine solche erhielten. Hier schlössen
sich die Traditionen erst an den Kirchenbau an, bei der anderen Art zu bauen bestanden sie
vorher.
Nun drängt sich uns die Frage auf, ob auch im alten Aquileja, als die Freiheit und das
sofort anwachsende Bedürfnis Kirchen bauen ließen, irgendwelche interessante Traditionen vor-
handen waren, um Baumotive abgeben zu können,
in Aquiieja An dem historischen Charakter des Christentums in Aquileja gegen Ende des 3. Jahr-
hunderts kann nicht gezweifelt werden. So viel sagt uns die Kirchengeschichte Oberitaliens und
es geht auch deutlich aus den Legenden, den Bischofslisten und den wohl mehr als tausend
altchristlichen Inschriftsteinen des dortigen Museums hervor.10) Die Namen der aquilejensischen
Märtyrer werden wir daher für die Baugeschichte zu beachten haben, ohne natürlich aus ihnen
allein die architektonischen Probleme lösen zu wollen. Und als das Christentum nach 312
frei geworden war, mußte die steigende Zahl seiner Anhänger Privatstiftungen wie auch öffent-
liehe Kirchenbauten begünstigen.
Die Gründung der Stadt11) war 181, resp. 169 als Handelsplatz und strategisch wichtiger
Punkt erfolgt. 90 vor Christus Munizipium geworden,12) erhielt Aquileja, unter Augustus stark
vergrößert, vielleicht durch Hadrian oder Antoninus Pius den Rang einer colonia.13) Kaiser
Maximinus Thrax wird ihr Neubegründer14) genannt. Oft weilten, aus alten Urkunden und
Grabschriften von Prätorianern nachweisbar,15) römische Kaiser in ihren Mauern. Von hohen
Beamten, die hier residierten, kennen wir den procurator monetae und gynaeciorum, den prae-
fectus thesaurorum per Italiam und den praefectus classis Venetum.16)
T) Duchesne, Lib. Pontif. I, 191 ff. Cabrol, Les eglises de Jeru-
salem, S. 3—28, mit ausführlicher Literaturangabe. Auf ein Detail der
heiligen Grabkirche kommen wir später eingehend zu sprechen.
2) Über die Abweichung der Lage des Petrusgrabes von der Kir-
chenachse siehe neuestens Grisar, Geschichte Roms, S. 218 (Anm. 3) ff.
3) De Rossi, Bull. 1874, S. 16, Tav. IV, V, wie S. Generosa an-
stoßend an das Grab. De Rossi, Roma sott. III, 681. Kraus, R. E., S. 129.
4) Die Literatur über diese und ähnliche Bauten in Duchesne,
Liber pontif. (passim.). Kirsch, Kultusgebäude, S. 19 — 49. Kraus, Ge-
schichte d. christl. Kunst I, S. 265 ff. Grisar, 1. c.
5) Vgl. Lange, Haus und Halle, S. 283 f. u. 313 ff.
6) Vgl. de Rossi, Bull. 1867, 5, 43 ff 1868, p. 35 f. Die Tradition
führt beide Kirchen auf den Aufenthalt Petri in Rom zurück.
7) Armellini will (Chiese S. 4), auch im Gegensatze zum Orient,
die Gründung der römischen Kirchen im ganzen 4. Jahrhundert aus-
nahmslos auf einen luogo storico mit einer celebrata memoria zurück-
führen. Über die Entstehung der römischen tituli siehe Armellini,
1. c, S. 14 und Grisar, 1. c, S. 146—150.
8) Lange, 1. c.
9) Die Tempel waren bis zum Jahre 342 noch gesetzlich vor
Zerstörung gesichert. Unger, Quellen S. 10. 1. 2. 3. 4. aus: Cod. Theod.
XVI. 10. 3. 4. (ibid. S. 13. 15. f.). Die Übertragung ihrer Einkünfte auf
neuerbaute Kirchen (ibid. S. 12 [6. 7. 8. 10. 11.]) mag manchen Umbau
erklären, wozu der heil. Augustinus auch einen idealsymbolischen Grund
für die Umwandlung der Tempel in Kirchen angibt. Ep. 47 (alias 154)
ed. Migne: Cum vero (templa) in honorem Dei convertuntur, hoc de
illis fit, quod de ipsis hominibus, cum ex sacrilegis et impiis in veram
religionem mutantur.
IO) Savio, Antichi vescovi, S. 1 ff. und La legende des SS. Fau-
stin etc. in Anal. Boll. Tom. XV., S. 47.
") Über das angeblich vorrömische Aquileja vgl. Maionica, Aqui-
leja zur Römerzeit, S. 5 f. Die Motive zur Gründung der Stadt, darunter
die Besorgnis Roms vor Philipp von Mazedonien, siehe bei R. v. Schnei-
der, römische Städte, S. 23. Maionica, a. 0., S. 1.
12) Kubitschek, Imp. rom. tributim descriptum 106. Maionica,
1. c, S. 12 f.
13) Pauly-Wissowa, R. E. II, 319.
14) C. I. L. V. 7989, 7990, 7992. Aquileiensium restitutor et
conditor.
15) Deren Zusammenstellung bei Maionica, Aquileja 28 ff. und
Fundkarte S. 34. Dazu Patich, Prätorianer-Inschriften, S. 104.
16) Notitia dignitatum Sect. XLII. u. LXV.
32
wie es nicht nur Eusebius verzeichnet, sondern die Pilgerin Sylvia noch im 4. Jahrhundert
anschaulich schildert.1) Die Erinnerungen an den Stand= und Fundort des heiligen Kreuzes,
an das heilige Grab, die geheiligten Plätze auf dem Ölberge oder in Bethlehem verlangten förm-
lich nach Kirchen.
in Rom Auch in Rom wirkte dasselbe Prinzip. So entstanden die konstantinischen Bauten
St. Peter,2) St. Paul, die erste Basilika von S. Lorenzo, später S. Petronilla.3) Außer diesen
zeigen S. demente, S. Giovanni e Paolo,4) die Pudentiana5) oder S. Prisca,6) wie selbst bei der
Umwandlung bestehender Bauten oder ihrer Überbauung derselbe Grundsatz waltete. Damit
war zugleich auch der Titel einer Kirche gegeben.7)
Daneben sah man, und zwar hauptsächlich innerhalb der Stadtmauern, keine Entwürdigung
darin, früher heidnische, private oder öffentliche Hallen nur deshalb, weil sie geräumig und ge-
eignet waren, Scholae,8) Profanbasiliken und selbst Tempel9) in Kirchen umzuwandeln. Diese
behielten den Namen ihres einstigen Besitzers oder Erbauers weiter, wie die Basilica Latera-
nensis, die Sessoriana oder die des Junius Bassus, oder, in ihrer Art, die Ambrosiana in Mai-
land. Es war naturgemäß, daß solchen Bauten an und für sich die Krypta fehlte, wenn sie
auch, wie die letztgenannte, im Verlaufe ihres Bestandes eine solche erhielten. Hier schlössen
sich die Traditionen erst an den Kirchenbau an, bei der anderen Art zu bauen bestanden sie
vorher.
Nun drängt sich uns die Frage auf, ob auch im alten Aquileja, als die Freiheit und das
sofort anwachsende Bedürfnis Kirchen bauen ließen, irgendwelche interessante Traditionen vor-
handen waren, um Baumotive abgeben zu können,
in Aquiieja An dem historischen Charakter des Christentums in Aquileja gegen Ende des 3. Jahr-
hunderts kann nicht gezweifelt werden. So viel sagt uns die Kirchengeschichte Oberitaliens und
es geht auch deutlich aus den Legenden, den Bischofslisten und den wohl mehr als tausend
altchristlichen Inschriftsteinen des dortigen Museums hervor.10) Die Namen der aquilejensischen
Märtyrer werden wir daher für die Baugeschichte zu beachten haben, ohne natürlich aus ihnen
allein die architektonischen Probleme lösen zu wollen. Und als das Christentum nach 312
frei geworden war, mußte die steigende Zahl seiner Anhänger Privatstiftungen wie auch öffent-
liehe Kirchenbauten begünstigen.
Die Gründung der Stadt11) war 181, resp. 169 als Handelsplatz und strategisch wichtiger
Punkt erfolgt. 90 vor Christus Munizipium geworden,12) erhielt Aquileja, unter Augustus stark
vergrößert, vielleicht durch Hadrian oder Antoninus Pius den Rang einer colonia.13) Kaiser
Maximinus Thrax wird ihr Neubegründer14) genannt. Oft weilten, aus alten Urkunden und
Grabschriften von Prätorianern nachweisbar,15) römische Kaiser in ihren Mauern. Von hohen
Beamten, die hier residierten, kennen wir den procurator monetae und gynaeciorum, den prae-
fectus thesaurorum per Italiam und den praefectus classis Venetum.16)
T) Duchesne, Lib. Pontif. I, 191 ff. Cabrol, Les eglises de Jeru-
salem, S. 3—28, mit ausführlicher Literaturangabe. Auf ein Detail der
heiligen Grabkirche kommen wir später eingehend zu sprechen.
2) Über die Abweichung der Lage des Petrusgrabes von der Kir-
chenachse siehe neuestens Grisar, Geschichte Roms, S. 218 (Anm. 3) ff.
3) De Rossi, Bull. 1874, S. 16, Tav. IV, V, wie S. Generosa an-
stoßend an das Grab. De Rossi, Roma sott. III, 681. Kraus, R. E., S. 129.
4) Die Literatur über diese und ähnliche Bauten in Duchesne,
Liber pontif. (passim.). Kirsch, Kultusgebäude, S. 19 — 49. Kraus, Ge-
schichte d. christl. Kunst I, S. 265 ff. Grisar, 1. c.
5) Vgl. Lange, Haus und Halle, S. 283 f. u. 313 ff.
6) Vgl. de Rossi, Bull. 1867, 5, 43 ff 1868, p. 35 f. Die Tradition
führt beide Kirchen auf den Aufenthalt Petri in Rom zurück.
7) Armellini will (Chiese S. 4), auch im Gegensatze zum Orient,
die Gründung der römischen Kirchen im ganzen 4. Jahrhundert aus-
nahmslos auf einen luogo storico mit einer celebrata memoria zurück-
führen. Über die Entstehung der römischen tituli siehe Armellini,
1. c, S. 14 und Grisar, 1. c, S. 146—150.
8) Lange, 1. c.
9) Die Tempel waren bis zum Jahre 342 noch gesetzlich vor
Zerstörung gesichert. Unger, Quellen S. 10. 1. 2. 3. 4. aus: Cod. Theod.
XVI. 10. 3. 4. (ibid. S. 13. 15. f.). Die Übertragung ihrer Einkünfte auf
neuerbaute Kirchen (ibid. S. 12 [6. 7. 8. 10. 11.]) mag manchen Umbau
erklären, wozu der heil. Augustinus auch einen idealsymbolischen Grund
für die Umwandlung der Tempel in Kirchen angibt. Ep. 47 (alias 154)
ed. Migne: Cum vero (templa) in honorem Dei convertuntur, hoc de
illis fit, quod de ipsis hominibus, cum ex sacrilegis et impiis in veram
religionem mutantur.
IO) Savio, Antichi vescovi, S. 1 ff. und La legende des SS. Fau-
stin etc. in Anal. Boll. Tom. XV., S. 47.
") Über das angeblich vorrömische Aquileja vgl. Maionica, Aqui-
leja zur Römerzeit, S. 5 f. Die Motive zur Gründung der Stadt, darunter
die Besorgnis Roms vor Philipp von Mazedonien, siehe bei R. v. Schnei-
der, römische Städte, S. 23. Maionica, a. 0., S. 1.
12) Kubitschek, Imp. rom. tributim descriptum 106. Maionica,
1. c, S. 12 f.
13) Pauly-Wissowa, R. E. II, 319.
14) C. I. L. V. 7989, 7990, 7992. Aquileiensium restitutor et
conditor.
15) Deren Zusammenstellung bei Maionica, Aquileja 28 ff. und
Fundkarte S. 34. Dazu Patich, Prätorianer-Inschriften, S. 104.
16) Notitia dignitatum Sect. XLII. u. LXV.
32