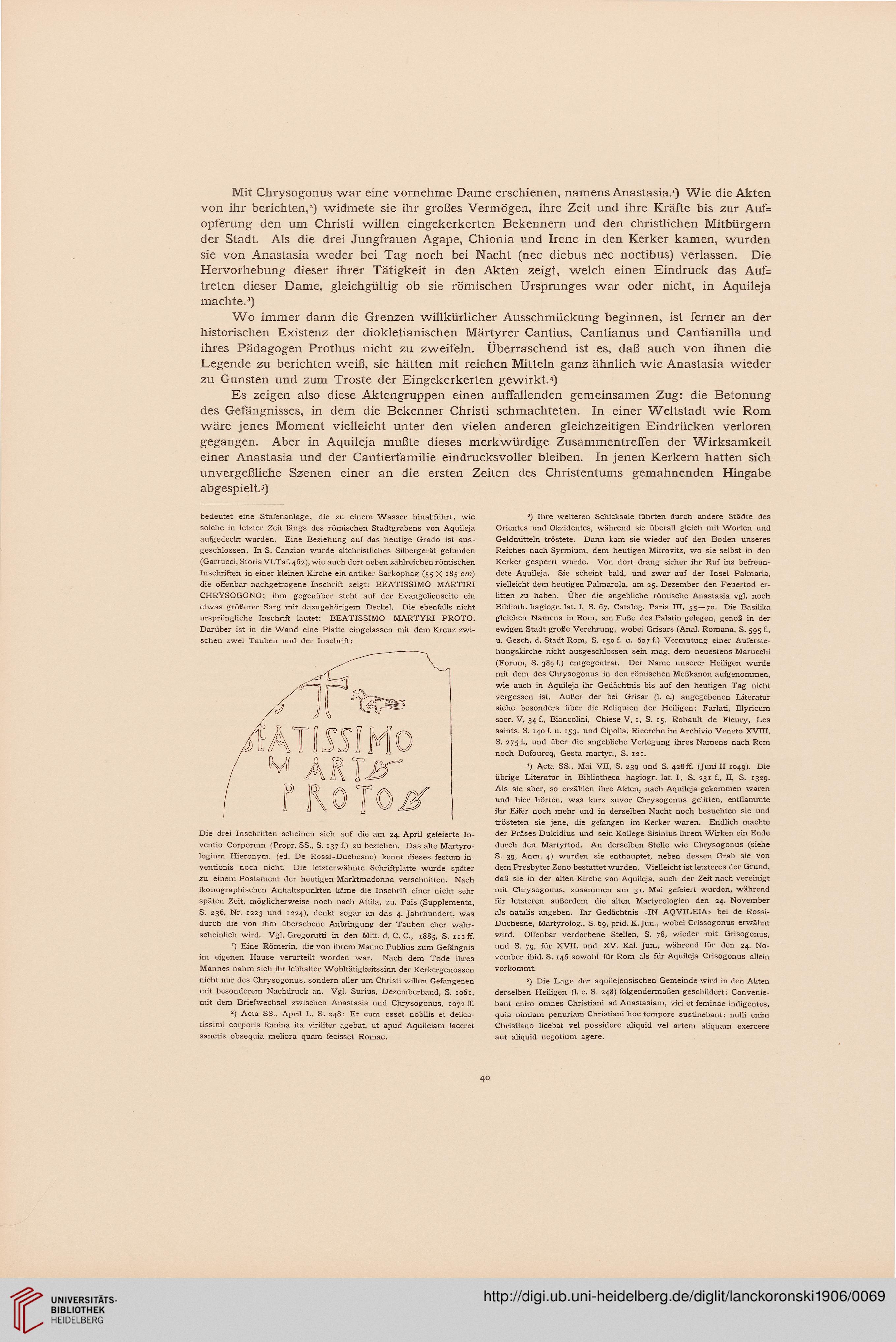Mit Chrysogonus war eine vornehme Dame erschienen, namens Anastasia.1) Wie die Akten
von ihr berichten,2) widmete sie ihr großes Vermögen, ihre Zeit und ihre Kräfte bis zur Auf-
Opferung den um Christi willen eingekerkerten Bekennern und den christlichen Mitbürgern
der Stadt. Als die drei Jungfrauen Agape, Chionia und Irene in den Kerker kamen, wurden
sie von Anastasia weder bei Tag noch bei Nacht (nec diebus nec noctibus) verlassen. Die
Hervorhebung dieser ihrer Tätigkeit in den Akten zeigt, welch einen Eindruck das Auf-
treten dieser Dame, gleichgültig ob sie römischen Ursprunges war oder nicht, in Aquileja
machte.3)
Wo immer dann die Grenzen willkürlicher Ausschmückung beginnen, ist ferner an der
historischen Existenz der diokletianischen Märtyrer Cantius, Cantianus und Cantianilla und
ihres Pädagogen Prothus nicht zu zweifeln. Überraschend ist es, daß auch von ihnen die
Legende zu berichten weiß, sie hätten mit reichen Mitteln ganz ähnlich wie Anastasia wieder
zu Gunsten und zum Tröste der Eingekerkerten gewirkt.4)
Es zeigen also diese Aktengruppen einen auffallenden gemeinsamen Zug: die Betonung
des Gefängnisses, in dem die Bekenner Christi schmachteten. In einer Weltstadt wie Rom
wäre jenes Moment vielleicht unter den vielen anderen gleichzeitigen Eindrücken verloren
gegangen. Aber in Aquileja mußte dieses merkwürdige Zusammentreffen der Wirksamkeit
einer Anastasia und der Cantierfamilie eindrucksvoller bleiben. In jenen Kerkern hatten sich
unvergeßliche Szenen einer an die ersten Zeiten des Christentums gemahnenden Hingabe
abgespielt.5)
bedeutet eine Stufenanlage, die zu einem Wasser hinabführt, wie
solche in letzter Zeit längs des römischen Stadtgrabens von Aquileja
aufgedeckt wurden. Eine Beziehung auf das heutige Grado ist aus-
geschlossen. In S. Canzian wurde altchristliches Silbergerät gefunden
(Garrucci, Storia VI.Taf. 462), wie auch dort neben zahlreichen römischen
Inschriften in einer kleinen Kirche ein antiker Sarkophag (55 X 185 cm)
die offenbar nachgetragene Inschrift zeigt: BEATISSIMO MARTIRI
CHRYSOGONO; ihm gegenüber steht auf der Evangelienseite ein
etwas größerer Sarg mit dazugehörigem Deckel. Die ebenfalls nicht
ursprüngliche Inschrift lautet: BEATISSIMO MARTYRI PROTO.
Darüber ist in die Wand eine Platte eingelassen mit dem Kreuz zwi-
schen zwei Tauben und der Inschrift:
Die drei Inschriften scheinen sich auf die am 24. April gefeierte In-
ventio Corporum (Propr. SS., S. 137 f.) zu beziehen. Das alte Martyro-
logium Hieronym. (ed. De Rossi-Duchesne) kennt dieses festum in-
ventionis noch nicht. Die letzterwähnte Schriftplatte wurde später
zu einem Postament der heutigen Marktmadonna verschnitten. Nach
ikonographischen Anhaltspunkten käme die Inschrift einer nicht sehr
späten Zeit, möglicherweise noch nach Attila, zu. Pais (Supplementa,
S. 236, Nr. 1223 und 1224), denkt sogar an das 4. Jahrhundert, was
durch die von ihm übersehene Anbringung der Tauben eher wahr-
scheinlich wird. Vgl. Gregorutti in den Mitt. d. C. C, 1885, S. 112 ff.
') Eine Römerin, die von ihrem Manne Publius zum Gefängnis
im eigenen Hause verurteilt worden war. Nach dem Tode ihres
Mannes nahm sich ihr lebhafter Wohltätigkeitssinn der Kerkergenossen
nicht nur des Chrysogonus, sondern aller um Christi willen Gefangenen
mit besonderem Nachdruck an. Vgl. Surius, Dezemberband, S. 1061,
mit dem Briefwechsel zwischen Anastasia und Chrysogonus, 1072 ff.
2) Acta SS., April I., S. 248: Et cum esset nobilis et delica-
tissimi corporis femina ita viriliter agebat, ut apud Aquileiam faceret
sanctis obsequia meliora quam fecisset Romae.
3) Ihre weiteren Schicksale führten durch andere Städte des
Orientes und Okzidentes, während sie überall gleich mit Worten und
Geldmitteln tröstete. Dann kam sie wieder auf den Boden unseres
Reiches nach Syrmium, dem heutigen Mitrovitz, wo sie selbst in den
Kerker gesperrt wurde. Von dort drang sicher ihr Ruf ins befreun-
dete Aquileja. Sie scheint bald, und zwar auf der Insel Palmaria,
vielleicht dem heutigen Palmarola, am 25. Dezember den Feuertod er-
litten zu haben. Über die angebliche römische Anastasia vgl. noch
Biblioth. hagiogr. lat. I, S. 67, Catalog. Paris III, 55 — 70. Die Basilika
gleichen Namens in Rom, am Fuße des Palatin gelegen, genoß in der
ewigen Stadt große Verehrung, wobei Grisars (Anal. Romana, S. 595 f.,
u. Gesch. d. Stadt Rom, S. 150 f. u. 607 f.) Vermutung einer Auferste-
hungskirche nicht ausgeschlossen sein mag, dem neuestens Marucchi
(Forum, S. 389 f.) entgegentrat. Der Name unserer Heiligen wurde
mit dem des Chrysogonus in den römischen Meßkanon aufgenommen,
wie auch in Aquileja ihr Gedächtnis bis auf den heutigen Tag nicht
vergessen ist. Außer der bei Grisar (1. c.) angegebenen Literatur
siehe besonders über die Reliquien der Heiligen: Farlati, Illyricum
sacr. V, 34 f., Biancolini, Chiese V, 1, S. 15, Rohault de Fleury, Les
saints, S. 140 f. u. 153, und Cipolla, Ricerche im Archivio Veneto XVIII,
S. 275 f., und über die angebliche Verlegung ihres Namens nach Rom
noch Dufourcq, Gesta martyr., S. 121.
4) Acta SS., Mai VII, S. 239 und S. 428 fr. (Juni II 1049). Die
übrige Literatur in Bibliotheca hagiogr. lat. I, S. 231 f., II, S. 1329.
Als sie aber, so erzählen ihre Akten, nach Aquileja gekommen waren
und hier hörten, was kurz zuvor Chrysogonus gelitten, entflammte
ihr Eifer noch mehr und in derselben Nacht noch besuchten sie und
trösteten sie jene, die gefangen im Kerker waren. Endlich machte
der Präses Dulcidius und sein Kollege Sisinius ihrem Wirken ein Ende
durch den Martyrtod. An derselben Stelle wie Chrysogonus (siehe
S. 39, Anm. 4) wurden sie enthauptet, neben dessen Grab sie von
dem Presbyter Zeno bestattet wurden. Vielleicht ist letzteres der Grund,
daß sie in der alten Kirche von Aquileja, auch der Zeit nach vereinigt
mit Chrysogonus, zusammen am 31. Mai gefeiert wurden, während
für letzteren außerdem die alten Martyrologien den 24. November
als natalis angeben. Ihr Gedächtnis «IN AQVILEIA» bei de Rossi-
Duchesne, Martyrolog., S. 69, prid. K.Jun., wobei Crissogonus erwähnt
wird. Offenbar verdorbene Stellen, S. 78, wieder mit Grisogonus,
und S. 79, für XVII. und XV. Kai. Jun., während für den 24. No-
vember ibid. S. 146 sowohl für Rom als für Aquileja Crisogonus allein
vorkommt.
5) Die Lage der aquilejensischen Gemeinde wird in den Akten
derselben Heiligen (1. c. S. 248) folgendermaßen geschildert: Convenie-
bant enim omnes Christiani ad Anastasiam, viri et feminae indigentes,
quia nimiam penuriam Christiani hoc tempore sustinebant: nulli enim
Christiano licebat vel possidere aliquid vel artem aliquam exercere
aut aliquid negotium agere.
40
von ihr berichten,2) widmete sie ihr großes Vermögen, ihre Zeit und ihre Kräfte bis zur Auf-
Opferung den um Christi willen eingekerkerten Bekennern und den christlichen Mitbürgern
der Stadt. Als die drei Jungfrauen Agape, Chionia und Irene in den Kerker kamen, wurden
sie von Anastasia weder bei Tag noch bei Nacht (nec diebus nec noctibus) verlassen. Die
Hervorhebung dieser ihrer Tätigkeit in den Akten zeigt, welch einen Eindruck das Auf-
treten dieser Dame, gleichgültig ob sie römischen Ursprunges war oder nicht, in Aquileja
machte.3)
Wo immer dann die Grenzen willkürlicher Ausschmückung beginnen, ist ferner an der
historischen Existenz der diokletianischen Märtyrer Cantius, Cantianus und Cantianilla und
ihres Pädagogen Prothus nicht zu zweifeln. Überraschend ist es, daß auch von ihnen die
Legende zu berichten weiß, sie hätten mit reichen Mitteln ganz ähnlich wie Anastasia wieder
zu Gunsten und zum Tröste der Eingekerkerten gewirkt.4)
Es zeigen also diese Aktengruppen einen auffallenden gemeinsamen Zug: die Betonung
des Gefängnisses, in dem die Bekenner Christi schmachteten. In einer Weltstadt wie Rom
wäre jenes Moment vielleicht unter den vielen anderen gleichzeitigen Eindrücken verloren
gegangen. Aber in Aquileja mußte dieses merkwürdige Zusammentreffen der Wirksamkeit
einer Anastasia und der Cantierfamilie eindrucksvoller bleiben. In jenen Kerkern hatten sich
unvergeßliche Szenen einer an die ersten Zeiten des Christentums gemahnenden Hingabe
abgespielt.5)
bedeutet eine Stufenanlage, die zu einem Wasser hinabführt, wie
solche in letzter Zeit längs des römischen Stadtgrabens von Aquileja
aufgedeckt wurden. Eine Beziehung auf das heutige Grado ist aus-
geschlossen. In S. Canzian wurde altchristliches Silbergerät gefunden
(Garrucci, Storia VI.Taf. 462), wie auch dort neben zahlreichen römischen
Inschriften in einer kleinen Kirche ein antiker Sarkophag (55 X 185 cm)
die offenbar nachgetragene Inschrift zeigt: BEATISSIMO MARTIRI
CHRYSOGONO; ihm gegenüber steht auf der Evangelienseite ein
etwas größerer Sarg mit dazugehörigem Deckel. Die ebenfalls nicht
ursprüngliche Inschrift lautet: BEATISSIMO MARTYRI PROTO.
Darüber ist in die Wand eine Platte eingelassen mit dem Kreuz zwi-
schen zwei Tauben und der Inschrift:
Die drei Inschriften scheinen sich auf die am 24. April gefeierte In-
ventio Corporum (Propr. SS., S. 137 f.) zu beziehen. Das alte Martyro-
logium Hieronym. (ed. De Rossi-Duchesne) kennt dieses festum in-
ventionis noch nicht. Die letzterwähnte Schriftplatte wurde später
zu einem Postament der heutigen Marktmadonna verschnitten. Nach
ikonographischen Anhaltspunkten käme die Inschrift einer nicht sehr
späten Zeit, möglicherweise noch nach Attila, zu. Pais (Supplementa,
S. 236, Nr. 1223 und 1224), denkt sogar an das 4. Jahrhundert, was
durch die von ihm übersehene Anbringung der Tauben eher wahr-
scheinlich wird. Vgl. Gregorutti in den Mitt. d. C. C, 1885, S. 112 ff.
') Eine Römerin, die von ihrem Manne Publius zum Gefängnis
im eigenen Hause verurteilt worden war. Nach dem Tode ihres
Mannes nahm sich ihr lebhafter Wohltätigkeitssinn der Kerkergenossen
nicht nur des Chrysogonus, sondern aller um Christi willen Gefangenen
mit besonderem Nachdruck an. Vgl. Surius, Dezemberband, S. 1061,
mit dem Briefwechsel zwischen Anastasia und Chrysogonus, 1072 ff.
2) Acta SS., April I., S. 248: Et cum esset nobilis et delica-
tissimi corporis femina ita viriliter agebat, ut apud Aquileiam faceret
sanctis obsequia meliora quam fecisset Romae.
3) Ihre weiteren Schicksale führten durch andere Städte des
Orientes und Okzidentes, während sie überall gleich mit Worten und
Geldmitteln tröstete. Dann kam sie wieder auf den Boden unseres
Reiches nach Syrmium, dem heutigen Mitrovitz, wo sie selbst in den
Kerker gesperrt wurde. Von dort drang sicher ihr Ruf ins befreun-
dete Aquileja. Sie scheint bald, und zwar auf der Insel Palmaria,
vielleicht dem heutigen Palmarola, am 25. Dezember den Feuertod er-
litten zu haben. Über die angebliche römische Anastasia vgl. noch
Biblioth. hagiogr. lat. I, S. 67, Catalog. Paris III, 55 — 70. Die Basilika
gleichen Namens in Rom, am Fuße des Palatin gelegen, genoß in der
ewigen Stadt große Verehrung, wobei Grisars (Anal. Romana, S. 595 f.,
u. Gesch. d. Stadt Rom, S. 150 f. u. 607 f.) Vermutung einer Auferste-
hungskirche nicht ausgeschlossen sein mag, dem neuestens Marucchi
(Forum, S. 389 f.) entgegentrat. Der Name unserer Heiligen wurde
mit dem des Chrysogonus in den römischen Meßkanon aufgenommen,
wie auch in Aquileja ihr Gedächtnis bis auf den heutigen Tag nicht
vergessen ist. Außer der bei Grisar (1. c.) angegebenen Literatur
siehe besonders über die Reliquien der Heiligen: Farlati, Illyricum
sacr. V, 34 f., Biancolini, Chiese V, 1, S. 15, Rohault de Fleury, Les
saints, S. 140 f. u. 153, und Cipolla, Ricerche im Archivio Veneto XVIII,
S. 275 f., und über die angebliche Verlegung ihres Namens nach Rom
noch Dufourcq, Gesta martyr., S. 121.
4) Acta SS., Mai VII, S. 239 und S. 428 fr. (Juni II 1049). Die
übrige Literatur in Bibliotheca hagiogr. lat. I, S. 231 f., II, S. 1329.
Als sie aber, so erzählen ihre Akten, nach Aquileja gekommen waren
und hier hörten, was kurz zuvor Chrysogonus gelitten, entflammte
ihr Eifer noch mehr und in derselben Nacht noch besuchten sie und
trösteten sie jene, die gefangen im Kerker waren. Endlich machte
der Präses Dulcidius und sein Kollege Sisinius ihrem Wirken ein Ende
durch den Martyrtod. An derselben Stelle wie Chrysogonus (siehe
S. 39, Anm. 4) wurden sie enthauptet, neben dessen Grab sie von
dem Presbyter Zeno bestattet wurden. Vielleicht ist letzteres der Grund,
daß sie in der alten Kirche von Aquileja, auch der Zeit nach vereinigt
mit Chrysogonus, zusammen am 31. Mai gefeiert wurden, während
für letzteren außerdem die alten Martyrologien den 24. November
als natalis angeben. Ihr Gedächtnis «IN AQVILEIA» bei de Rossi-
Duchesne, Martyrolog., S. 69, prid. K.Jun., wobei Crissogonus erwähnt
wird. Offenbar verdorbene Stellen, S. 78, wieder mit Grisogonus,
und S. 79, für XVII. und XV. Kai. Jun., während für den 24. No-
vember ibid. S. 146 sowohl für Rom als für Aquileja Crisogonus allein
vorkommt.
5) Die Lage der aquilejensischen Gemeinde wird in den Akten
derselben Heiligen (1. c. S. 248) folgendermaßen geschildert: Convenie-
bant enim omnes Christiani ad Anastasiam, viri et feminae indigentes,
quia nimiam penuriam Christiani hoc tempore sustinebant: nulli enim
Christiano licebat vel possidere aliquid vel artem aliquam exercere
aut aliquid negotium agere.
40