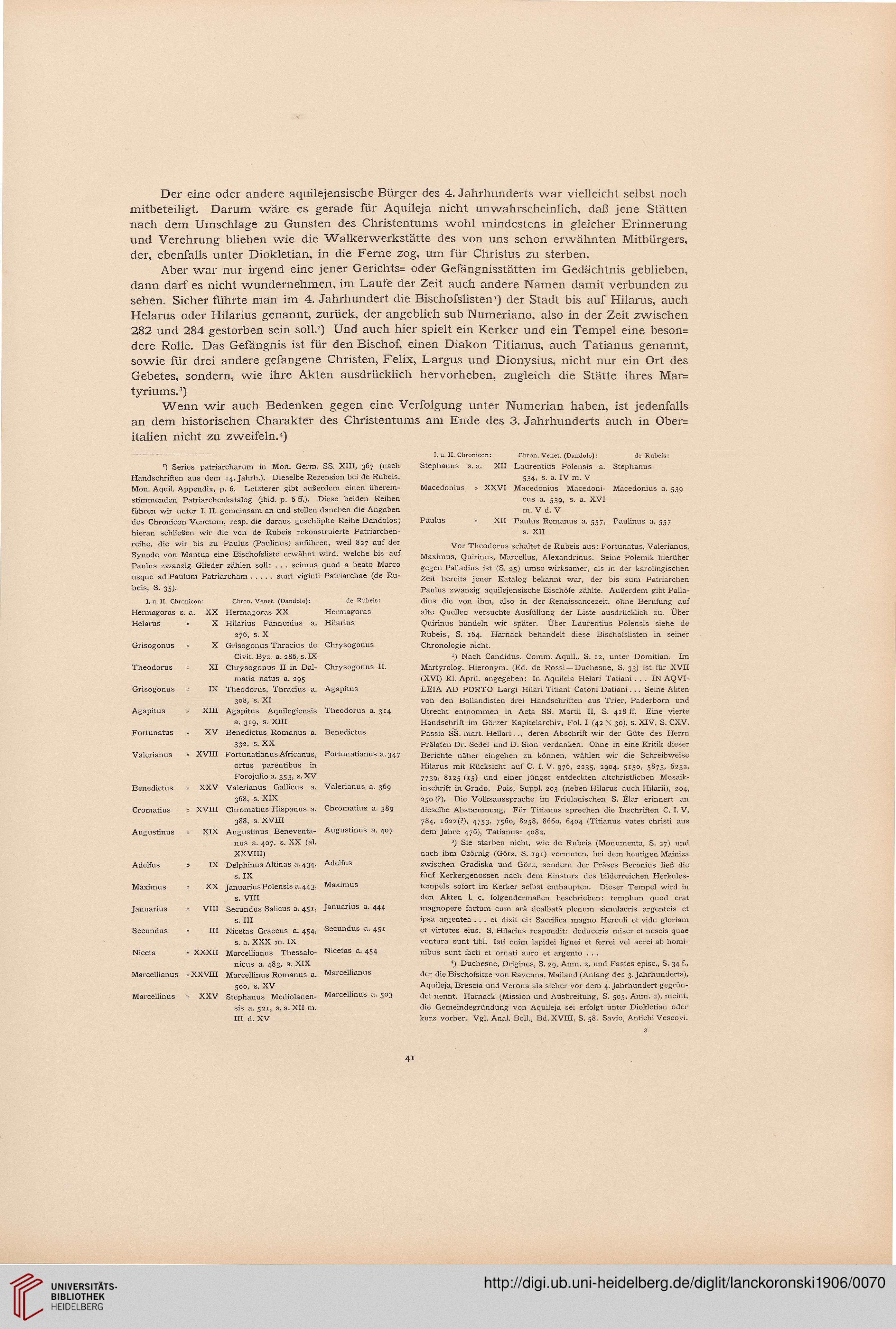Der eine oder andere aquilejensische Bürger des 4. Jahrhunderts war vielleicht selbst noch
mitbeteiligt. Darum wäre es gerade für Aquileja nicht unwahrscheinlich, daß jene Stätten
nach dem Umschlage zu Gunsten des Christentums wohl mindestens in gleicher Erinnerung
und Verehrung blieben wie die Walkerwerkstätte des von uns schon erwähnten Mitbürgers,
der, ebenfalls unter Diokletian, in die Ferne zog, um für Christus zu sterben.
Aber war nur irgend eine jener Gerichts= oder Gefängnisstätten im Gedächtnis geblieben,
dann darf es nicht wundernehmen, im Laufe der Zeit auch andere Namen damit verbunden zu
sehen. Sicher führte man im 4. Jahrhundert die Bischofslisten1) der Stadt bis auf Hilarus, auch
Helarus oder Hilarius genannt, zurück, der angeblich sub Numeriano, also in der Zeit zwischen
282 und 284 gestorben sein soll.2) Und auch hier spielt ein Kerker und ein Tempel eine beson-
dere Rolle. Das Gefängnis ist für den Bischof, einen Diakon Titianus, auch Tatianus genannt,
sowie für drei andere gefangene Christen, Felix, Largus und Dionysius, nicht nur ein Ort des
Gebetes, sondern, wie ihre Akten ausdrücklich hervorheben, zugleich die Stätte ihres Mar-
tyriums.3)
Wenn wir auch Bedenken gegen eine Verfolgung unter Numerian haben, ist jedenfalls
an dem historischen Charakter des Christentums am Ende des 3. Jahrhunderts auch in Ober-
italien nicht zu zweifeln.4)
*) Series patriarcharum in Mon. Germ. SS. XIII, 367 (nach
Handschriften aus dem 14. Jahrh.). Dieselbe Rezension bei de Rubeis,
Mon. Aquil. Appendix, p. 6. Letzterer gibt außerdem einen überein-
stimmenden Patriarchenkatalog (ibid. p. 6 ff.). Diese beiden Reihen
führen wir unter I. II. gemeinsam an und stellen daneben die Angaben
des Chronicon Venetum, resp. die daraus geschöpfte Reihe Dandolos;
hieran schließen wir die von de Rubeis rekonstruierte Patriarchen-
reihe, die wir bis zu Paulus (Paulinus) anführen, weil 827 auf der
Synode von Mantua eine Bischofsliste erwähnt wird, welche bis auf
Paulus zwanzig Glieder zählen soll: . . . scimus quod a beato Marco
usque ad Paulum Patriarcham.....sunt viginti Patriarchae (de Ru-
beis, S. 35).
I. u. II. Chronicon:
Chron. Venet. (Dandolo):
de Rubeis:
Hermagoras
s. a. XX
Hermagoras XX
Hermagoras
Helarus
X
Hilarius Pannonius a.
276, s. X
Hilarius
Grisogonus
» X
Grisogonus Thracius de
Civit. Byz. a. 286, s.IX
Chrysogonus
Theodorus
XI
Chrysogonus II in Dal-
matia natus a. 295
Chrysogonus II.
Grisogonus
IX
Theodorus, Thracius a.
308, s. XI
Agapitus
Agapitus
XIII
Agapitus Aquilegiensis
a. 319, s. XIII
Theodorus a. 314
Fortunatus
XV
Benedictus Romanus a.
332, s. XX
Benedictus
Valerianus
» XVIII
Fortunatianus Africanus,
ortus parentibus in
Forojulio a. 353, s.XV
Fortunatianus a. 347
Benedictus
» XXV
Valerianus Gallicus a.
368, s. XIX
Valerianus a. 369
Cromatius
» XVIII
Chromatius Hispanus a.
388, s. XVIII
Chromatius a. 389
Augustinus
» XIX
Augustinus Beneventa-
nus a. 407, s. XX (al.
XXVIII)
Augustinus a. 407
Adelfus
IX
Delphinus Altinas a. 434,
s. IX
Adelfus
Maximus
» XX
Januarius Polensis a.443,
s. VIII
Maximus
Januarius
» VIII
Secundus Salicus a. 451,
s. III
Januarius a. 444
Secundus
III
Nicetas Graecus a. 454,
s. a. XXX m. IX
Secundus a. 451
Niceta
» XXXII
Marcellianus Thessalo-
nicus a. 483, s. XIX
Nicetas a. 454
Marcellianus
» XXVIII
Marcellinus Romanus a.
500, s. XV
Marcellianus
Marcellinus
» XXV
Stephanus Mediolanen-
sis a. 521, s. a. XII m.
III d. XV
Marcellinus a. 503
I. u. II. Chronicon:
Stephanus s. a. XII
Macedonius
Paulus
XXVI
XII
Chron. Venet. (Dandolo):
Laurentius Polensis a.
534, s. a. IV m. V
Macedonius Macedoni-
cus a. 53g, s. a. XVI
m. V d. V
Paulus Romanus a. 557,
s. XII
de Rubeis:
Stephanus
Macedonius a. 539
Paulinus a. 557
Vor Theodorus schaltet de Rubeis aus: Fortunatus, Valerianus,
Maximus, Quirinus, Marcellus, Alexandrinus. Seine Polemik hierüber
gegen Palladius ist (S. 25) umso wirksamer, als in der karolingischen
Zeit bereits jener Katalog bekannt war, der bis zum Patriarchen
Paulus zwanzig aquilejensische Bischöfe zählte. Außerdem gibt Palla-
dius die von ihm, also in der Renaissancezeit, ohne Berufung auf
alte Quellen versuchte Ausfüllung der Liste ausdrücklich zu. Über
Quirinus handeln wir später. Über Laurentius Polensis siehe de
Rubeis, S. 164. Harnack behandelt diese Bischofslisten in seiner
Chronologie nicht.
2) Nach Candidus, Comm. Aquil., S. 12, unter Domitian. Im
Martyrolog. Hieronym. (Ed. de Rossi — Duchesne, S. 33) ist für XVII
(XVI) Kl. April, angegeben: In Aquileia Helari Tatiani ... IN AQVI-
LEIA AD PORTO Largi Hilari Titiani Catoni Datiani. .. Seine Akten
von den Bollandisten drei Handschriften aus Trier, Paderborn und
Utrecht entnommen in Acta SS. Martii II, S. 418 ff. Eine vierte
Handschrift im Görzer Kapitelarchiv, Fol. I (42 X 30), s. XIV, S. CXV.
Passio SS. mart. Hellari. ., deren Abschrift wir der Güte des Herrn
Prälaten Dr. Sedei und D. Sion verdanken. Ohne in eine Kritik dieser
Berichte näher eingehen zu können, wählen wir die Schreibweise
Hilarus mit Rücksicht auf C. I.V. 976, 2235, 2904, 5150, 5873, 6232,
773g, 8125 (15) und einer jüngst entdeckten altchristlichen Mosaik-
inschrift in Grado. Pais, Suppl. 203 (neben Hilarus auch Hilarii), 204,
250 (?). Die Volksaussprache im Friulanischen S. Elar erinnert an
dieselbe Abstammung. Für Titianus sprechen die Inschriften C. I. V,
784, 1622(?), 4753, 7560, 8258, 8660, 6404 (Titianus vates Christi aus
dem Jahre 476), Tatianus: 4082.
3) Sie starben nicht, wie de Rubeis (Monumenta, S. 27) und
nach ihm Czörnig (Görz, S. 191) vermuten, bei dem heutigen Mainiza
zwischen Gradiska und Görz, sondern der Präses Beronius ließ die
fünf Kerkergenossen nach dem Einsturz des bilderreichen Herkules-
tempels sofort im Kerker selbst enthaupten. Dieser Tempel wird in
den Akten 1. c. folgendermaßen beschrieben: templum quod erat
magnopere factum cum arä dealbatä plenum simulacris argenteis et
ipsa argentea ... et dixit ei: Sacrifica magno Herculi et vide gloriam
et virtutes eius. S. Hilarius respondit: deduceris miser et nescis quae
Ventura sunt tibi. Isti enim lapidei lignei et ferrei vel aerei ab homi-
nibus sunt facti et ornati auro et argento . . .
4) Duchesne, Origines, S. 29, Anm. 2, und Fastes episc, S. 34 f.,
der die Bischofsitze von Ravenna, Mailand (Anfang des 3. Jahrhunderts),
Aquileja, Brescia und Verona als sicher vor dem 4. Jahrhundert gegrün-
det nennt. Harnack (Mission und Ausbreitung, S. 505, Anm. 2), meint,
die Gemeindegründung von Aquileja sei erfolgt unter Diokletian oder
kurz vorher. Vgl. Anal. Boll., Bd. XVIII, S. 58. Savio, Antichi Vescovi.
8
41
mitbeteiligt. Darum wäre es gerade für Aquileja nicht unwahrscheinlich, daß jene Stätten
nach dem Umschlage zu Gunsten des Christentums wohl mindestens in gleicher Erinnerung
und Verehrung blieben wie die Walkerwerkstätte des von uns schon erwähnten Mitbürgers,
der, ebenfalls unter Diokletian, in die Ferne zog, um für Christus zu sterben.
Aber war nur irgend eine jener Gerichts= oder Gefängnisstätten im Gedächtnis geblieben,
dann darf es nicht wundernehmen, im Laufe der Zeit auch andere Namen damit verbunden zu
sehen. Sicher führte man im 4. Jahrhundert die Bischofslisten1) der Stadt bis auf Hilarus, auch
Helarus oder Hilarius genannt, zurück, der angeblich sub Numeriano, also in der Zeit zwischen
282 und 284 gestorben sein soll.2) Und auch hier spielt ein Kerker und ein Tempel eine beson-
dere Rolle. Das Gefängnis ist für den Bischof, einen Diakon Titianus, auch Tatianus genannt,
sowie für drei andere gefangene Christen, Felix, Largus und Dionysius, nicht nur ein Ort des
Gebetes, sondern, wie ihre Akten ausdrücklich hervorheben, zugleich die Stätte ihres Mar-
tyriums.3)
Wenn wir auch Bedenken gegen eine Verfolgung unter Numerian haben, ist jedenfalls
an dem historischen Charakter des Christentums am Ende des 3. Jahrhunderts auch in Ober-
italien nicht zu zweifeln.4)
*) Series patriarcharum in Mon. Germ. SS. XIII, 367 (nach
Handschriften aus dem 14. Jahrh.). Dieselbe Rezension bei de Rubeis,
Mon. Aquil. Appendix, p. 6. Letzterer gibt außerdem einen überein-
stimmenden Patriarchenkatalog (ibid. p. 6 ff.). Diese beiden Reihen
führen wir unter I. II. gemeinsam an und stellen daneben die Angaben
des Chronicon Venetum, resp. die daraus geschöpfte Reihe Dandolos;
hieran schließen wir die von de Rubeis rekonstruierte Patriarchen-
reihe, die wir bis zu Paulus (Paulinus) anführen, weil 827 auf der
Synode von Mantua eine Bischofsliste erwähnt wird, welche bis auf
Paulus zwanzig Glieder zählen soll: . . . scimus quod a beato Marco
usque ad Paulum Patriarcham.....sunt viginti Patriarchae (de Ru-
beis, S. 35).
I. u. II. Chronicon:
Chron. Venet. (Dandolo):
de Rubeis:
Hermagoras
s. a. XX
Hermagoras XX
Hermagoras
Helarus
X
Hilarius Pannonius a.
276, s. X
Hilarius
Grisogonus
» X
Grisogonus Thracius de
Civit. Byz. a. 286, s.IX
Chrysogonus
Theodorus
XI
Chrysogonus II in Dal-
matia natus a. 295
Chrysogonus II.
Grisogonus
IX
Theodorus, Thracius a.
308, s. XI
Agapitus
Agapitus
XIII
Agapitus Aquilegiensis
a. 319, s. XIII
Theodorus a. 314
Fortunatus
XV
Benedictus Romanus a.
332, s. XX
Benedictus
Valerianus
» XVIII
Fortunatianus Africanus,
ortus parentibus in
Forojulio a. 353, s.XV
Fortunatianus a. 347
Benedictus
» XXV
Valerianus Gallicus a.
368, s. XIX
Valerianus a. 369
Cromatius
» XVIII
Chromatius Hispanus a.
388, s. XVIII
Chromatius a. 389
Augustinus
» XIX
Augustinus Beneventa-
nus a. 407, s. XX (al.
XXVIII)
Augustinus a. 407
Adelfus
IX
Delphinus Altinas a. 434,
s. IX
Adelfus
Maximus
» XX
Januarius Polensis a.443,
s. VIII
Maximus
Januarius
» VIII
Secundus Salicus a. 451,
s. III
Januarius a. 444
Secundus
III
Nicetas Graecus a. 454,
s. a. XXX m. IX
Secundus a. 451
Niceta
» XXXII
Marcellianus Thessalo-
nicus a. 483, s. XIX
Nicetas a. 454
Marcellianus
» XXVIII
Marcellinus Romanus a.
500, s. XV
Marcellianus
Marcellinus
» XXV
Stephanus Mediolanen-
sis a. 521, s. a. XII m.
III d. XV
Marcellinus a. 503
I. u. II. Chronicon:
Stephanus s. a. XII
Macedonius
Paulus
XXVI
XII
Chron. Venet. (Dandolo):
Laurentius Polensis a.
534, s. a. IV m. V
Macedonius Macedoni-
cus a. 53g, s. a. XVI
m. V d. V
Paulus Romanus a. 557,
s. XII
de Rubeis:
Stephanus
Macedonius a. 539
Paulinus a. 557
Vor Theodorus schaltet de Rubeis aus: Fortunatus, Valerianus,
Maximus, Quirinus, Marcellus, Alexandrinus. Seine Polemik hierüber
gegen Palladius ist (S. 25) umso wirksamer, als in der karolingischen
Zeit bereits jener Katalog bekannt war, der bis zum Patriarchen
Paulus zwanzig aquilejensische Bischöfe zählte. Außerdem gibt Palla-
dius die von ihm, also in der Renaissancezeit, ohne Berufung auf
alte Quellen versuchte Ausfüllung der Liste ausdrücklich zu. Über
Quirinus handeln wir später. Über Laurentius Polensis siehe de
Rubeis, S. 164. Harnack behandelt diese Bischofslisten in seiner
Chronologie nicht.
2) Nach Candidus, Comm. Aquil., S. 12, unter Domitian. Im
Martyrolog. Hieronym. (Ed. de Rossi — Duchesne, S. 33) ist für XVII
(XVI) Kl. April, angegeben: In Aquileia Helari Tatiani ... IN AQVI-
LEIA AD PORTO Largi Hilari Titiani Catoni Datiani. .. Seine Akten
von den Bollandisten drei Handschriften aus Trier, Paderborn und
Utrecht entnommen in Acta SS. Martii II, S. 418 ff. Eine vierte
Handschrift im Görzer Kapitelarchiv, Fol. I (42 X 30), s. XIV, S. CXV.
Passio SS. mart. Hellari. ., deren Abschrift wir der Güte des Herrn
Prälaten Dr. Sedei und D. Sion verdanken. Ohne in eine Kritik dieser
Berichte näher eingehen zu können, wählen wir die Schreibweise
Hilarus mit Rücksicht auf C. I.V. 976, 2235, 2904, 5150, 5873, 6232,
773g, 8125 (15) und einer jüngst entdeckten altchristlichen Mosaik-
inschrift in Grado. Pais, Suppl. 203 (neben Hilarus auch Hilarii), 204,
250 (?). Die Volksaussprache im Friulanischen S. Elar erinnert an
dieselbe Abstammung. Für Titianus sprechen die Inschriften C. I. V,
784, 1622(?), 4753, 7560, 8258, 8660, 6404 (Titianus vates Christi aus
dem Jahre 476), Tatianus: 4082.
3) Sie starben nicht, wie de Rubeis (Monumenta, S. 27) und
nach ihm Czörnig (Görz, S. 191) vermuten, bei dem heutigen Mainiza
zwischen Gradiska und Görz, sondern der Präses Beronius ließ die
fünf Kerkergenossen nach dem Einsturz des bilderreichen Herkules-
tempels sofort im Kerker selbst enthaupten. Dieser Tempel wird in
den Akten 1. c. folgendermaßen beschrieben: templum quod erat
magnopere factum cum arä dealbatä plenum simulacris argenteis et
ipsa argentea ... et dixit ei: Sacrifica magno Herculi et vide gloriam
et virtutes eius. S. Hilarius respondit: deduceris miser et nescis quae
Ventura sunt tibi. Isti enim lapidei lignei et ferrei vel aerei ab homi-
nibus sunt facti et ornati auro et argento . . .
4) Duchesne, Origines, S. 29, Anm. 2, und Fastes episc, S. 34 f.,
der die Bischofsitze von Ravenna, Mailand (Anfang des 3. Jahrhunderts),
Aquileja, Brescia und Verona als sicher vor dem 4. Jahrhundert gegrün-
det nennt. Harnack (Mission und Ausbreitung, S. 505, Anm. 2), meint,
die Gemeindegründung von Aquileja sei erfolgt unter Diokletian oder
kurz vorher. Vgl. Anal. Boll., Bd. XVIII, S. 58. Savio, Antichi Vescovi.
8
41