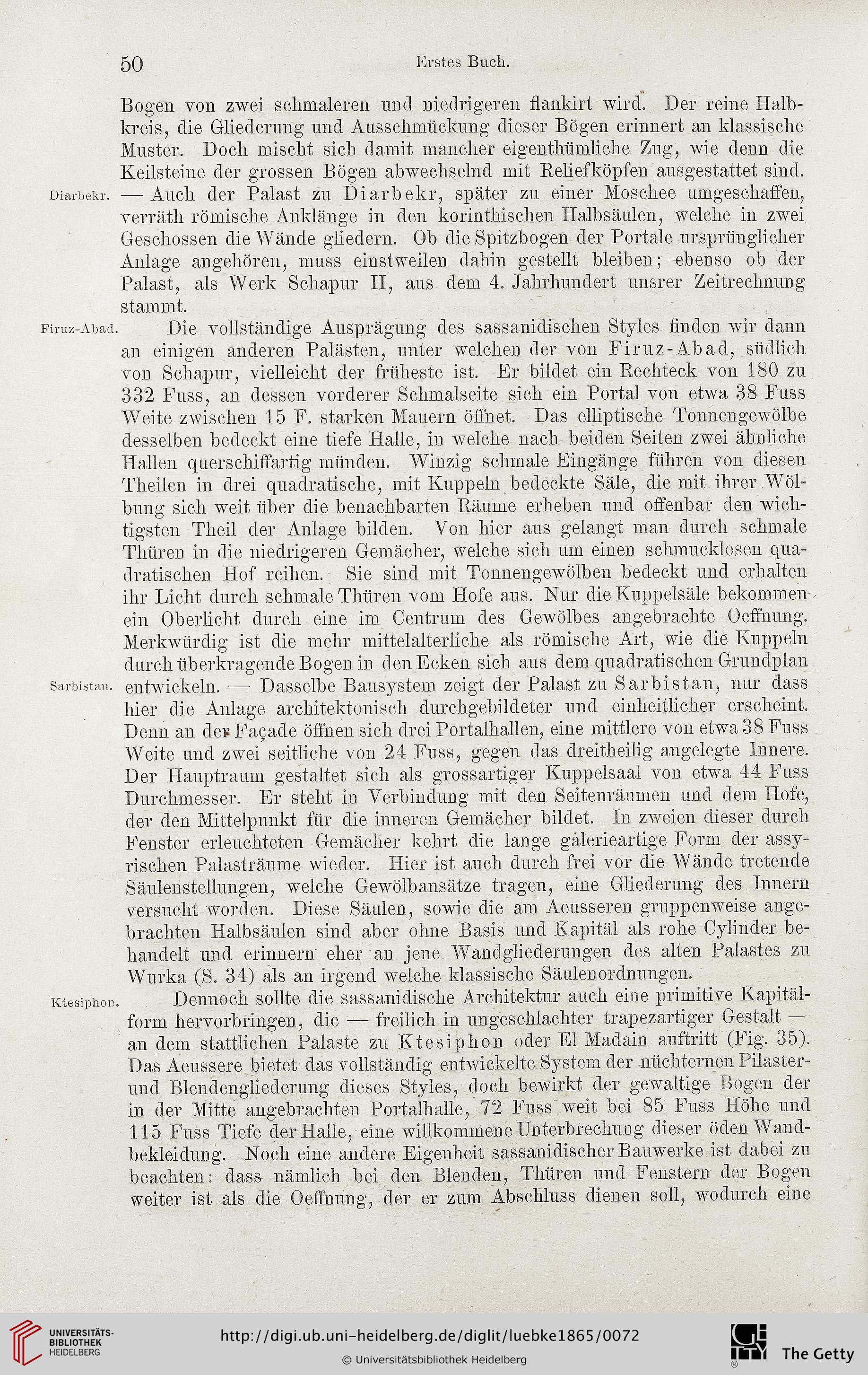50
Erstes Buch.
Bogen von zwei schmaleren lind niedrigeren flankirt wird. Der reine Halb-
kreis, die Gliederung und Ausschmückung dieser Bögen erinnert an klassische
Muster. Doch mischt sich damit mancher eigenthtimliche Zug, wie denn die
Keilsteine der grossen Bögen abwechselnd mit Reliefköpfen ausgestattet sind.
Diarbekr. —Auch der Palast zu Diarbekr, später zu einer Moschee umgeschaffen,
verrätli römische Anklänge in den korinthischen Halbsäulen, welche in zwei
Geschossen die Wände gliedern. Ob die Spitzbogen der Portale ursprünglicher
Anlage angehören, muss einstweilen dahin gestellt bleiben; ebenso ob der
Palast, als Werk Schapur II, aus dem 4. Jahrhundert unsrer Zeitrechnung
stammt.
Fimz-Abad. Die vollständige Ausprägung des sassanidischen Styles finden wir dann
an einigen anderen Palästen, unter welchen der von Firuz-Abad, südlich
von Schapur, vielleicht der früheste ist. Er bildet ein Rechteck von ISO zu
332 Fuss, an dessen vorderer Schmalseite sich ein Portal von etwa 38 Fuss
Weite zwischen 15 F. starken Mauern öffnet. Das elliptische Tonnengewölbe
desselben bedeckt eine tiefe Halle, in welche nach beiden Seiten zwei ähnliche
Hallen querschiffartig münden. Winzig schmale Eingänge führen von diesen
Theilen in drei quadratische, mit Kuppeln bedeckte Säle, die mit ihrer Wöl-
bung sich weit über die benachbarten Räume erheben und offenbar den wich-
tigsten Th eil der Anlage bilden. Von hier aus gelangt man durch schmale
Thiiren in die niedrigeren Gemächer, welche sich um einen schmucklosen qua-
dratischen Hof reihen. Sie sind mit Tonnengewölben bedeckt und erhalten
ihr Licht durch schmale Tliiiren vom Hofe aus. Nur die Kuppelsäle bekommen
ein Oberlicht durch eine im Centrum des Gewölbes angebrachte Oeffnnng.
Merkwürdig ist die mehr mittelalterliche als römische Art, wie die Kuppeln
durch überkragende Bogen in den Ecken sich aus dem quadratischen Grundplan
Sarbistau. entwickeln. — Dasselbe Bausystem zeigt der Palast zu Sarbistan, nur dass
hier die Anlage architektonisch durchgebildeter und einheitlicher erscheint.
Denn an der Fagade öffnen sich drei Portalhallen, eine mittlere von etwa 38 Fuss
Weite und zwei seitliche von 24 Fuss, gegen das dreitheilig angelegte Innere.
Der Hauptraum gestaltet sich als grossartiger Kuppelsaal von etwa 44 Fuss
Durchmesser. Er steht in Verbindung mit den Seitenräumen und dem Hofe,
der den Mittelpunkt für die inneren Gemächer bildet. In zweien dieser durch
Fenster erleuchteten Gemächer kehrt die lange gälerieartige Form der assy-
rischen Palasträume wieder. Hier ist auch durch frei vor die Wände tretende
Särgen Stellungen, welche Gewölbansätze tragen, eine Gliederung des Innern
versucht worden. Diese Säulen, sowie die am Aeusseren gruppenweise ange-
brachten Halbsäulen sind aber ohne Basis und Kapital als rohe Cylinder be-
handelt und erinnern eher an jene Wandgliederungen des alten Palastes zu
Wurka (S. 34) als an irgend welche klassische Säulenordnungen.
Ktesiphon. Dennoch sollte die sassanidisclie Architektur auch eine primitive Kapitäl-
form hervorbringen, die — freilich in ungeschlachter trapezartiger Gestalt -fr
an dem stattlichen Palaste zu Ktesiphon oder El Madain auftritt (Fig. 35).
Das Aeussere bietet das vollständig entwickelte System der nüchternen Pilaster-
und Blendengliederung dieses Styles, doch bewirkt der gewaltige Bogen der
in der Mitte angebrachten Portalhalle, 72 Fuss weit bei 85 Fuss Höhe und
115 Fuss Tiefe der Halle, eine willkommene Unterbrechung dieser öden Wand-
bekleidung. Noch eine andere Eigenheit sassanidischer Bauwerke ist dabei zu
beachten: dass nämlich bei den Blenden, Thüren und Fenstern der Bogen
weiter ist als die Oeffnnng, der er zum Abschluss dienen soll, wodurch eine
Erstes Buch.
Bogen von zwei schmaleren lind niedrigeren flankirt wird. Der reine Halb-
kreis, die Gliederung und Ausschmückung dieser Bögen erinnert an klassische
Muster. Doch mischt sich damit mancher eigenthtimliche Zug, wie denn die
Keilsteine der grossen Bögen abwechselnd mit Reliefköpfen ausgestattet sind.
Diarbekr. —Auch der Palast zu Diarbekr, später zu einer Moschee umgeschaffen,
verrätli römische Anklänge in den korinthischen Halbsäulen, welche in zwei
Geschossen die Wände gliedern. Ob die Spitzbogen der Portale ursprünglicher
Anlage angehören, muss einstweilen dahin gestellt bleiben; ebenso ob der
Palast, als Werk Schapur II, aus dem 4. Jahrhundert unsrer Zeitrechnung
stammt.
Fimz-Abad. Die vollständige Ausprägung des sassanidischen Styles finden wir dann
an einigen anderen Palästen, unter welchen der von Firuz-Abad, südlich
von Schapur, vielleicht der früheste ist. Er bildet ein Rechteck von ISO zu
332 Fuss, an dessen vorderer Schmalseite sich ein Portal von etwa 38 Fuss
Weite zwischen 15 F. starken Mauern öffnet. Das elliptische Tonnengewölbe
desselben bedeckt eine tiefe Halle, in welche nach beiden Seiten zwei ähnliche
Hallen querschiffartig münden. Winzig schmale Eingänge führen von diesen
Theilen in drei quadratische, mit Kuppeln bedeckte Säle, die mit ihrer Wöl-
bung sich weit über die benachbarten Räume erheben und offenbar den wich-
tigsten Th eil der Anlage bilden. Von hier aus gelangt man durch schmale
Thiiren in die niedrigeren Gemächer, welche sich um einen schmucklosen qua-
dratischen Hof reihen. Sie sind mit Tonnengewölben bedeckt und erhalten
ihr Licht durch schmale Tliiiren vom Hofe aus. Nur die Kuppelsäle bekommen
ein Oberlicht durch eine im Centrum des Gewölbes angebrachte Oeffnnng.
Merkwürdig ist die mehr mittelalterliche als römische Art, wie die Kuppeln
durch überkragende Bogen in den Ecken sich aus dem quadratischen Grundplan
Sarbistau. entwickeln. — Dasselbe Bausystem zeigt der Palast zu Sarbistan, nur dass
hier die Anlage architektonisch durchgebildeter und einheitlicher erscheint.
Denn an der Fagade öffnen sich drei Portalhallen, eine mittlere von etwa 38 Fuss
Weite und zwei seitliche von 24 Fuss, gegen das dreitheilig angelegte Innere.
Der Hauptraum gestaltet sich als grossartiger Kuppelsaal von etwa 44 Fuss
Durchmesser. Er steht in Verbindung mit den Seitenräumen und dem Hofe,
der den Mittelpunkt für die inneren Gemächer bildet. In zweien dieser durch
Fenster erleuchteten Gemächer kehrt die lange gälerieartige Form der assy-
rischen Palasträume wieder. Hier ist auch durch frei vor die Wände tretende
Särgen Stellungen, welche Gewölbansätze tragen, eine Gliederung des Innern
versucht worden. Diese Säulen, sowie die am Aeusseren gruppenweise ange-
brachten Halbsäulen sind aber ohne Basis und Kapital als rohe Cylinder be-
handelt und erinnern eher an jene Wandgliederungen des alten Palastes zu
Wurka (S. 34) als an irgend welche klassische Säulenordnungen.
Ktesiphon. Dennoch sollte die sassanidisclie Architektur auch eine primitive Kapitäl-
form hervorbringen, die — freilich in ungeschlachter trapezartiger Gestalt -fr
an dem stattlichen Palaste zu Ktesiphon oder El Madain auftritt (Fig. 35).
Das Aeussere bietet das vollständig entwickelte System der nüchternen Pilaster-
und Blendengliederung dieses Styles, doch bewirkt der gewaltige Bogen der
in der Mitte angebrachten Portalhalle, 72 Fuss weit bei 85 Fuss Höhe und
115 Fuss Tiefe der Halle, eine willkommene Unterbrechung dieser öden Wand-
bekleidung. Noch eine andere Eigenheit sassanidischer Bauwerke ist dabei zu
beachten: dass nämlich bei den Blenden, Thüren und Fenstern der Bogen
weiter ist als die Oeffnnng, der er zum Abschluss dienen soll, wodurch eine