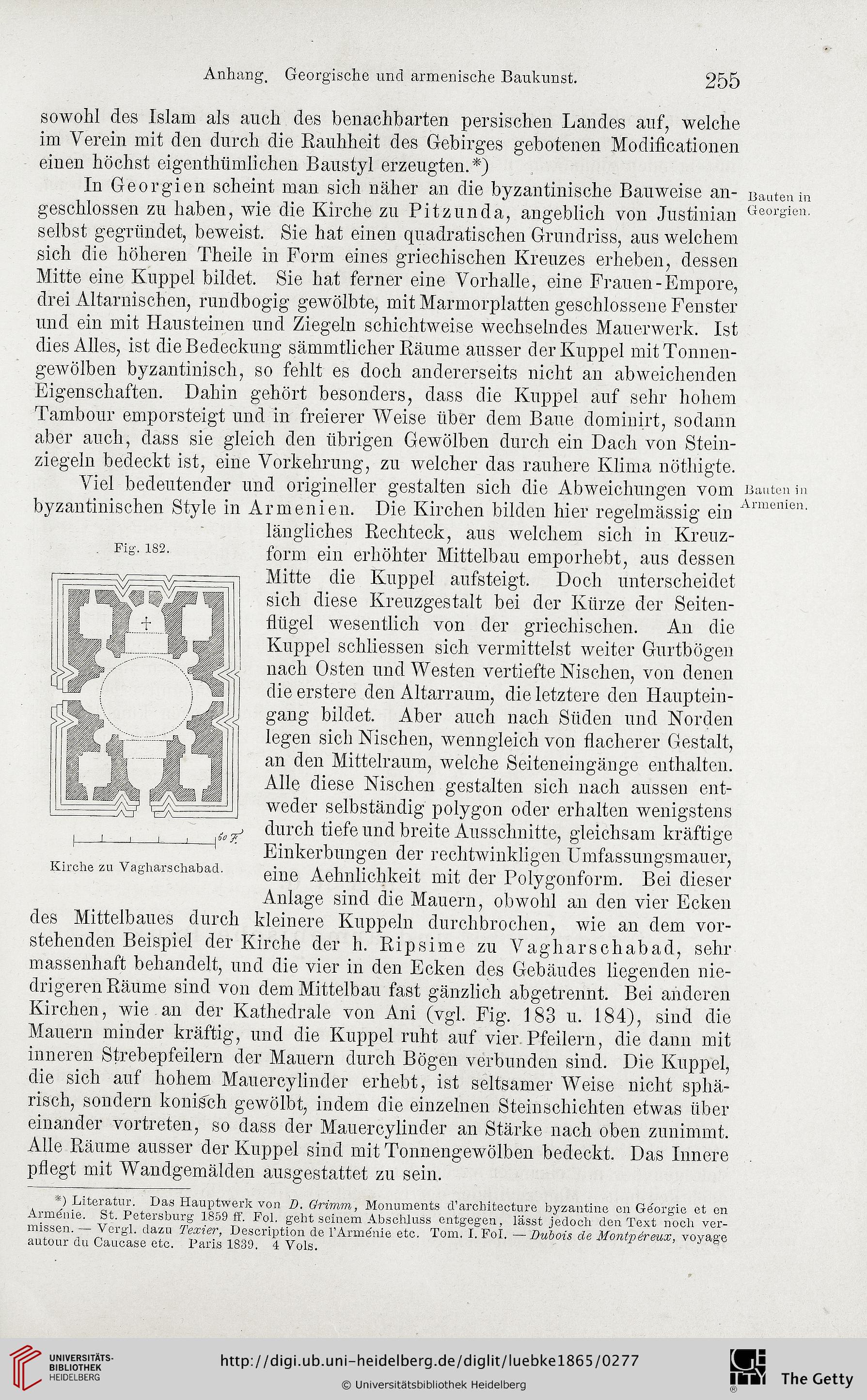Anhang. Georgische und armenische Baukunst.
255
sowohl des Islam als auch des benachbarten persischen Landes auf, welche
im Verein mit den durch die Rauhheit des Gebirges gebotenen Modificationen
einen höchst eigentümlichen Baustyl erzeugten.*)
In Georgien scheint man sich näher an die byzantinische Bauweise an-
geschlossen zu haben, wie die Kirche zu Pitzunda, angeblich von Justinian
selbst gegründet, beweist. Sie hat einen quadratischen Grundriss, aus welchem
sich die höheren Theile in Form eines griechischen Kreuzes erheben, dessen
Mitte eine Kuppel bildet. Sie hat ferner eine Vorhalle, eine Frauen-Empore,
drei Altarnischen, rundbogig gewölbte, mit Marmorplatten geschlossene Fenster
und ein mit Hausteinen und Ziegeln schichtweise wechselndes Mauerwerk. Ist
dies Alles, ist die Bedeckung sämmtlieher Räume ausser der Kuppel mit Tonnen-
gewölben byzantinisch, so fehlt es doch andererseits nicht an abweichenden
Eigenschaften. Dahin gehört besonders, dass die Kuppel auf sehr hohem
Tambour emporsteigt und in freierer Weise über dem Baue dominirt, sodann
aber auch, dass sie gleich den übrigen Gewölben durch ein Dach von Stein-
ziegeln bedeckt ist, eine Vorkehrung, zu welcher das rauhere Klima nöthigte.
Viel bedeutender und origineller gestalten sich die Abweichungen vom
byzantinischen Style in Armenien. Die Kirchen bilden hier regelmässig ein
längliches Rechteck, aus welchem sich in Kreuz-
form ein erhöhter Mittelbau emporhebt, aus dessen
Mitte die Kuppel aufsteigt. Doch unterscheidet
sich diese Kreuzgestalt bei der Kürze der Seiten-
flügel wesentlich von der griechischen. An die
Kuppel schliessen sich vermittelst weiter Gurtbögen
nach Osten und Westen vertiefte Nischen, von denen
die erstere den Altarraum, die letztere den Hauptein-
gang bildet. Aber auch nach Süden und Norden
legen sich Nischen, wenngleich von flacherer Gestalt,
an den Mittelraum, welche Seiteneingänge enthalten.
Alle diese Nischen gestalten sich nach aussen ent-
weder selbständig polygon oder erhalten wenigstens
durch tiefe und breite Ausschnitte, gleichsam kräftige
Einkerbungen der rechtwinkligen Umfassungsmauer,
eine Aehnlichkeit mit der Polygonform. Bei dieser
Anlage sind die Mauern, obwohl an den vier Ecken
des Mittelbaues durch kleinere Kuppeln durchbrochen, wie an dem vor-
stehenden Beispiel der Kirche der h. Ripsime zu Vagharschabad, sehr
massenhaft behandelt, und die vier in den Ecken des Gebäudes liegenden nie-
drigeren Räume sind von dem Mittelbau fast gänzlich abgetrennt. Bei anderen
Kirchen, wie an der Kathedrale von Ani (vgl. Fig. 183 u. 184), sind die
Mauern minder kräftig, und die Kuppel ruht auf vier Pfeilern, die dann mit
inneren Strebepfeilern der Mauern durch Bögen verbunden sind. Die Kuppel,
die sich auf hohem Mauercylinder erhebt, ist seltsamer Weise nicht sphä-
risch, sondern konisch gewölbt, indem die einzelnen Steinschichten etwas über
einander vortreten, so dass der Mauercylinder an Stärke nach oben zunimmt.
Alle Räume ausser der Kuppel sind mit Tonnengewölben bedeckt. Das Innere
pflegt mit Wandgemälden ausgestattet zu sein.
*) Literatur. Das Hauptwerk von D. Grimm, Monuments d’architecture byzantine en Georgie et cn
Armdnie. St. Petersburg 1859 ff. Fol. geht seinem Abschluss entgegen, lässt jedoch den Text noch ver-
missen. — Vergl. dazu Texter, Description de l’Armdnie etc. Tom. I. FoL — Dubois de Montpereux, voyage
autour du Caucase etc. Paris 1839. 4 Vols.
Hauten in
Georgien.
Bauten in
Armenien.
255
sowohl des Islam als auch des benachbarten persischen Landes auf, welche
im Verein mit den durch die Rauhheit des Gebirges gebotenen Modificationen
einen höchst eigentümlichen Baustyl erzeugten.*)
In Georgien scheint man sich näher an die byzantinische Bauweise an-
geschlossen zu haben, wie die Kirche zu Pitzunda, angeblich von Justinian
selbst gegründet, beweist. Sie hat einen quadratischen Grundriss, aus welchem
sich die höheren Theile in Form eines griechischen Kreuzes erheben, dessen
Mitte eine Kuppel bildet. Sie hat ferner eine Vorhalle, eine Frauen-Empore,
drei Altarnischen, rundbogig gewölbte, mit Marmorplatten geschlossene Fenster
und ein mit Hausteinen und Ziegeln schichtweise wechselndes Mauerwerk. Ist
dies Alles, ist die Bedeckung sämmtlieher Räume ausser der Kuppel mit Tonnen-
gewölben byzantinisch, so fehlt es doch andererseits nicht an abweichenden
Eigenschaften. Dahin gehört besonders, dass die Kuppel auf sehr hohem
Tambour emporsteigt und in freierer Weise über dem Baue dominirt, sodann
aber auch, dass sie gleich den übrigen Gewölben durch ein Dach von Stein-
ziegeln bedeckt ist, eine Vorkehrung, zu welcher das rauhere Klima nöthigte.
Viel bedeutender und origineller gestalten sich die Abweichungen vom
byzantinischen Style in Armenien. Die Kirchen bilden hier regelmässig ein
längliches Rechteck, aus welchem sich in Kreuz-
form ein erhöhter Mittelbau emporhebt, aus dessen
Mitte die Kuppel aufsteigt. Doch unterscheidet
sich diese Kreuzgestalt bei der Kürze der Seiten-
flügel wesentlich von der griechischen. An die
Kuppel schliessen sich vermittelst weiter Gurtbögen
nach Osten und Westen vertiefte Nischen, von denen
die erstere den Altarraum, die letztere den Hauptein-
gang bildet. Aber auch nach Süden und Norden
legen sich Nischen, wenngleich von flacherer Gestalt,
an den Mittelraum, welche Seiteneingänge enthalten.
Alle diese Nischen gestalten sich nach aussen ent-
weder selbständig polygon oder erhalten wenigstens
durch tiefe und breite Ausschnitte, gleichsam kräftige
Einkerbungen der rechtwinkligen Umfassungsmauer,
eine Aehnlichkeit mit der Polygonform. Bei dieser
Anlage sind die Mauern, obwohl an den vier Ecken
des Mittelbaues durch kleinere Kuppeln durchbrochen, wie an dem vor-
stehenden Beispiel der Kirche der h. Ripsime zu Vagharschabad, sehr
massenhaft behandelt, und die vier in den Ecken des Gebäudes liegenden nie-
drigeren Räume sind von dem Mittelbau fast gänzlich abgetrennt. Bei anderen
Kirchen, wie an der Kathedrale von Ani (vgl. Fig. 183 u. 184), sind die
Mauern minder kräftig, und die Kuppel ruht auf vier Pfeilern, die dann mit
inneren Strebepfeilern der Mauern durch Bögen verbunden sind. Die Kuppel,
die sich auf hohem Mauercylinder erhebt, ist seltsamer Weise nicht sphä-
risch, sondern konisch gewölbt, indem die einzelnen Steinschichten etwas über
einander vortreten, so dass der Mauercylinder an Stärke nach oben zunimmt.
Alle Räume ausser der Kuppel sind mit Tonnengewölben bedeckt. Das Innere
pflegt mit Wandgemälden ausgestattet zu sein.
*) Literatur. Das Hauptwerk von D. Grimm, Monuments d’architecture byzantine en Georgie et cn
Armdnie. St. Petersburg 1859 ff. Fol. geht seinem Abschluss entgegen, lässt jedoch den Text noch ver-
missen. — Vergl. dazu Texter, Description de l’Armdnie etc. Tom. I. FoL — Dubois de Montpereux, voyage
autour du Caucase etc. Paris 1839. 4 Vols.
Hauten in
Georgien.
Bauten in
Armenien.