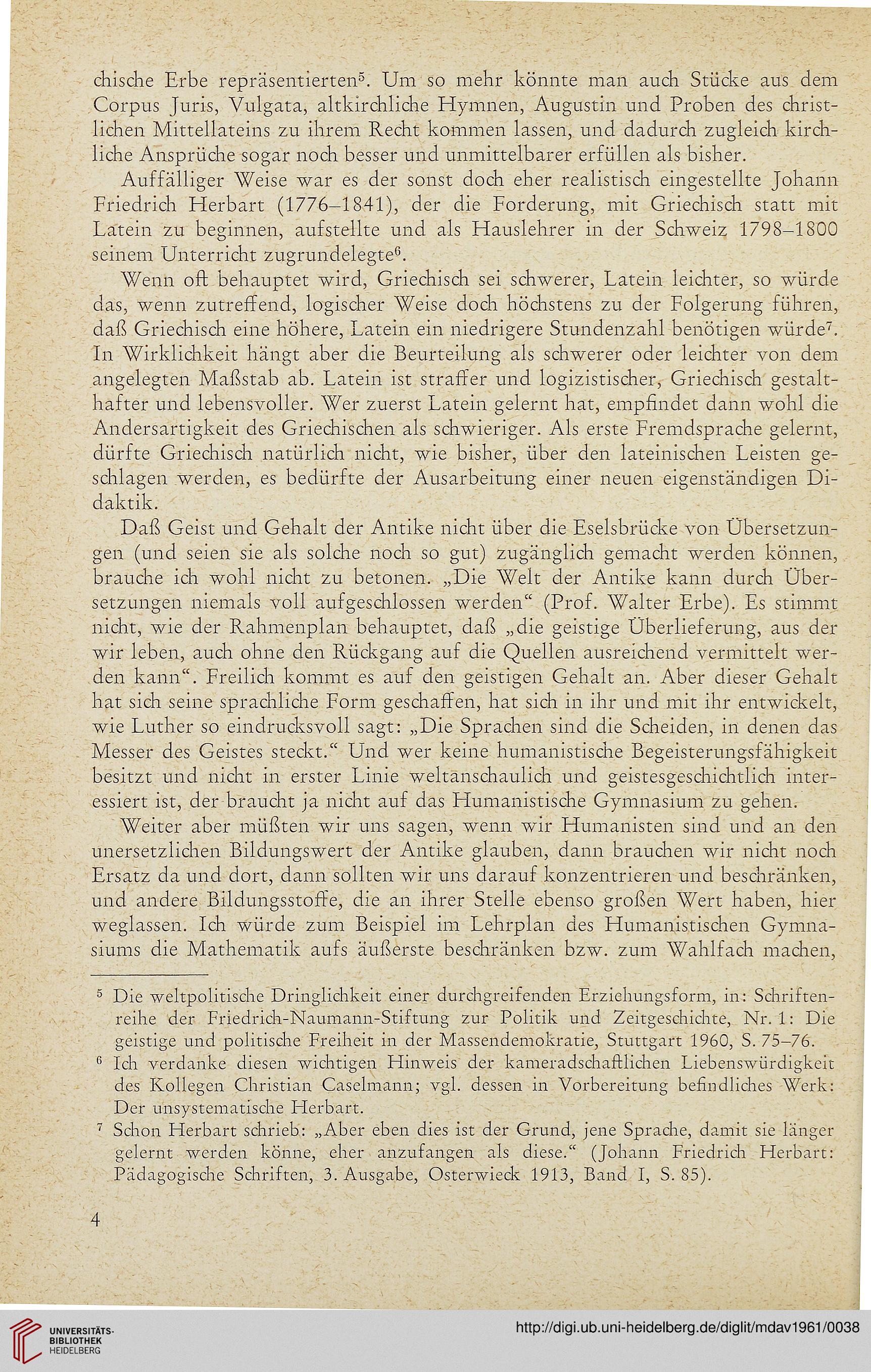chische Erbe repräsentiertenE Um so mehr könnte man auch Stücke aus dem
Corpus Juris, Vulgata, altkirchliche Hymnen, Augustin und Prohen des christ-
lichen Mittellateins zu ihrem Recht kommen lassen, und dadurch zugleich kirch-
liche Ansprüche sogar noch besser und unmittelbarer erfüllen als bisher.
Auffäliiger Weise war es der sonst doch eher reaiistisch eingesteilte Johann
Friedrich Herbart (1776-1841), der die Forderung, mit Griechisch statt mit
Latein zu beginnen, aufstellte und als Hausiehrer in der Schweiz 1798-1800
seinem Unterricht zugrundeiegte*'.
Wenn oA behauptet wird, Griechisch sei schwerer, Latein leichter, so würde
das, wenn zutreffend, iogischer Weise doch höchstens zu der Folgerung führen,
daß Griechisch eine höhere, Latein ein niedrigere Stundenzahl benötigen würde'".
In Wirkiichkeit hängt aber die Beurteilung als schwerer oder leichter von dem
angelegten Maßstab ab. Latein ist straffer und logizistischer, Griechisch gestalt-
hafter und lebensvoller. Wer zuerst Latein gelernt hat, emphndet dann wohl die
Andersartigkeit des Griechischen als schwieriger. Als erste Fremdsprache gelernt,
dürfte Griechisch natürlich nicht, wie bisher, über den lateinischen Leisten ge-
schlagen werden, es bedürfte der Ausarbeitung einer neuen eigenständigen Di-
daktik.
Daß Geist und Gehalt der Antike nicht über die Eselsbrücke von Übersetzun-
gen (und seien sie als soiche noch so gut) zugänglich gemacht werden können,
brauche ich wohl nicht zu betonen. „Die Welt der Antike kann durch Über-
setzungen niemais voll aufgeschlossen werden" (Prof. Walter Erbe). Es stimmt
nicht, wie der Rahmenplan behauptet, daß „die geistige Überlieferung, aus der
wir leben, auch ohne den Rückgang auf die Quellen ausreichend vermittelt wer-
den kann". Freilich kommt es auf den geistigen Gehalt an. Aber dieser Gehait
hat sich seine sprachiiche Form geschalfen, hat sich in ihr und mit ihr entwickeit,
wie Luther so eindrucksvoll sagt: „Die Sprachen sind die Scheiden, in denen das
Messer des Geistes steckt." Und wer keine humanistische Begeisterungsfähigkeit
besitzt und nicht in erster Linie weitanschauiich und geistesgeschichtiich inter-
essiert ist, der braucht ja nicht auf das Humanistische Gymnasium zu gehen.
Weiter aber müßten wir uns sagen, wenn wir Humanisten sind und an den
unersetziichen Bildungswert der Antike glauben, dann brauchen wir nicht noch
Ersatz da und dort, dann soüten wir uns darauf konzentrieren und beschränken,
und andere Biidungsstoffe, die an ihrer Stelle ebenso großen Wert haben, hier
weglassen. Ich würde zum Beispiei im Lehrplan des Humanistischen Gymna-
siums die Mathematik aufs äußerste beschränken bzw. zum Wahifach machen,
s Die weitpolitische Dringiichkeit einer durchgreifenden Erziehungsform, in: Schriften-
reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Politik und Zeitgeschichte, Nr. 1: Die
geistige und poiitische Freiheit in der Massendemokratie, Stuttgart 1960, S. 75-76.
^ Ich verdanke diesen wichtigen Hinweis der kameradschafHichen Liehenswürdigkcit
des Koiiegen Christian Caselmann; vgl. dessen in Vorbereitung behndiiches Werk:
Der unsystematische Herbart.
" Schon Herbart schrieb: „Aber eben dies ist der Grund, jene Sprache, damit sie iänger
geiernt werden könne, eher anzufangen ais diese." (Johann Friedrich Herbart:
Pädagogische Schriften, 3. Ausgabe, Osterwieck 1913, Band I, S. 85).
4
Corpus Juris, Vulgata, altkirchliche Hymnen, Augustin und Prohen des christ-
lichen Mittellateins zu ihrem Recht kommen lassen, und dadurch zugleich kirch-
liche Ansprüche sogar noch besser und unmittelbarer erfüllen als bisher.
Auffäliiger Weise war es der sonst doch eher reaiistisch eingesteilte Johann
Friedrich Herbart (1776-1841), der die Forderung, mit Griechisch statt mit
Latein zu beginnen, aufstellte und als Hausiehrer in der Schweiz 1798-1800
seinem Unterricht zugrundeiegte*'.
Wenn oA behauptet wird, Griechisch sei schwerer, Latein leichter, so würde
das, wenn zutreffend, iogischer Weise doch höchstens zu der Folgerung führen,
daß Griechisch eine höhere, Latein ein niedrigere Stundenzahl benötigen würde'".
In Wirkiichkeit hängt aber die Beurteilung als schwerer oder leichter von dem
angelegten Maßstab ab. Latein ist straffer und logizistischer, Griechisch gestalt-
hafter und lebensvoller. Wer zuerst Latein gelernt hat, emphndet dann wohl die
Andersartigkeit des Griechischen als schwieriger. Als erste Fremdsprache gelernt,
dürfte Griechisch natürlich nicht, wie bisher, über den lateinischen Leisten ge-
schlagen werden, es bedürfte der Ausarbeitung einer neuen eigenständigen Di-
daktik.
Daß Geist und Gehalt der Antike nicht über die Eselsbrücke von Übersetzun-
gen (und seien sie als soiche noch so gut) zugänglich gemacht werden können,
brauche ich wohl nicht zu betonen. „Die Welt der Antike kann durch Über-
setzungen niemais voll aufgeschlossen werden" (Prof. Walter Erbe). Es stimmt
nicht, wie der Rahmenplan behauptet, daß „die geistige Überlieferung, aus der
wir leben, auch ohne den Rückgang auf die Quellen ausreichend vermittelt wer-
den kann". Freilich kommt es auf den geistigen Gehalt an. Aber dieser Gehait
hat sich seine sprachiiche Form geschalfen, hat sich in ihr und mit ihr entwickeit,
wie Luther so eindrucksvoll sagt: „Die Sprachen sind die Scheiden, in denen das
Messer des Geistes steckt." Und wer keine humanistische Begeisterungsfähigkeit
besitzt und nicht in erster Linie weitanschauiich und geistesgeschichtiich inter-
essiert ist, der braucht ja nicht auf das Humanistische Gymnasium zu gehen.
Weiter aber müßten wir uns sagen, wenn wir Humanisten sind und an den
unersetziichen Bildungswert der Antike glauben, dann brauchen wir nicht noch
Ersatz da und dort, dann soüten wir uns darauf konzentrieren und beschränken,
und andere Biidungsstoffe, die an ihrer Stelle ebenso großen Wert haben, hier
weglassen. Ich würde zum Beispiei im Lehrplan des Humanistischen Gymna-
siums die Mathematik aufs äußerste beschränken bzw. zum Wahifach machen,
s Die weitpolitische Dringiichkeit einer durchgreifenden Erziehungsform, in: Schriften-
reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Politik und Zeitgeschichte, Nr. 1: Die
geistige und poiitische Freiheit in der Massendemokratie, Stuttgart 1960, S. 75-76.
^ Ich verdanke diesen wichtigen Hinweis der kameradschafHichen Liehenswürdigkcit
des Koiiegen Christian Caselmann; vgl. dessen in Vorbereitung behndiiches Werk:
Der unsystematische Herbart.
" Schon Herbart schrieb: „Aber eben dies ist der Grund, jene Sprache, damit sie iänger
geiernt werden könne, eher anzufangen ais diese." (Johann Friedrich Herbart:
Pädagogische Schriften, 3. Ausgabe, Osterwieck 1913, Band I, S. 85).
4