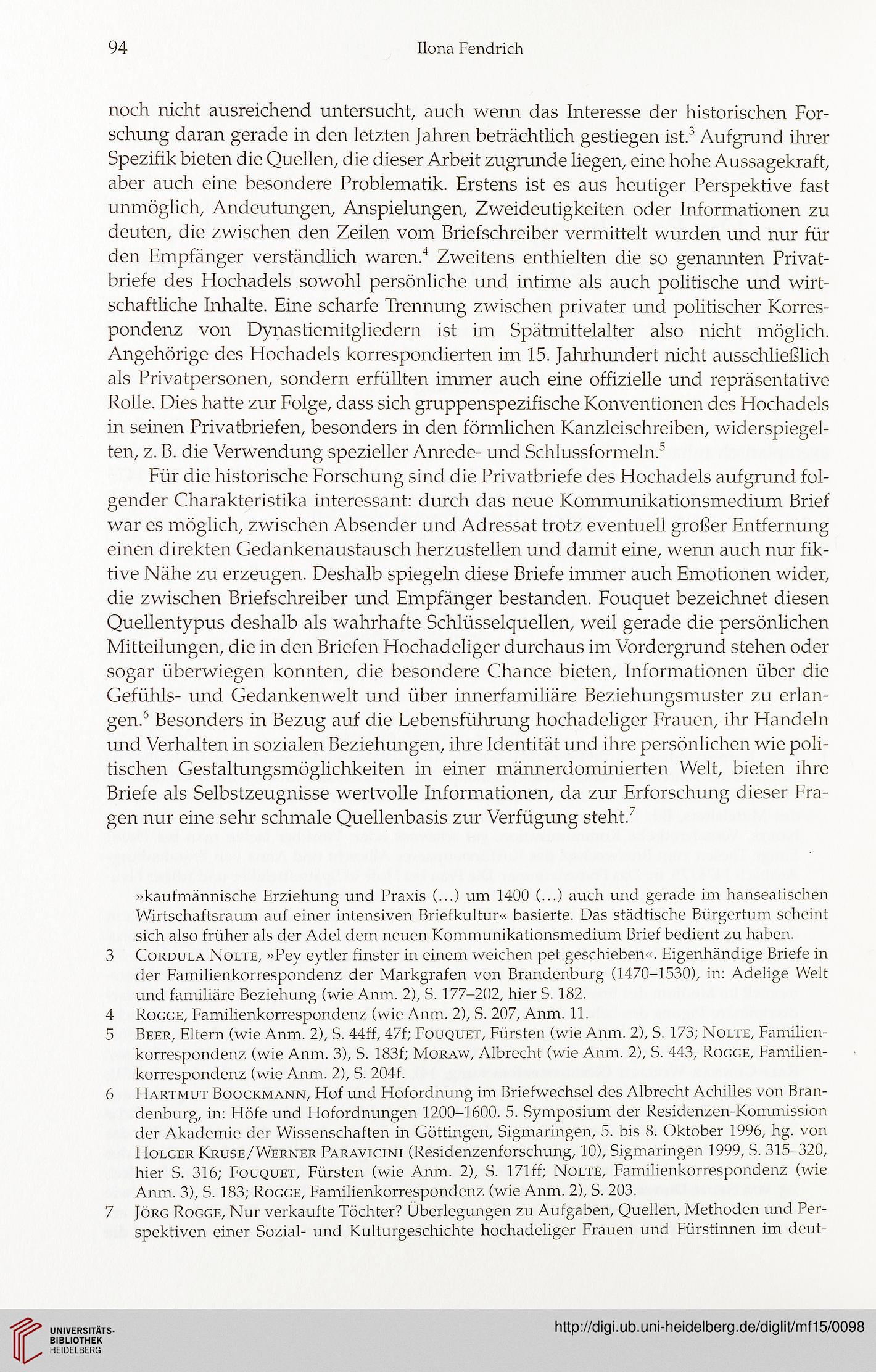94
Ilona Fendrich
noch nicht ausreichend untersucht, auch wenn das Interesse der historischen For-
schung daran gerade in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen ist.3 Aufgrund ihrer
Spezifik bieten die Quellen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, eine hohe Aussagekraft,
aber auch eine besondere Problematik. Erstens ist es aus heutiger Perspektive fast
unmöglich, Andeutungen, Anspielungen, Zweideutigkeiten oder Informationen zu
deuten, die zwischen den Zeilen vom Briefschreiber vermittelt wurden und nur für
den Empfänger verständlich waren.4 Zweitens enthielten die so genannten Privat-
briefe des Hochadels sowohl persönliche und intime als auch politische und wirt-
schaftliche Inhalte. Eine scharfe Trennung zwischen privater und politischer Korres-
pondenz von Dynastiemitgliedern ist im Spätmittelalter also nicht möglich.
Angehörige des Hochadels korrespondierten im 15. Jahrhundert nicht ausschließlich
als Privatpersonen, sondern erfüllten immer auch eine offizielle und repräsentative
Rolle. Dies hatte zur Folge, dass sich gruppenspezifische Konventionen des Hochadels
in seinen Privatbriefen, besonders in den förmlichen Kanzleischreiben, widerspiegel-
ten, z. B. die Verwendung spezieller Anrede- und Schlussformeln.5
Für die historische Forschung sind die Privatbriefe des Hochadels aufgrund fol-
gender Charakteristika interessant: durch das neue Kommunikationsmedium Brief
war es möglich, zwischen Absender und Adressat trotz eventuell großer Entfernung
einen direkten Gedankenaustausch herzustellen und damit eine, wenn auch nur fik-
tive Nähe zu erzeugen. Deshalb spiegeln diese Briefe immer auch Emotionen wider,
die zwischen Briefschreiber und Empfänger bestanden. Fouquet bezeichnet diesen
Quellentypus deshalb als wahrhafte Schlüsselquellen, weil gerade die persönlichen
Mitteilungen, die in den Briefen Hochadeliger durchaus im Vordergrund stehen oder
sogar überwiegen konnten, die besondere Chance bieten, Informationen über die
Gefühls- und Gedankenwelt und über innerfamiliäre Beziehungsmuster zu erlan-
gen.6 Besonders in Bezug auf die Lebensführung hochadeliger Frauen, ihr Handeln
und Verhalten in sozialen Beziehungen, ihre Identität und ihre persönlichen wie poli-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten in einer männerdominierten Welt, bieten ihre
Briefe als Selbstzeugnisse wertvolle Informationen, da zur Erforschung dieser Fra-
gen nur eine sehr schmale Quellenbasis zur Verfügung steht.
»kaufmännische Erziehung und Praxis (...) um 1400 (...) auch und gerade im hanseatischen
Wirtschaftsraum auf einer intensiven Briefkultur« basierte. Das städtische Bürgertum scheint
sich also früher als der Adel dem neuen Kommunikationsmedium Brief bedient zu haben.
3 Cordula Nolte, »Pey eytler finster in einem weichen pet geschieben«. Eigenhändige Briefe in
der Familienkorrespondenz der Markgrafen von Brandenburg (1470-1530), in: Adelige Welt
und familiäre Beziehung (wie Anm. 2), S. 177-202, hier S. 182.
4 Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 207, Anm. 11.
5 Beer, Eltern (wie Anm. 2), S. 44ff, 47f; Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 173; Nolte, Familien-
korrespondenz (wie Anm. 3), S. 183f; Moraw, Albrecht (wie Anm. 2), S. 443, Rogge, Familien-
korrespondenz (wie Anm. 2), S. 204f.
6 FIartmut Boockmann, Hof und Hofordnung im Briefwechsel des Albrecht Achilles von Bran-
denburg, in: Höfe und Hofordnungen 1200-1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Sigmaringen, 5. bis 8. Oktober 1996, hg. von
Holger Kruse/Werner Paravicini (Residenzenforschung, 10), Sigmaringen 1999, S. 315-320,
hier S. 316; Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 171ff; Nolte, Familienkorrespondenz (wie
Anm. 3), S. 183; Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 203.
7 Jörg Rogge, Nur verkaufte Töchter? Überlegungen zu Aufgaben, Quellen, Methoden und Per-
spektiven einer Sozial- und Kulturgeschichte hochadeliger Frauen und Fürstinnen im deut-
Ilona Fendrich
noch nicht ausreichend untersucht, auch wenn das Interesse der historischen For-
schung daran gerade in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen ist.3 Aufgrund ihrer
Spezifik bieten die Quellen, die dieser Arbeit zugrunde liegen, eine hohe Aussagekraft,
aber auch eine besondere Problematik. Erstens ist es aus heutiger Perspektive fast
unmöglich, Andeutungen, Anspielungen, Zweideutigkeiten oder Informationen zu
deuten, die zwischen den Zeilen vom Briefschreiber vermittelt wurden und nur für
den Empfänger verständlich waren.4 Zweitens enthielten die so genannten Privat-
briefe des Hochadels sowohl persönliche und intime als auch politische und wirt-
schaftliche Inhalte. Eine scharfe Trennung zwischen privater und politischer Korres-
pondenz von Dynastiemitgliedern ist im Spätmittelalter also nicht möglich.
Angehörige des Hochadels korrespondierten im 15. Jahrhundert nicht ausschließlich
als Privatpersonen, sondern erfüllten immer auch eine offizielle und repräsentative
Rolle. Dies hatte zur Folge, dass sich gruppenspezifische Konventionen des Hochadels
in seinen Privatbriefen, besonders in den förmlichen Kanzleischreiben, widerspiegel-
ten, z. B. die Verwendung spezieller Anrede- und Schlussformeln.5
Für die historische Forschung sind die Privatbriefe des Hochadels aufgrund fol-
gender Charakteristika interessant: durch das neue Kommunikationsmedium Brief
war es möglich, zwischen Absender und Adressat trotz eventuell großer Entfernung
einen direkten Gedankenaustausch herzustellen und damit eine, wenn auch nur fik-
tive Nähe zu erzeugen. Deshalb spiegeln diese Briefe immer auch Emotionen wider,
die zwischen Briefschreiber und Empfänger bestanden. Fouquet bezeichnet diesen
Quellentypus deshalb als wahrhafte Schlüsselquellen, weil gerade die persönlichen
Mitteilungen, die in den Briefen Hochadeliger durchaus im Vordergrund stehen oder
sogar überwiegen konnten, die besondere Chance bieten, Informationen über die
Gefühls- und Gedankenwelt und über innerfamiliäre Beziehungsmuster zu erlan-
gen.6 Besonders in Bezug auf die Lebensführung hochadeliger Frauen, ihr Handeln
und Verhalten in sozialen Beziehungen, ihre Identität und ihre persönlichen wie poli-
tischen Gestaltungsmöglichkeiten in einer männerdominierten Welt, bieten ihre
Briefe als Selbstzeugnisse wertvolle Informationen, da zur Erforschung dieser Fra-
gen nur eine sehr schmale Quellenbasis zur Verfügung steht.
»kaufmännische Erziehung und Praxis (...) um 1400 (...) auch und gerade im hanseatischen
Wirtschaftsraum auf einer intensiven Briefkultur« basierte. Das städtische Bürgertum scheint
sich also früher als der Adel dem neuen Kommunikationsmedium Brief bedient zu haben.
3 Cordula Nolte, »Pey eytler finster in einem weichen pet geschieben«. Eigenhändige Briefe in
der Familienkorrespondenz der Markgrafen von Brandenburg (1470-1530), in: Adelige Welt
und familiäre Beziehung (wie Anm. 2), S. 177-202, hier S. 182.
4 Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 207, Anm. 11.
5 Beer, Eltern (wie Anm. 2), S. 44ff, 47f; Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 173; Nolte, Familien-
korrespondenz (wie Anm. 3), S. 183f; Moraw, Albrecht (wie Anm. 2), S. 443, Rogge, Familien-
korrespondenz (wie Anm. 2), S. 204f.
6 FIartmut Boockmann, Hof und Hofordnung im Briefwechsel des Albrecht Achilles von Bran-
denburg, in: Höfe und Hofordnungen 1200-1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Sigmaringen, 5. bis 8. Oktober 1996, hg. von
Holger Kruse/Werner Paravicini (Residenzenforschung, 10), Sigmaringen 1999, S. 315-320,
hier S. 316; Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 171ff; Nolte, Familienkorrespondenz (wie
Anm. 3), S. 183; Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 203.
7 Jörg Rogge, Nur verkaufte Töchter? Überlegungen zu Aufgaben, Quellen, Methoden und Per-
spektiven einer Sozial- und Kulturgeschichte hochadeliger Frauen und Fürstinnen im deut-