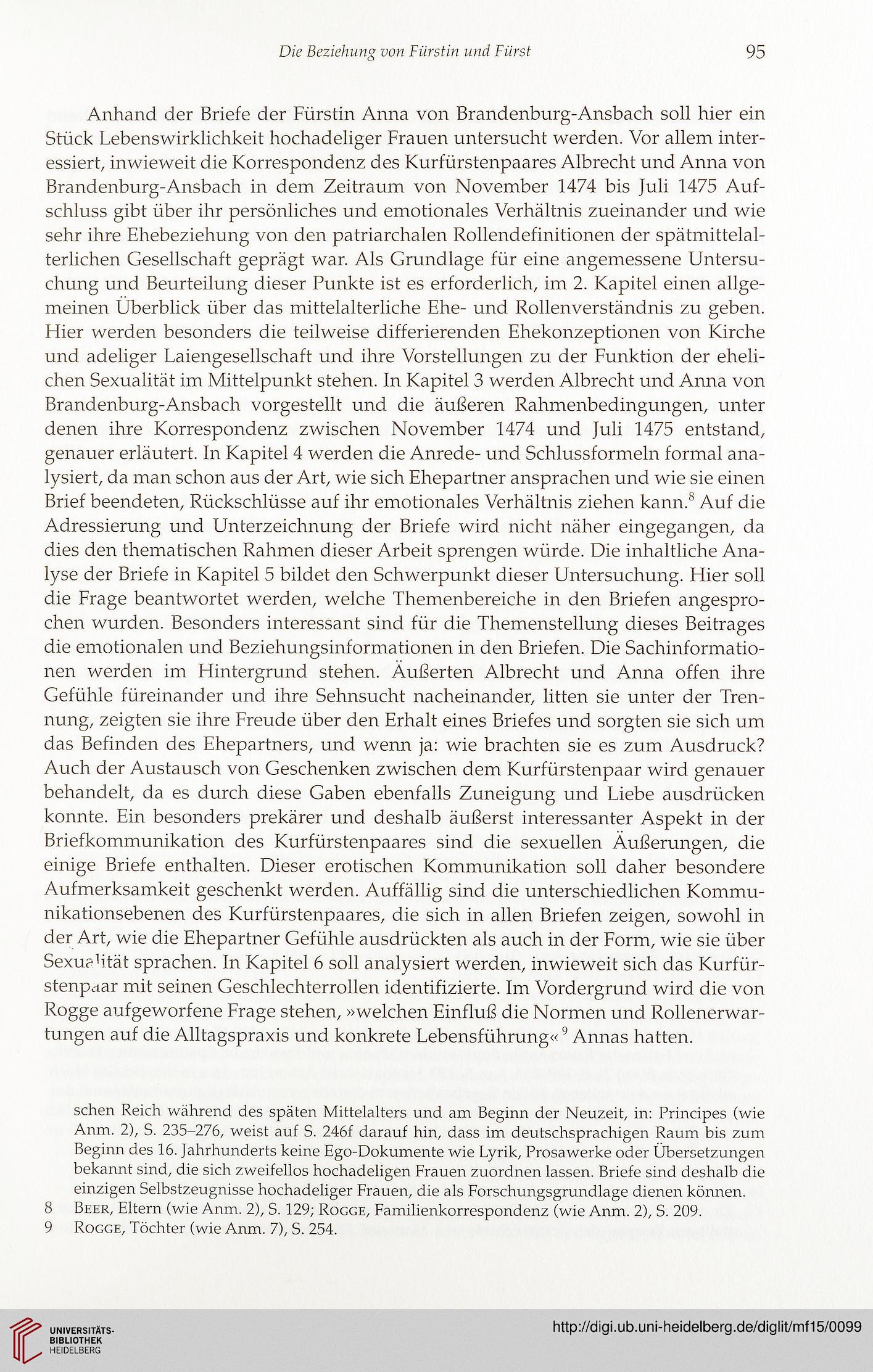Die Beziehung von Fürstin und Fürst
95
Anhand der Briefe der Fürstin Anna von Brandenburg-Ansbach soll hier ein
Stück Lebenswirklichkeit hochadeliger Frauen untersucht werden. Vor allem inter-
essiert, inwieweit die Korrespondenz des Kurfürstenpaares Albrecht und Anna von
Brandenburg-Ansbach in dem Zeitraum von November 1474 bis Juli 1475 Auf-
schluss gibt über ihr persönliches und emotionales Verhältnis zueinander und wie
sehr ihre Ehebeziehung von den patriarchalen Rollendefinitionen der spätmittelal-
terlichen Gesellschaft geprägt war. Als Grundlage für eine angemessene Untersu-
chung und Beurteilung dieser Punkte ist es erforderlich, im 2. Kapitel einen allge-
meinen Überblick über das mittelalterliche Ehe- und Rollenverständnis zu geben.
Hier werden besonders die teilweise differierenden Ehekonzeptionen von Kirche
und adeliger Laiengesellschaft und ihre Vorstellungen zu der Funktion der eheli-
chen Sexualität im Mittelpunkt stehen. In Kapitel 3 werden Albrecht und Anna von
Brandenburg-Ansbach vorgestellt und die äußeren Rahmenbedingungen, unter
denen ihre Korrespondenz zwischen November 1474 und Juli 1475 entstand,
genauer erläutert. In Kapitel 4 werden die Anrede- und Schlussformeln formal ana-
lysiert, da man schon aus der Art, wie sich Ehepartner ansprachen und wie sie einen
Brief beendeten, Rückschlüsse auf ihr emotionales Verhältnis ziehen kann.'s Auf die
Adressierung und Unterzeichnung der Briefe wird nicht näher eingegangen, da
dies den thematischen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die inhaltliche Ana-
lyse der Briefe in Kapitel 5 bildet den Schwerpunkt dieser Untersuchung. Hier soll
die Frage beantwortet werden, welche Themenbereiche in den Briefen angespro-
chen wurden. Besonders interessant sind für die Themenstellung dieses Beitrages
die emotionalen und Beziehungsinformationen in den Briefen. Die Sachinformatio-
nen werden im Hintergrund stehen. Äußerten Albrecht und Anna offen ihre
Gefühle füreinander und ihre Sehnsucht nacheinander, litten sie unter der Tren-
nung, zeigten sie ihre Freude über den Erhalt eines Briefes und sorgten sie sich um
das Befinden des Ehepartners, und wenn ja: wie brachten sie es zum Ausdruck?
Auch der Austausch von Geschenken zwischen dem Kurfürstenpaar wird genauer
behandelt, da es durch diese Gaben ebenfalls Zuneigung und Liebe ausdrücken
konnte. Ein besonders prekärer und deshalb äußerst interessanter Aspekt in der
Briefkommunikation des Kurfürstenpaares sind die sexuellen Äußerungen, die
einige Briefe enthalten. Dieser erotischen Kommunikation soll daher besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auffällig sind die unterschiedlichen Kommu-
nikationsebenen des Kurfürstenpaares, die sich in allen Briefen zeigen, sowohl in
der Art, wie die Ehepartner Gefühle ausdrückten als auch in der Form, wie sie über
Sexuahtät sprachen. In Kapitel 6 soll analysiert werden, inwieweit sich das Kurfür-
stenpaar mit seinen Geschlechterrollen identifizierte. Im Vordergrund wird die von
Rogge aufgeworfene Frage stehen, »welchen Einfluß die Normen und Rollenerwar-
tungen auf die Alltagspraxis und konkrete Lebensführung«9 Annas hatten.
sehen Reich während des späten Mittelalters und am Beginn der Neuzeit, in: Principes (wie
Anm. 2), S. 235-276, weist auf S. 246f darauf hin, dass im deutschsprachigen Raum bis zum
Beginn des 16. Jahrhunderts keine Ego-Dokumente wie Lyrik, Prosawerke oder Übersetzungen
bekannt sind, die sich zweifellos hochadeligen Frauen zuordnen lassen. Briefe sind deshalb die
einzigen Selbstzeugnisse hochadeliger Frauen, die als Forschungsgrundlage dienen können.
8 Beer, Eltern (wie Anm. 2), S. 129; Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 209.
9 Rogge, Töchter (wie Anm. 7), S. 254.
95
Anhand der Briefe der Fürstin Anna von Brandenburg-Ansbach soll hier ein
Stück Lebenswirklichkeit hochadeliger Frauen untersucht werden. Vor allem inter-
essiert, inwieweit die Korrespondenz des Kurfürstenpaares Albrecht und Anna von
Brandenburg-Ansbach in dem Zeitraum von November 1474 bis Juli 1475 Auf-
schluss gibt über ihr persönliches und emotionales Verhältnis zueinander und wie
sehr ihre Ehebeziehung von den patriarchalen Rollendefinitionen der spätmittelal-
terlichen Gesellschaft geprägt war. Als Grundlage für eine angemessene Untersu-
chung und Beurteilung dieser Punkte ist es erforderlich, im 2. Kapitel einen allge-
meinen Überblick über das mittelalterliche Ehe- und Rollenverständnis zu geben.
Hier werden besonders die teilweise differierenden Ehekonzeptionen von Kirche
und adeliger Laiengesellschaft und ihre Vorstellungen zu der Funktion der eheli-
chen Sexualität im Mittelpunkt stehen. In Kapitel 3 werden Albrecht und Anna von
Brandenburg-Ansbach vorgestellt und die äußeren Rahmenbedingungen, unter
denen ihre Korrespondenz zwischen November 1474 und Juli 1475 entstand,
genauer erläutert. In Kapitel 4 werden die Anrede- und Schlussformeln formal ana-
lysiert, da man schon aus der Art, wie sich Ehepartner ansprachen und wie sie einen
Brief beendeten, Rückschlüsse auf ihr emotionales Verhältnis ziehen kann.'s Auf die
Adressierung und Unterzeichnung der Briefe wird nicht näher eingegangen, da
dies den thematischen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Die inhaltliche Ana-
lyse der Briefe in Kapitel 5 bildet den Schwerpunkt dieser Untersuchung. Hier soll
die Frage beantwortet werden, welche Themenbereiche in den Briefen angespro-
chen wurden. Besonders interessant sind für die Themenstellung dieses Beitrages
die emotionalen und Beziehungsinformationen in den Briefen. Die Sachinformatio-
nen werden im Hintergrund stehen. Äußerten Albrecht und Anna offen ihre
Gefühle füreinander und ihre Sehnsucht nacheinander, litten sie unter der Tren-
nung, zeigten sie ihre Freude über den Erhalt eines Briefes und sorgten sie sich um
das Befinden des Ehepartners, und wenn ja: wie brachten sie es zum Ausdruck?
Auch der Austausch von Geschenken zwischen dem Kurfürstenpaar wird genauer
behandelt, da es durch diese Gaben ebenfalls Zuneigung und Liebe ausdrücken
konnte. Ein besonders prekärer und deshalb äußerst interessanter Aspekt in der
Briefkommunikation des Kurfürstenpaares sind die sexuellen Äußerungen, die
einige Briefe enthalten. Dieser erotischen Kommunikation soll daher besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Auffällig sind die unterschiedlichen Kommu-
nikationsebenen des Kurfürstenpaares, die sich in allen Briefen zeigen, sowohl in
der Art, wie die Ehepartner Gefühle ausdrückten als auch in der Form, wie sie über
Sexuahtät sprachen. In Kapitel 6 soll analysiert werden, inwieweit sich das Kurfür-
stenpaar mit seinen Geschlechterrollen identifizierte. Im Vordergrund wird die von
Rogge aufgeworfene Frage stehen, »welchen Einfluß die Normen und Rollenerwar-
tungen auf die Alltagspraxis und konkrete Lebensführung«9 Annas hatten.
sehen Reich während des späten Mittelalters und am Beginn der Neuzeit, in: Principes (wie
Anm. 2), S. 235-276, weist auf S. 246f darauf hin, dass im deutschsprachigen Raum bis zum
Beginn des 16. Jahrhunderts keine Ego-Dokumente wie Lyrik, Prosawerke oder Übersetzungen
bekannt sind, die sich zweifellos hochadeligen Frauen zuordnen lassen. Briefe sind deshalb die
einzigen Selbstzeugnisse hochadeliger Frauen, die als Forschungsgrundlage dienen können.
8 Beer, Eltern (wie Anm. 2), S. 129; Rogge, Familienkorrespondenz (wie Anm. 2), S. 209.
9 Rogge, Töchter (wie Anm. 7), S. 254.