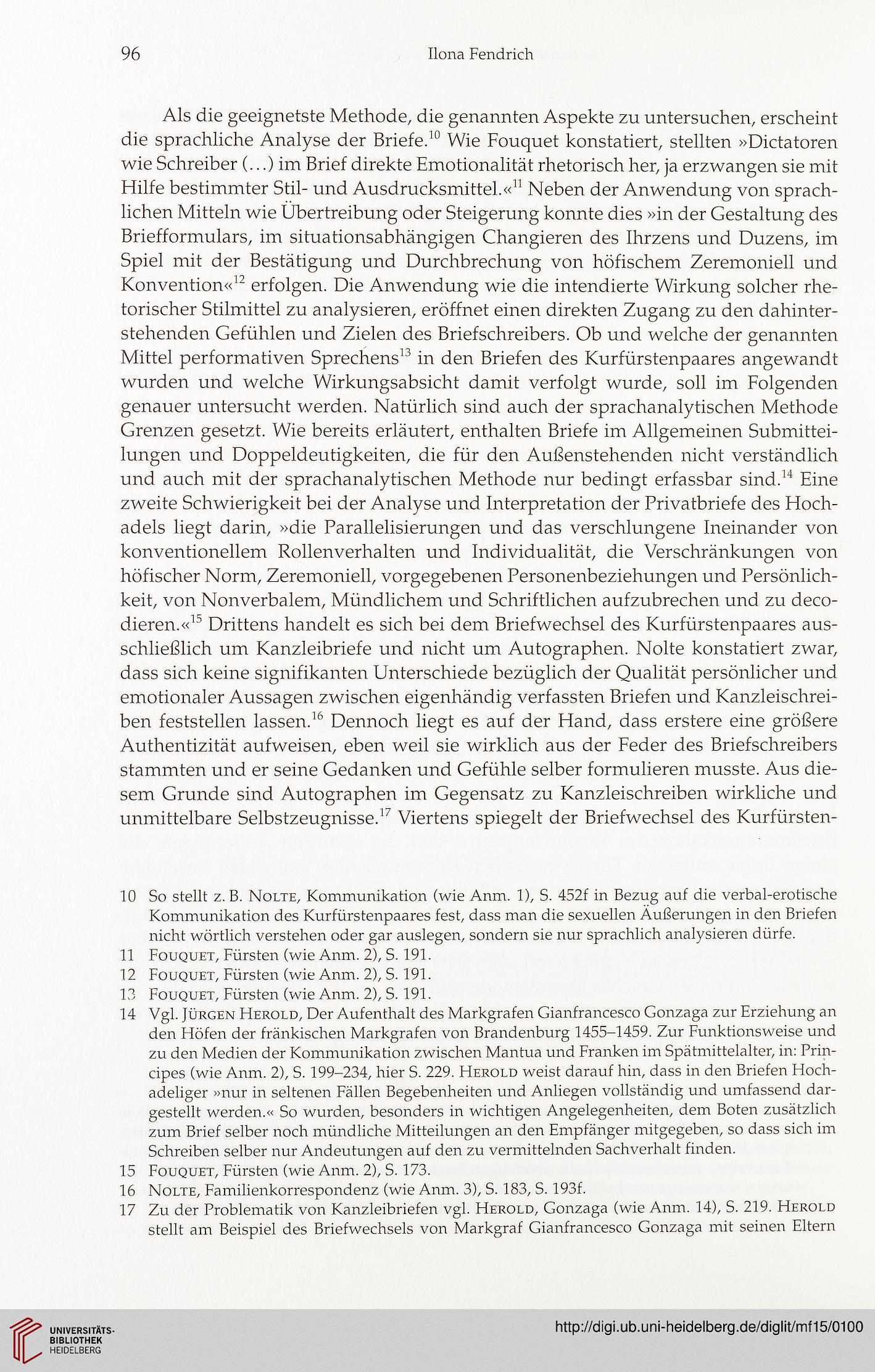96
Ilona Fendrich
Als die geeignetste Methode, die genannten Aspekte zu untersuchen, erscheint
die sprachliche Analyse der Briefe.10 Wie Fouquet konstatiert, stellten »Dictatoren
wie Schreiber (...) im Brief direkte Emotionalität rhetorisch her, ja erzwangen sie mit
Hilfe bestimmter Stil- und Ausdrucksmittel.«11 Neben der Anwendung von sprach-
lichen Mitteln wie Übertreibung oder Steigerung konnte dies »in der Gestaltung des
Briefformulars, im situationsabhängigen Changieren des Ihrzens und Duzens, im
Spiel mit der Bestätigung und Durchbrechung von höfischem Zeremoniell und
Konvention«12 erfolgen. Die Anwendung wie die intendierte Wirkung solcher rhe-
torischer Stilmittel zu analysieren, eröffnet einen direkten Zugang zu den dahinter-
stehenden Gefühlen und Zielen des Briefschreibers. Ob und welche der genannten
Mittel performativen Sprechens13 in den Briefen des Kurfürstenpaares angewandt
wurden und welche Wirkungsabsicht damit verfolgt wurde, soll im Folgenden
genauer untersucht werden. Natürlich sind auch der sprachanalytischen Methode
Grenzen gesetzt. Wie bereits erläutert, enthalten Briefe im Allgemeinen Submittei-
lungen und Doppeldeutigkeiten, die für den Außenstehenden nicht verständlich
und auch mit der sprachanalytischen Methode nur bedingt erfassbar sind.14 Eine
zweite Schwierigkeit bei der Analyse und Interpretation der Privatbriefe des Hoch-
adels liegt darin, »die Parallelisierungen und das verschlungene Ineinander von
konventionellem Rollenverhalten und Individualität, die Verschränkungen von
höfischer Norm, Zeremoniell, vorgegebenen Personenbeziehungen und Persönlich-
keit, von Nonverbalem, Mündlichem und Schriftlichen aufzubrechen und zu deco-
dieren.«15 Drittens handelt es sich bei dem Briefwechsel des Kurfürstenpaares aus-
schließlich um Kanzleibriefe und nicht um Autographen. Nolte konstatiert zwar,
dass sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Qualität persönlicher und
emotionaler Aussagen zwischen eigenhändig verfassten Briefen und Kanzleischrei-
ben feststellen lassen.16 Dennoch liegt es auf der Hand, dass erstere eine größere
Authentizität aufweisen, eben weil sie wirklich aus der Feder des Briefschreibers
stammten und er seine Gedanken und Gefühle selber formulieren musste. Aus die-
sem Grunde sind Autographen im Gegensatz zu Kanzleischreiben wirkliche und
unmittelbare Selbstzeugnisse.17 Viertens spiegelt der Briefwechsel des Kurfürsten-
10 So stellt z. B. Nolte, Kommunikation (wie Anm. 1), S. 452f in Bezug auf die verbal-erotische
Kommunikation des Kurfürstenpaares fest, dass man die sexuellen Äußerungen in den Briefen
nicht wörtlich verstehen oder gar auslegen, sondern sie nur sprachlich analysieren dürfe.
11 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
12 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
13 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
14 Vgl. Jürgen Herold, Der Aufenthalt des Markgrafen Gianfrancesco Gonzaga zur Erziehung an
den Höfen der fränkischen Markgrafen von Brandenburg 1455-1459. Zur Funktionsweise und
zu den Medien der Kommunikation zwischen Mantua und Franken im Spätmittelalter, in: Prin-
cipes (wie Anm. 2), S. 199-234, hier S. 229. Herold weist darauf hin, dass in den Briefen Hoch-
adeliger »nur in seltenen Fällen Begebenheiten und Anliegen vollständig und umfassend dar-
gestellt werden.« So wurden, besonders in wichtigen Angelegenheiten, dem Boten zusätzlich
zum Brief selber noch mündliche Mitteilungen an den Empfänger mitgegeben, so dass sich im
Schreiben selber nur Andeutungen auf den zu vermittelnden Sachverhalt finden.
15 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 173.
16 Nolte, Familienkorrespondenz (wie Anm. 3), S. 183, S. 193f.
17 Zu der Problematik von Kanzleibriefen vgl. Herold, Gonzaga (wie Anm. 14), S. 219. Herold
stellt am Beispiel des Briefwechsels von Markgraf Gianfrancesco Gonzaga mit seinen Eltern
Ilona Fendrich
Als die geeignetste Methode, die genannten Aspekte zu untersuchen, erscheint
die sprachliche Analyse der Briefe.10 Wie Fouquet konstatiert, stellten »Dictatoren
wie Schreiber (...) im Brief direkte Emotionalität rhetorisch her, ja erzwangen sie mit
Hilfe bestimmter Stil- und Ausdrucksmittel.«11 Neben der Anwendung von sprach-
lichen Mitteln wie Übertreibung oder Steigerung konnte dies »in der Gestaltung des
Briefformulars, im situationsabhängigen Changieren des Ihrzens und Duzens, im
Spiel mit der Bestätigung und Durchbrechung von höfischem Zeremoniell und
Konvention«12 erfolgen. Die Anwendung wie die intendierte Wirkung solcher rhe-
torischer Stilmittel zu analysieren, eröffnet einen direkten Zugang zu den dahinter-
stehenden Gefühlen und Zielen des Briefschreibers. Ob und welche der genannten
Mittel performativen Sprechens13 in den Briefen des Kurfürstenpaares angewandt
wurden und welche Wirkungsabsicht damit verfolgt wurde, soll im Folgenden
genauer untersucht werden. Natürlich sind auch der sprachanalytischen Methode
Grenzen gesetzt. Wie bereits erläutert, enthalten Briefe im Allgemeinen Submittei-
lungen und Doppeldeutigkeiten, die für den Außenstehenden nicht verständlich
und auch mit der sprachanalytischen Methode nur bedingt erfassbar sind.14 Eine
zweite Schwierigkeit bei der Analyse und Interpretation der Privatbriefe des Hoch-
adels liegt darin, »die Parallelisierungen und das verschlungene Ineinander von
konventionellem Rollenverhalten und Individualität, die Verschränkungen von
höfischer Norm, Zeremoniell, vorgegebenen Personenbeziehungen und Persönlich-
keit, von Nonverbalem, Mündlichem und Schriftlichen aufzubrechen und zu deco-
dieren.«15 Drittens handelt es sich bei dem Briefwechsel des Kurfürstenpaares aus-
schließlich um Kanzleibriefe und nicht um Autographen. Nolte konstatiert zwar,
dass sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Qualität persönlicher und
emotionaler Aussagen zwischen eigenhändig verfassten Briefen und Kanzleischrei-
ben feststellen lassen.16 Dennoch liegt es auf der Hand, dass erstere eine größere
Authentizität aufweisen, eben weil sie wirklich aus der Feder des Briefschreibers
stammten und er seine Gedanken und Gefühle selber formulieren musste. Aus die-
sem Grunde sind Autographen im Gegensatz zu Kanzleischreiben wirkliche und
unmittelbare Selbstzeugnisse.17 Viertens spiegelt der Briefwechsel des Kurfürsten-
10 So stellt z. B. Nolte, Kommunikation (wie Anm. 1), S. 452f in Bezug auf die verbal-erotische
Kommunikation des Kurfürstenpaares fest, dass man die sexuellen Äußerungen in den Briefen
nicht wörtlich verstehen oder gar auslegen, sondern sie nur sprachlich analysieren dürfe.
11 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
12 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
13 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 191.
14 Vgl. Jürgen Herold, Der Aufenthalt des Markgrafen Gianfrancesco Gonzaga zur Erziehung an
den Höfen der fränkischen Markgrafen von Brandenburg 1455-1459. Zur Funktionsweise und
zu den Medien der Kommunikation zwischen Mantua und Franken im Spätmittelalter, in: Prin-
cipes (wie Anm. 2), S. 199-234, hier S. 229. Herold weist darauf hin, dass in den Briefen Hoch-
adeliger »nur in seltenen Fällen Begebenheiten und Anliegen vollständig und umfassend dar-
gestellt werden.« So wurden, besonders in wichtigen Angelegenheiten, dem Boten zusätzlich
zum Brief selber noch mündliche Mitteilungen an den Empfänger mitgegeben, so dass sich im
Schreiben selber nur Andeutungen auf den zu vermittelnden Sachverhalt finden.
15 Fouquet, Fürsten (wie Anm. 2), S. 173.
16 Nolte, Familienkorrespondenz (wie Anm. 3), S. 183, S. 193f.
17 Zu der Problematik von Kanzleibriefen vgl. Herold, Gonzaga (wie Anm. 14), S. 219. Herold
stellt am Beispiel des Briefwechsels von Markgraf Gianfrancesco Gonzaga mit seinen Eltern