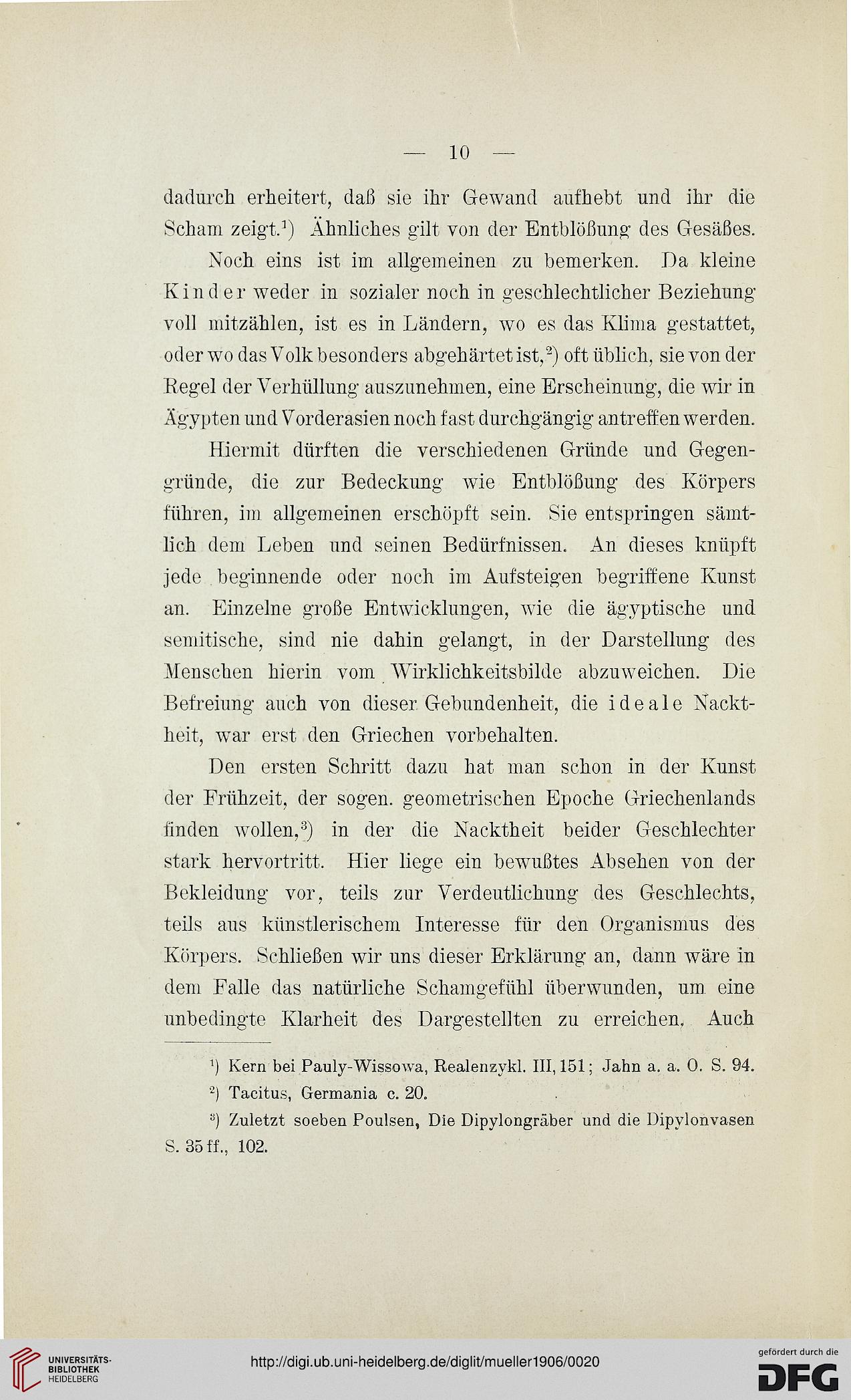— 10
dadurch erheitert, daß sie ihr Gewand aufhebt und ihr die
Scham zeigt.1) Ähnliches gilt von der Entblößung- des Gesäßes.
Noch eins ist im allgemeinen zu bemerken. Da kleine
Kinder weder in sozialer noch in geschlechtlicher Beziehung
voll mitzählen, ist es in Ländern, wo es das Klima gestattet,
oder wo das Volk besonders abgehärtet ist,2) oft üblich, sie von der
Regel der Verhüllung auszunehmen, eine Erscheinung, die wir in
Ägypten und Vorderasien noch fast durchgängig antreffen werden.
Hiermit dürften die verschiedenen Gründe und Gegen-
gründe, die zur Bedeckung wie Entblößung des Körpers
führen, im allgemeinen erschöpft sein. Sie entspringen sämt-
lich dem Leben und seinen Bedürfnissen. An dieses knüpft
jede beginnende oder noch im Aufsteigen begriffene Kunst
an. Einzelne große Entwicklungen, wie die ägyptische und
semitische, sind nie dahin gelangt, in der Darstellung des
Menschen hierin vom Wirklichkeitsbilde abzuweichen. Die
Befreiung auch von dieser Gebundenheit, die ideale Nackt-
heit, war erst den Griechen vorbehalten.
Den ersten Schritt dazu hat man schon in der Kunst
der Frühzeit, der sogen, geometrischen Epoche Griechenlands
finden wollen,3) in der die Nacktheit beider Geschlechter
stark hervortritt. Hier liege ein bewußtes Absehen von der
Bekleidung vor, teils zur Verdeutlichung des Geschlechts,
teils aus künstlerischem Interesse für den Organismus des
Körpers. Schließen wir uns dieser Erklärung an, dann wäre in
dem Falle das natürliche Schamgefühl überwunden, um eine
unbedingte Klarheit des Dargestellten zu erreichen, Auch
1) Kern bei Pauly-Wissowa, Realenzykl. III, 151; Jahn a. a. 0. S. 94.
2) Tacitus, Germania c. 20.
8) Zuletzt soeben Poulsen, Die Dipylongräber und die Dipylonvasen
S. 35 ff., 102.
dadurch erheitert, daß sie ihr Gewand aufhebt und ihr die
Scham zeigt.1) Ähnliches gilt von der Entblößung- des Gesäßes.
Noch eins ist im allgemeinen zu bemerken. Da kleine
Kinder weder in sozialer noch in geschlechtlicher Beziehung
voll mitzählen, ist es in Ländern, wo es das Klima gestattet,
oder wo das Volk besonders abgehärtet ist,2) oft üblich, sie von der
Regel der Verhüllung auszunehmen, eine Erscheinung, die wir in
Ägypten und Vorderasien noch fast durchgängig antreffen werden.
Hiermit dürften die verschiedenen Gründe und Gegen-
gründe, die zur Bedeckung wie Entblößung des Körpers
führen, im allgemeinen erschöpft sein. Sie entspringen sämt-
lich dem Leben und seinen Bedürfnissen. An dieses knüpft
jede beginnende oder noch im Aufsteigen begriffene Kunst
an. Einzelne große Entwicklungen, wie die ägyptische und
semitische, sind nie dahin gelangt, in der Darstellung des
Menschen hierin vom Wirklichkeitsbilde abzuweichen. Die
Befreiung auch von dieser Gebundenheit, die ideale Nackt-
heit, war erst den Griechen vorbehalten.
Den ersten Schritt dazu hat man schon in der Kunst
der Frühzeit, der sogen, geometrischen Epoche Griechenlands
finden wollen,3) in der die Nacktheit beider Geschlechter
stark hervortritt. Hier liege ein bewußtes Absehen von der
Bekleidung vor, teils zur Verdeutlichung des Geschlechts,
teils aus künstlerischem Interesse für den Organismus des
Körpers. Schließen wir uns dieser Erklärung an, dann wäre in
dem Falle das natürliche Schamgefühl überwunden, um eine
unbedingte Klarheit des Dargestellten zu erreichen, Auch
1) Kern bei Pauly-Wissowa, Realenzykl. III, 151; Jahn a. a. 0. S. 94.
2) Tacitus, Germania c. 20.
8) Zuletzt soeben Poulsen, Die Dipylongräber und die Dipylonvasen
S. 35 ff., 102.