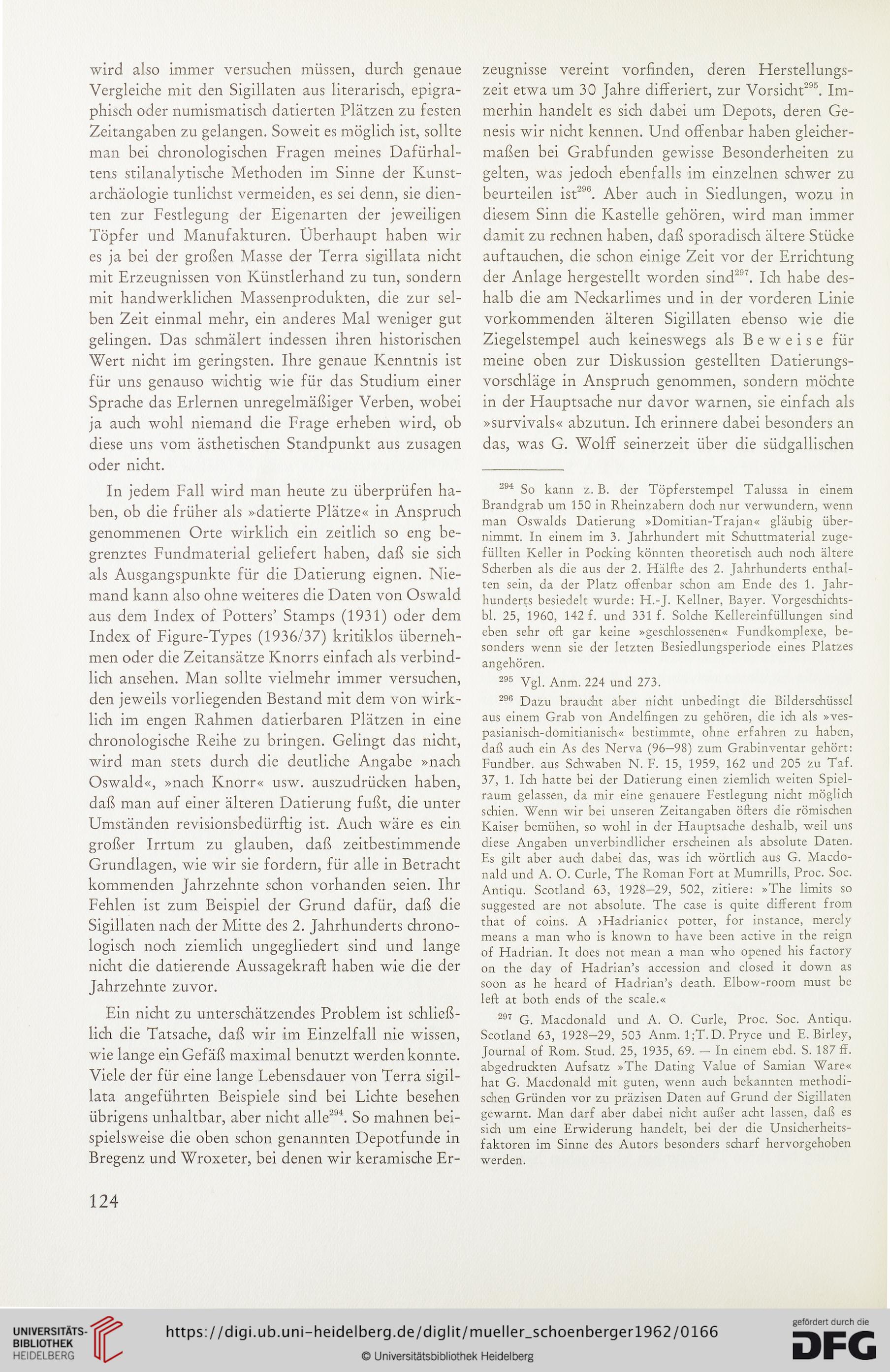wird also immer versuchen müssen, durch genaue
Vergleiche mit den Sigillaten aus literarisch, epigra-
phisch oder numismatisch datierten Plätzen zu festen
Zeitangaben zu gelangen. Soweit es möglich ist, sollte
man bei chronologischen Fragen meines Dafürhal-
tens stilanalytische Methoden im Sinne der Kunst-
archäologie tunlichst vermeiden, es sei denn, sie dien-
ten zur Festlegung der Eigenarten der jeweiligen
Töpfer und Manufakturen. Überhaupt haben wir
es ja bei der großen Masse der Terra sigillata nicht
mit Erzeugnissen von Künstlerhand zu tun, sondern
mit handwerklichen Massenprodukten, die zur sel-
ben Zeit einmal mehr, ein anderes Mal weniger gut
gelingen. Das schmälert indessen ihren historischen
Wert nicht im geringsten. Ihre genaue Kenntnis ist
für uns genauso wichtig wie für das Studium einer
Sprache das Erlernen unregelmäßiger Verben, wobei
ja auch wohl niemand die Frage erheben wird, ob
diese uns vom ästhetischen Standpunkt aus zusagen
oder nicht.
In jedem Fall wird man heute zu überprüfen ha-
ben, ob die früher als »datierte Plätze« in Anspruch
genommenen Orte wirklich ein zeitlich so eng be-
grenztes Fundmaterial geliefert haben, daß sie sich
als Ausgangspunkte für die Datierung eignen. Nie-
mand kann also ohne weiteres die Daten von Oswald
aus dem Index of Potters’ Stamps (1931) oder dem
Index of Figure-Types (1936/37) kritiklos überneh-
men oder die Zeitansätze Knorrs einfach als verbind-
lich ansehen. Man sollte vielmehr immer versuchen,
den jeweils vorliegenden Bestand mit dem von wirk-
lich im engen Rahmen datierbaren Plätzen in eine
chronologische Reihe zu bringen. Gelingt das nicht,
wird man stets durch die deutliche Angabe »nach
Oswald«, »nach Knorr« usw. auszudrücken haben,
daß man auf einer älteren Datierung fußt, die unter
Umständen revisionsbedürftig ist. Auch wäre es ein
großer Irrtum zu glauben, daß zeitbestimmende
Grundlagen, wie wir sie fordern, für alle in Betracht
kommenden Jahrzehnte schon vorhanden seien. Ihr
Fehlen ist zum Beispiel der Grund dafür, daß die
Sigillaten nach der Mitte des 2. Jahrhunderts chrono-
logisch noch ziemlich ungegliedert sind und lange
nicht die datierende Aussagekraft haben wie die der
Jahrzehnte zuvor.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist schließ-
lich die Tatsache, daß wir im Einzelfall nie wissen,
wie lange ein Gefäß maximal benutzt werden konnte.
Viele der für eine lange Lebensdauer von Terra sigil-
lata angeführten Beispiele sind bei Lichte besehen
übrigens unhaltbar, aber nicht alle294. So mahnen bei-
spielsweise die oben schon genannten Depotfunde in
Bregenz und Wroxeter, bei denen wir keramische Er-
zeugnisse vereint vorfinden, deren Herstellungs-
zeit etwa um 30 Jahre differiert, zur Vorsicht295. Im-
merhin handelt es sich dabei um Depots, deren Ge-
nesis wir nicht kennen. Und offenbar haben gleicher-
maßen bei Grabfunden gewisse Besonderheiten zu
gelten, was jedoch ebenfalls im einzelnen schwer zu
beurteilen ist296. Aber auch in Siedlungen, wozu in
diesem Sinn die Kastelle gehören, wird man immer
damit zu rechnen haben, daß sporadisch ältere Stücke
auftauchen, die schon einige Zeit vor der Errichtung
der Anlage hergestellt worden sind297. Ich habe des-
halb die am Neckarlimes und in der vorderen Linie
vorkommenden älteren Sigillaten ebenso wie die
Ziegelstempel auch keineswegs als Beweise für
meine oben zur Diskussion gestellten Datierungs-
vorschläge in Anspruch genommen, sondern möchte
in der Hauptsache nur davor warnen, sie einfach als
»survivals« abzutun. Ich erinnere dabei besonders an
das, was G. Wolff seinerzeit über die südgallischen
294 So kann z. B. der Töpferstempel Talussa in einem
Brandgrab um 150 in Rheinzabern doch nur verwundern, wenn
man Oswalds Datierung »Domitian-Trajan« gläubig über-
nimmt. In einem im 3. Jahrhundert mit Schuttmaterial zuge-
füllten Keller in Pocking könnten theoretisch auch noch ältere
Scherben als die aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts enthal-
ten sein, da der Platz offenbar schon am Ende des 1. Jahr-
hunderts besiedelt wurde: H.-J. Kellner, Bayer. Vorgeschichts-
bl. 25, 1960, 142 f. und 331 f. Solche Kellereinfüllungen sind
eben sehr oft gar keine »geschlossenen« Fundkomplexe, be-
sonders wenn sie der letzten Besiedlungsperiode eines Platzes
angehören.
295 Vgl. Anm. 224 und 273.
206 Dazu braucht aber nicht unbedingt die Bilderschüssel
aus einem Grab von Andelfingen zu gehören, die ich als »ves-
pasianisch-domitianisch« bestimmte, ohne erfahren zu haben,
daß auch ein As des Nerva (96—98) zum Grabinventar gehört:
Fundber. aus Schwaben N. F. 15, 1959, 162 und 205 zu Taf.
37, 1. Ich hatte bei der Datierung einen ziemlich weiten Spiel-
raum gelassen, da mir eine genauere Festlegung nicht möglich
schien. Wenn wir bei unseren Zeitangaben öfters die römischen
Kaiser bemühen, so wohl in der Hauptsache deshalb, weil uns
diese Angaben unverbindlicher erscheinen als absolute Daten.
Es gilt aber auch dabei das, was ich wörtlich aus G. Macdo-
nald und A. O. Curie, The Roman Fort at Mumrills, Proc. Soc.
Antiqu. Scotland 63, 1928—29, 502, zitiere: »The limits so
suggested are not absolute. The case is quite different from
that of coins. A >Hadrianic< potter, for instance, merely
means a man who is known to have been active in the reign
of Hadrian. It does not mean a man who opened his factory
on the day of Hadrian’s accession and closed it down as
soon as he heard of Hadrian’s death. Elbow-room must be
left at both ends of the scale.«
297 G. Macdonald und A. O. Curie, Proc. Soc. Antiqu.
Scotland 63, 1928—29, 503 Anm. 1;T. D. Pryce und E. Birley,
Journal of Rom. Stud. 25, 1935, 69. — In einem ebd. S. 187 ff.
abgedruckten Aufsatz »The Dating Value of Samian Ware«
hat G. Macdonald mit guten, wenn auch bekannten methodi-
schen Gründen vor zu präzisen Daten auf Grund der Sigillaten
gewarnt. Man darf aber dabei nicht außer acht lassen, daß es
sich um eine Erwiderung handelt, bei der die Unsicherheits-
faktoren im Sinne des Autors besonders scharf hervorgehoben
werden.
124
Vergleiche mit den Sigillaten aus literarisch, epigra-
phisch oder numismatisch datierten Plätzen zu festen
Zeitangaben zu gelangen. Soweit es möglich ist, sollte
man bei chronologischen Fragen meines Dafürhal-
tens stilanalytische Methoden im Sinne der Kunst-
archäologie tunlichst vermeiden, es sei denn, sie dien-
ten zur Festlegung der Eigenarten der jeweiligen
Töpfer und Manufakturen. Überhaupt haben wir
es ja bei der großen Masse der Terra sigillata nicht
mit Erzeugnissen von Künstlerhand zu tun, sondern
mit handwerklichen Massenprodukten, die zur sel-
ben Zeit einmal mehr, ein anderes Mal weniger gut
gelingen. Das schmälert indessen ihren historischen
Wert nicht im geringsten. Ihre genaue Kenntnis ist
für uns genauso wichtig wie für das Studium einer
Sprache das Erlernen unregelmäßiger Verben, wobei
ja auch wohl niemand die Frage erheben wird, ob
diese uns vom ästhetischen Standpunkt aus zusagen
oder nicht.
In jedem Fall wird man heute zu überprüfen ha-
ben, ob die früher als »datierte Plätze« in Anspruch
genommenen Orte wirklich ein zeitlich so eng be-
grenztes Fundmaterial geliefert haben, daß sie sich
als Ausgangspunkte für die Datierung eignen. Nie-
mand kann also ohne weiteres die Daten von Oswald
aus dem Index of Potters’ Stamps (1931) oder dem
Index of Figure-Types (1936/37) kritiklos überneh-
men oder die Zeitansätze Knorrs einfach als verbind-
lich ansehen. Man sollte vielmehr immer versuchen,
den jeweils vorliegenden Bestand mit dem von wirk-
lich im engen Rahmen datierbaren Plätzen in eine
chronologische Reihe zu bringen. Gelingt das nicht,
wird man stets durch die deutliche Angabe »nach
Oswald«, »nach Knorr« usw. auszudrücken haben,
daß man auf einer älteren Datierung fußt, die unter
Umständen revisionsbedürftig ist. Auch wäre es ein
großer Irrtum zu glauben, daß zeitbestimmende
Grundlagen, wie wir sie fordern, für alle in Betracht
kommenden Jahrzehnte schon vorhanden seien. Ihr
Fehlen ist zum Beispiel der Grund dafür, daß die
Sigillaten nach der Mitte des 2. Jahrhunderts chrono-
logisch noch ziemlich ungegliedert sind und lange
nicht die datierende Aussagekraft haben wie die der
Jahrzehnte zuvor.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem ist schließ-
lich die Tatsache, daß wir im Einzelfall nie wissen,
wie lange ein Gefäß maximal benutzt werden konnte.
Viele der für eine lange Lebensdauer von Terra sigil-
lata angeführten Beispiele sind bei Lichte besehen
übrigens unhaltbar, aber nicht alle294. So mahnen bei-
spielsweise die oben schon genannten Depotfunde in
Bregenz und Wroxeter, bei denen wir keramische Er-
zeugnisse vereint vorfinden, deren Herstellungs-
zeit etwa um 30 Jahre differiert, zur Vorsicht295. Im-
merhin handelt es sich dabei um Depots, deren Ge-
nesis wir nicht kennen. Und offenbar haben gleicher-
maßen bei Grabfunden gewisse Besonderheiten zu
gelten, was jedoch ebenfalls im einzelnen schwer zu
beurteilen ist296. Aber auch in Siedlungen, wozu in
diesem Sinn die Kastelle gehören, wird man immer
damit zu rechnen haben, daß sporadisch ältere Stücke
auftauchen, die schon einige Zeit vor der Errichtung
der Anlage hergestellt worden sind297. Ich habe des-
halb die am Neckarlimes und in der vorderen Linie
vorkommenden älteren Sigillaten ebenso wie die
Ziegelstempel auch keineswegs als Beweise für
meine oben zur Diskussion gestellten Datierungs-
vorschläge in Anspruch genommen, sondern möchte
in der Hauptsache nur davor warnen, sie einfach als
»survivals« abzutun. Ich erinnere dabei besonders an
das, was G. Wolff seinerzeit über die südgallischen
294 So kann z. B. der Töpferstempel Talussa in einem
Brandgrab um 150 in Rheinzabern doch nur verwundern, wenn
man Oswalds Datierung »Domitian-Trajan« gläubig über-
nimmt. In einem im 3. Jahrhundert mit Schuttmaterial zuge-
füllten Keller in Pocking könnten theoretisch auch noch ältere
Scherben als die aus der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts enthal-
ten sein, da der Platz offenbar schon am Ende des 1. Jahr-
hunderts besiedelt wurde: H.-J. Kellner, Bayer. Vorgeschichts-
bl. 25, 1960, 142 f. und 331 f. Solche Kellereinfüllungen sind
eben sehr oft gar keine »geschlossenen« Fundkomplexe, be-
sonders wenn sie der letzten Besiedlungsperiode eines Platzes
angehören.
295 Vgl. Anm. 224 und 273.
206 Dazu braucht aber nicht unbedingt die Bilderschüssel
aus einem Grab von Andelfingen zu gehören, die ich als »ves-
pasianisch-domitianisch« bestimmte, ohne erfahren zu haben,
daß auch ein As des Nerva (96—98) zum Grabinventar gehört:
Fundber. aus Schwaben N. F. 15, 1959, 162 und 205 zu Taf.
37, 1. Ich hatte bei der Datierung einen ziemlich weiten Spiel-
raum gelassen, da mir eine genauere Festlegung nicht möglich
schien. Wenn wir bei unseren Zeitangaben öfters die römischen
Kaiser bemühen, so wohl in der Hauptsache deshalb, weil uns
diese Angaben unverbindlicher erscheinen als absolute Daten.
Es gilt aber auch dabei das, was ich wörtlich aus G. Macdo-
nald und A. O. Curie, The Roman Fort at Mumrills, Proc. Soc.
Antiqu. Scotland 63, 1928—29, 502, zitiere: »The limits so
suggested are not absolute. The case is quite different from
that of coins. A >Hadrianic< potter, for instance, merely
means a man who is known to have been active in the reign
of Hadrian. It does not mean a man who opened his factory
on the day of Hadrian’s accession and closed it down as
soon as he heard of Hadrian’s death. Elbow-room must be
left at both ends of the scale.«
297 G. Macdonald und A. O. Curie, Proc. Soc. Antiqu.
Scotland 63, 1928—29, 503 Anm. 1;T. D. Pryce und E. Birley,
Journal of Rom. Stud. 25, 1935, 69. — In einem ebd. S. 187 ff.
abgedruckten Aufsatz »The Dating Value of Samian Ware«
hat G. Macdonald mit guten, wenn auch bekannten methodi-
schen Gründen vor zu präzisen Daten auf Grund der Sigillaten
gewarnt. Man darf aber dabei nicht außer acht lassen, daß es
sich um eine Erwiderung handelt, bei der die Unsicherheits-
faktoren im Sinne des Autors besonders scharf hervorgehoben
werden.
124