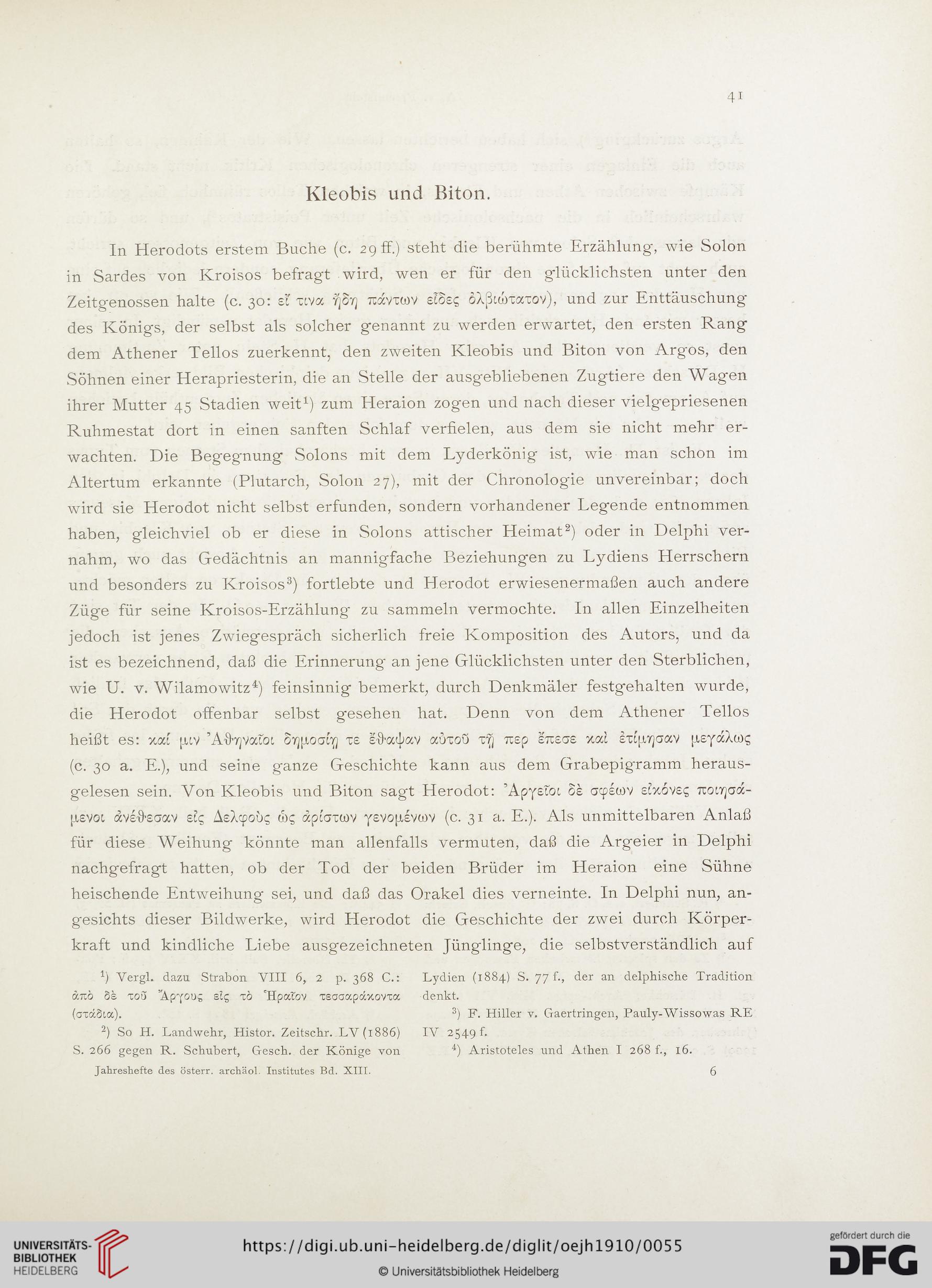4i
Kleobis und Biton.
In Herodots erstem Buche (c. 29 ff.) steht die berühmte Erzählung, wie Solon
in Sardes von Kroisos befragt wird, wen er für den glücklichsten unter den
Zeitgenossen halte (c. 30: ec τινα ήδη πάντων είδες δλβιώτατον), und zur Enttäuschung
des Königs, der selbst als solcher genannt zu werden erwartet, den ersten Rang
dem Athener Tellos zuerkennt, den zweiten Kleobis und Biton von Argos, den
Söhnen einer Herapriesterin, die an Stelle der ausgebliebenen Zugtiere den Wagen
ihrer Mutter 45 Stadien weit1) zum Heraion zogen und nach dieser vielgepriesenen
Ruhmestat dort in einen sanften Schlaf verfielen, aus dem sie nicht mehr er-
wachten. Die Begegnung Solons mit dem Lyderkönig ist, wie man schon im
Altertum erkannte (Plutarch, Solon 27), mit der Chronologie unvereinbar; doch
wird sie Herodot nicht selbst erfunden, sondern vorhandener Legende entnommen
haben, gleichviel ob er diese in Solons attischer Heimat2) oder in Delphi ver-
nahm, wo das Gedächtnis an mannigfache Beziehungen zu Lydiens Herrschern
und besonders zu Kroisos3) fortlebte und Herodot erwiesenermaßen auch andere
Züge für seine Kroisos-Erzählung zu sammeln vermochte. In allen Einzelheiten
jedoch ist jenes Zwiegespräch sicherlich freie Komposition des Autors, und da
ist es bezeichnend, daß die Erinnerung an jene Glücklichsten unter den Sterblichen,
wie U. v. Wilamowitz1) feinsinnig bemerkt, durch Denkmäler festgehalten wurde,
die Herodot offenbar selbst gesehen hat. Denn von dem Athener Tellos
heißt es: καί μιν Αθηναίοι δημοσίη τε έθαψαν αύτοΰ τή περ έπεσε καί έτίμησαν μεγάλως
(c. 30 a. Ε.), und seine ganze Geschichte kann aus dem Grabepigramm heraus-
gelesen sein. Von Kleobis und Biton sagt Herodot: Αργείο: δε σφέων εικόνες ποιησά-
μενοι ανέθεσαν εις Δελφούς ώς αρίστων γενομένων (c. 31 a. Ε.). Als unmittelbaren Anlaß
für diese Weihung könnte man allenfalls vermuten, daß die Argeier in Delphi
nachgefragt hatten, ob der Tod der beiden Brüder im Heraion eine Sühne
heischende Entweihung sei, und daß das Orakel dies verneinte. In Delphi nun, an-
gesichts dieser Bildwerke, wird Herodot die Geschichte der zwei durch Körper-
kraft und kindliche Liebe ausgezeichneten Jünglinge, die selbstverständlich auf
1) Vergl. dazu Strabon VIII 6, 2 p. 368 C.:
από δε του Αργους εις τδ Ήραΐον τεσσαράκοντα
(στάδια).
2) So Η. Landwehr, Histor. Zeitschr. LV (ι 886)
S. 266 gegen R. Schubert, Gesch. der Könige von
Jahreshefte des österr. archäol. Institutes Bd. XIII.
Lydien (1884) S. 77 f., der an delphische Tradition
denkt.
3) F. Hiller v. Gaertringen, Pauly-Wissowas RE
IV 2549 f.
4) Aristoteles und Athen I 268 f., 16.
6
Kleobis und Biton.
In Herodots erstem Buche (c. 29 ff.) steht die berühmte Erzählung, wie Solon
in Sardes von Kroisos befragt wird, wen er für den glücklichsten unter den
Zeitgenossen halte (c. 30: ec τινα ήδη πάντων είδες δλβιώτατον), und zur Enttäuschung
des Königs, der selbst als solcher genannt zu werden erwartet, den ersten Rang
dem Athener Tellos zuerkennt, den zweiten Kleobis und Biton von Argos, den
Söhnen einer Herapriesterin, die an Stelle der ausgebliebenen Zugtiere den Wagen
ihrer Mutter 45 Stadien weit1) zum Heraion zogen und nach dieser vielgepriesenen
Ruhmestat dort in einen sanften Schlaf verfielen, aus dem sie nicht mehr er-
wachten. Die Begegnung Solons mit dem Lyderkönig ist, wie man schon im
Altertum erkannte (Plutarch, Solon 27), mit der Chronologie unvereinbar; doch
wird sie Herodot nicht selbst erfunden, sondern vorhandener Legende entnommen
haben, gleichviel ob er diese in Solons attischer Heimat2) oder in Delphi ver-
nahm, wo das Gedächtnis an mannigfache Beziehungen zu Lydiens Herrschern
und besonders zu Kroisos3) fortlebte und Herodot erwiesenermaßen auch andere
Züge für seine Kroisos-Erzählung zu sammeln vermochte. In allen Einzelheiten
jedoch ist jenes Zwiegespräch sicherlich freie Komposition des Autors, und da
ist es bezeichnend, daß die Erinnerung an jene Glücklichsten unter den Sterblichen,
wie U. v. Wilamowitz1) feinsinnig bemerkt, durch Denkmäler festgehalten wurde,
die Herodot offenbar selbst gesehen hat. Denn von dem Athener Tellos
heißt es: καί μιν Αθηναίοι δημοσίη τε έθαψαν αύτοΰ τή περ έπεσε καί έτίμησαν μεγάλως
(c. 30 a. Ε.), und seine ganze Geschichte kann aus dem Grabepigramm heraus-
gelesen sein. Von Kleobis und Biton sagt Herodot: Αργείο: δε σφέων εικόνες ποιησά-
μενοι ανέθεσαν εις Δελφούς ώς αρίστων γενομένων (c. 31 a. Ε.). Als unmittelbaren Anlaß
für diese Weihung könnte man allenfalls vermuten, daß die Argeier in Delphi
nachgefragt hatten, ob der Tod der beiden Brüder im Heraion eine Sühne
heischende Entweihung sei, und daß das Orakel dies verneinte. In Delphi nun, an-
gesichts dieser Bildwerke, wird Herodot die Geschichte der zwei durch Körper-
kraft und kindliche Liebe ausgezeichneten Jünglinge, die selbstverständlich auf
1) Vergl. dazu Strabon VIII 6, 2 p. 368 C.:
από δε του Αργους εις τδ Ήραΐον τεσσαράκοντα
(στάδια).
2) So Η. Landwehr, Histor. Zeitschr. LV (ι 886)
S. 266 gegen R. Schubert, Gesch. der Könige von
Jahreshefte des österr. archäol. Institutes Bd. XIII.
Lydien (1884) S. 77 f., der an delphische Tradition
denkt.
3) F. Hiller v. Gaertringen, Pauly-Wissowas RE
IV 2549 f.
4) Aristoteles und Athen I 268 f., 16.
6