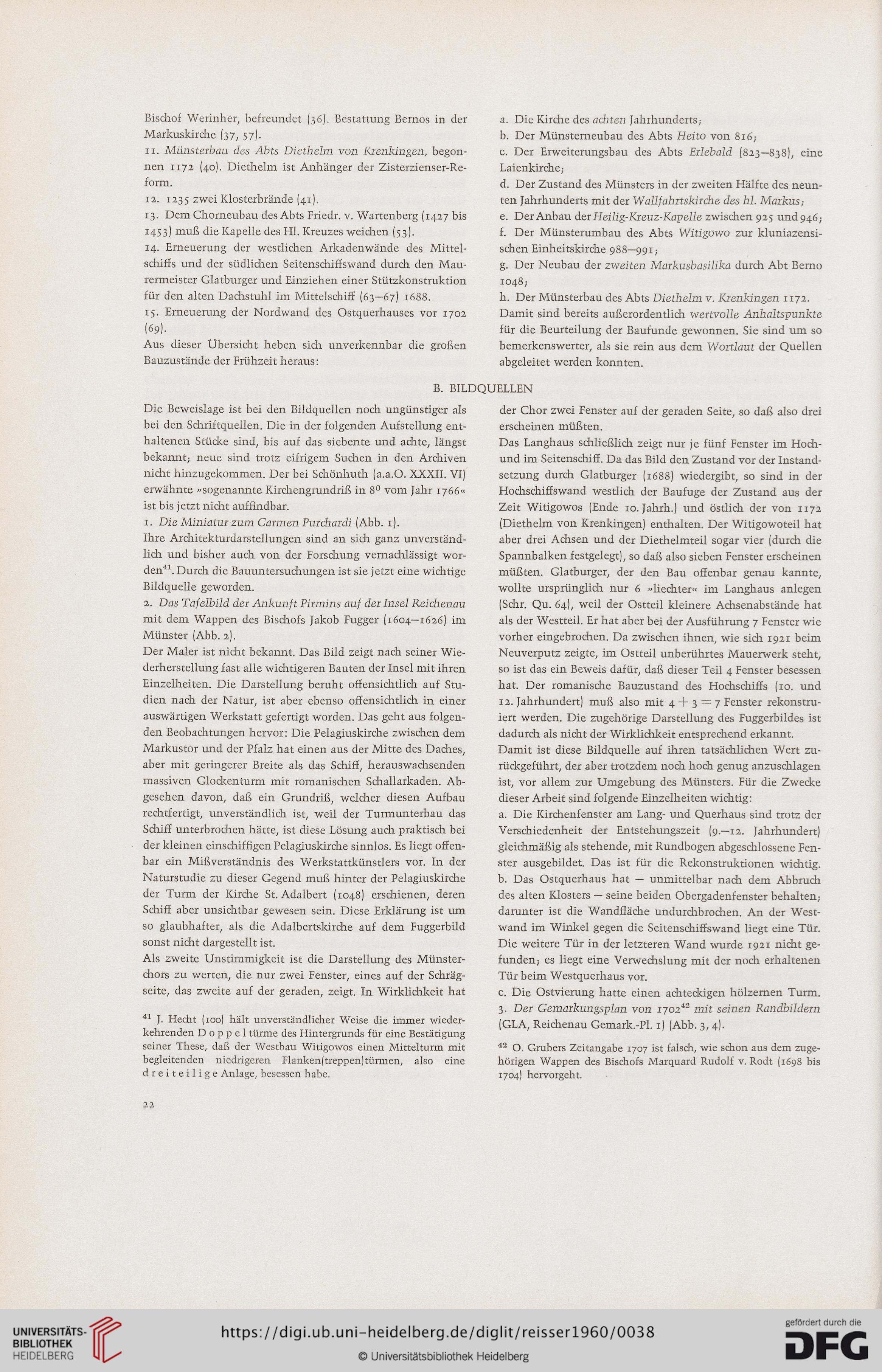Bischof Werinher, befreundet (36). Bestattung Bernos in der
Markuskirche (37, 57).
11. Münsterbau des Abts Diethelm von Krenkingen, begon-
nen 1172 (40). Diethelm ist Anhänger der Zisterzienser-Re-
form.
12. 1235 zwei Klosterbrände (41).
13. Dem Chorneubau des Abts Friedr. v. Wartenberg (1427 bis
1453) muß die Kapelle des Hl. Kreuzes weichen (53).
14. Erneuerung der westlichen Arkaden wände des Mittel-
schiffs und der südlichen Seitenschiffswand durch den Mau-
rermeister Glatburger und Einziehen einer Stützkonstruktion
für den alten Dachstuhl im Mittelschiff (63—67) 1688.
15. Erneuerung der Nordwand des Ostquerhauses vor 1702
(69).
Aus dieser Übersicht heben sich unverkennbar die großen
Bauzustände der Frühzeit heraus:
a. Die Kirche des achten Jahrhunderts;
b. Der Münsterneubau des Abts Heito von 816;
c. Der Erweiterungsbau des Abts Erlebald (823—838), eine
Laienkirche;
d. Der Zustand des Münsters in der zweiten Hälfte des neun-
ten Jahrhunderts mit der Wallfahrtskirche des hl. Markus;
e. Der Anbau der Heilig-Kreuz-Kapelle zwischen 925 und 946;
f. Der Münsterumbau des Abts Witigowo zur kluniazensi-
schen Einheitskirche 988—991;
g. Der Neubau der zweiten Markusbasilika durch Abt Berno
1048;
h. Der Münsterbau des Abts Diethelm v. Krenkingen 1172.
Damit sind bereits außerordentlich wertvolle Anhaltspunkte
für die Beurteilung der Baufunde gewonnen. Sie sind um so
bemerkenswerter, als sie rein aus dem Wortlaut der Quellen
abgeleitet werden konnten.
B. BILDQUELLEN
Die Beweislage ist bei den Bildquellen noch ungünstiger als
bei den Schriftquellen. Die in der folgenden Aufstellung ent-
haltenen Stücke sind, bis auf das siebente und achte, längst
bekannt; neue sind trotz eifrigem Suchen in den Archiven
nicht hinzugekommen. Der bei Schönhuth (a.a.O. XXXII. VI)
erwähnte «sogenannte Kirchengrundriß in 8° vom Jahr 1766«
ist bis jetzt nicht auffindbar.
1. Die Miniatur zum Carmen Purchardi (Abb. 1).
Ihre Architekturdarstellungen sind an sich ganz unverständ-
lich und bisher auch von der Forschung vernachlässigt wor-
den41. Durch die Bauuntersuchungen ist sie jetzt eine wichtige
Bildquelle geworden.
2. Das Tafelbild der Ankunft Pirmins auf der Insel Reichenau
mit dem Wappen des Bischofs Jakob Fugger (1604—1626) im
Münster (Abb. 2).
Der Maler ist nicht bekannt. Das Bild zeigt nach seiner Wie-
derherstellung fast alle wichtigeren Bauten der Insel mit ihren
Einzelheiten. Die Darstellung beruht offensichtlich auf Stu-
dien nach der Natur, ist aber ebenso offensichtlich in einer
auswärtigen Werkstatt gefertigt worden. Das geht aus folgen-
den Beobachtungen hervor: Die Pelagiuskirche zwischen dem
Markustor und der Pfalz hat einen aus der Mitte des Daches,
aber mit geringerer Breite als das Schiff, herauswachsenden
massiven Glockenturm mit romanischen Schallarkaden. Ab-
gesehen davon, daß ein Grundriß, welcher diesen Aufbau
rechtfertigt, unverständlich ist, weil der Turmunterbau das
Schiff unterbrochen hätte, ist diese Lösung auch praktisch bei
der kleinen einschiffigen Pelagiuskirche sinnlos. Es liegt offen-
bar ein Mißverständnis des Werkstattkünstlers vor. In der
Naturstudie zu dieser Gegend muß hinter der Pelagiuskirche
der Turm der Kirche St. Adalbert (1048) erschienen, deren
Schiff aber unsichtbar gewesen sein. Diese Erklärung ist um
so glaubhafter, als die Adalbertskirche auf dem Fuggerbild
sonst nicht dargestellt ist.
Als zweite Unstimmigkeit ist die Darstellung des Münster-
chors zu werten, die nur zwei Fenster, eines auf der Schräg-
seite, das zweite auf der geraden, zeigt. In Wirklichkeit hat
41 J. Hecht (100) hält unverständlicher Weise die immer wieder-
kehrenden Doppel türme des Hintergrunds für eine Bestätigung
seiner These, daß der Westbau Witigowos einen Mittelturm mit
begleitenden niedrigeren Flanken(treppen)türmen, also eine
dreiteilige Anlage, besessen habe.
der Chor zwei Fenster auf der geraden Seite, so daß also drei
erscheinen müßten.
Das Langhaus schließlich zeigt nur je fünf Fenster im Hoch-
und im Seitenschiff. Da das Bild den Zustand vor der Instand-
setzung durch Glatburger (1688) wiedergibt, so sind in der
Hochschiffswand westlich der Baufuge der Zustand aus der
Zeit Witigowos (Ende 10. Jahrh.) und östlich der von 1172
(Diethelm von Krenkingen) enthalten. Der Witigowoteil hat
aber drei Achsen und der Diethelmteil sogar vier (durch die
Spannbalken festgelegt), so daß also sieben Fenster erscheinen
müßten. Glatburger, der den Bau offenbar genau kannte,
wollte ursprünglich nur 6 »liechter« im Langhaus anlegen
(Sehr. Qu. 64), weil der Ostteil kleinere Achsenabstände hat
als der Westteil. Er hat aber bei der Ausführung 7 Fenster wie
vorher eingebrochen. Da zwischen ihnen, wie sich 1921 beim
Neuverputz zeigte, im Ostteil unberührtes Mauerwerk steht,
so ist das ein Beweis dafür, daß dieser Teil 4 Fenster besessen
hat. Der romanische Bauzustand des Hochschiffs (10. und
12. Jahrhundert) muß also mit 4 + 3 = 7 Fenster rekonstru-
iert werden. Die zugehörige Darstellung des Fuggerbildes ist
dadurch als nicht der Wirklichkeit entsprechend erkannt.
Damit ist diese Bildquelle auf ihren tatsächlichen Wert zu-
rückgeführt, der aber trotzdem noch hoch genug anzuschlagen
ist, vor allem zur Umgebung des Münsters. Für die Zwecke
dieser Arbeit sind folgende Einzelheiten wichtig:
a. Die Kirchenfenster am Lang- und Querhaus sind trotz der
Verschiedenheit der Entstehungszeit (9.—12. Jahrhundert)
gleichmäßig als stehende, mit Rundbogen abgeschlossene Fen-
ster ausgebildet. Das ist für die Rekonstruktionen wichtig.
b. Das Ostquerhaus hat — unmittelbar nach dem Abbruch
des alten Klosters — seine beiden Obergadenfenster behalten;
darunter ist die Wandfläche undurchbrochen. An der West-
wand im Winkel gegen die Seitenschiffswand liegt eine Tür.
Die weitere Tür in der letzteren Wand wurde 1921 nicht ge-
funden,- es liegt eine Verwechslung mit der noch erhaltenen
Tür beim Westquerhaus vor.
c. Die Ostvierung hatte einen achteckigen hölzernen Turm.
3. Der Gemarkungsplan von 170242 mit seinen Randbildern
(GLA, Reichenau Gemark.-Pl. 1) (Abb. 3, 4).
42 O. Grubers Zeitangabe 1707 ist falsch, wie schon aus dem zuge-
hörigen Wappen des Bischofs Marquard Rudolf v. Rodt (1698 bis
1704) hervorgeht.
22
Markuskirche (37, 57).
11. Münsterbau des Abts Diethelm von Krenkingen, begon-
nen 1172 (40). Diethelm ist Anhänger der Zisterzienser-Re-
form.
12. 1235 zwei Klosterbrände (41).
13. Dem Chorneubau des Abts Friedr. v. Wartenberg (1427 bis
1453) muß die Kapelle des Hl. Kreuzes weichen (53).
14. Erneuerung der westlichen Arkaden wände des Mittel-
schiffs und der südlichen Seitenschiffswand durch den Mau-
rermeister Glatburger und Einziehen einer Stützkonstruktion
für den alten Dachstuhl im Mittelschiff (63—67) 1688.
15. Erneuerung der Nordwand des Ostquerhauses vor 1702
(69).
Aus dieser Übersicht heben sich unverkennbar die großen
Bauzustände der Frühzeit heraus:
a. Die Kirche des achten Jahrhunderts;
b. Der Münsterneubau des Abts Heito von 816;
c. Der Erweiterungsbau des Abts Erlebald (823—838), eine
Laienkirche;
d. Der Zustand des Münsters in der zweiten Hälfte des neun-
ten Jahrhunderts mit der Wallfahrtskirche des hl. Markus;
e. Der Anbau der Heilig-Kreuz-Kapelle zwischen 925 und 946;
f. Der Münsterumbau des Abts Witigowo zur kluniazensi-
schen Einheitskirche 988—991;
g. Der Neubau der zweiten Markusbasilika durch Abt Berno
1048;
h. Der Münsterbau des Abts Diethelm v. Krenkingen 1172.
Damit sind bereits außerordentlich wertvolle Anhaltspunkte
für die Beurteilung der Baufunde gewonnen. Sie sind um so
bemerkenswerter, als sie rein aus dem Wortlaut der Quellen
abgeleitet werden konnten.
B. BILDQUELLEN
Die Beweislage ist bei den Bildquellen noch ungünstiger als
bei den Schriftquellen. Die in der folgenden Aufstellung ent-
haltenen Stücke sind, bis auf das siebente und achte, längst
bekannt; neue sind trotz eifrigem Suchen in den Archiven
nicht hinzugekommen. Der bei Schönhuth (a.a.O. XXXII. VI)
erwähnte «sogenannte Kirchengrundriß in 8° vom Jahr 1766«
ist bis jetzt nicht auffindbar.
1. Die Miniatur zum Carmen Purchardi (Abb. 1).
Ihre Architekturdarstellungen sind an sich ganz unverständ-
lich und bisher auch von der Forschung vernachlässigt wor-
den41. Durch die Bauuntersuchungen ist sie jetzt eine wichtige
Bildquelle geworden.
2. Das Tafelbild der Ankunft Pirmins auf der Insel Reichenau
mit dem Wappen des Bischofs Jakob Fugger (1604—1626) im
Münster (Abb. 2).
Der Maler ist nicht bekannt. Das Bild zeigt nach seiner Wie-
derherstellung fast alle wichtigeren Bauten der Insel mit ihren
Einzelheiten. Die Darstellung beruht offensichtlich auf Stu-
dien nach der Natur, ist aber ebenso offensichtlich in einer
auswärtigen Werkstatt gefertigt worden. Das geht aus folgen-
den Beobachtungen hervor: Die Pelagiuskirche zwischen dem
Markustor und der Pfalz hat einen aus der Mitte des Daches,
aber mit geringerer Breite als das Schiff, herauswachsenden
massiven Glockenturm mit romanischen Schallarkaden. Ab-
gesehen davon, daß ein Grundriß, welcher diesen Aufbau
rechtfertigt, unverständlich ist, weil der Turmunterbau das
Schiff unterbrochen hätte, ist diese Lösung auch praktisch bei
der kleinen einschiffigen Pelagiuskirche sinnlos. Es liegt offen-
bar ein Mißverständnis des Werkstattkünstlers vor. In der
Naturstudie zu dieser Gegend muß hinter der Pelagiuskirche
der Turm der Kirche St. Adalbert (1048) erschienen, deren
Schiff aber unsichtbar gewesen sein. Diese Erklärung ist um
so glaubhafter, als die Adalbertskirche auf dem Fuggerbild
sonst nicht dargestellt ist.
Als zweite Unstimmigkeit ist die Darstellung des Münster-
chors zu werten, die nur zwei Fenster, eines auf der Schräg-
seite, das zweite auf der geraden, zeigt. In Wirklichkeit hat
41 J. Hecht (100) hält unverständlicher Weise die immer wieder-
kehrenden Doppel türme des Hintergrunds für eine Bestätigung
seiner These, daß der Westbau Witigowos einen Mittelturm mit
begleitenden niedrigeren Flanken(treppen)türmen, also eine
dreiteilige Anlage, besessen habe.
der Chor zwei Fenster auf der geraden Seite, so daß also drei
erscheinen müßten.
Das Langhaus schließlich zeigt nur je fünf Fenster im Hoch-
und im Seitenschiff. Da das Bild den Zustand vor der Instand-
setzung durch Glatburger (1688) wiedergibt, so sind in der
Hochschiffswand westlich der Baufuge der Zustand aus der
Zeit Witigowos (Ende 10. Jahrh.) und östlich der von 1172
(Diethelm von Krenkingen) enthalten. Der Witigowoteil hat
aber drei Achsen und der Diethelmteil sogar vier (durch die
Spannbalken festgelegt), so daß also sieben Fenster erscheinen
müßten. Glatburger, der den Bau offenbar genau kannte,
wollte ursprünglich nur 6 »liechter« im Langhaus anlegen
(Sehr. Qu. 64), weil der Ostteil kleinere Achsenabstände hat
als der Westteil. Er hat aber bei der Ausführung 7 Fenster wie
vorher eingebrochen. Da zwischen ihnen, wie sich 1921 beim
Neuverputz zeigte, im Ostteil unberührtes Mauerwerk steht,
so ist das ein Beweis dafür, daß dieser Teil 4 Fenster besessen
hat. Der romanische Bauzustand des Hochschiffs (10. und
12. Jahrhundert) muß also mit 4 + 3 = 7 Fenster rekonstru-
iert werden. Die zugehörige Darstellung des Fuggerbildes ist
dadurch als nicht der Wirklichkeit entsprechend erkannt.
Damit ist diese Bildquelle auf ihren tatsächlichen Wert zu-
rückgeführt, der aber trotzdem noch hoch genug anzuschlagen
ist, vor allem zur Umgebung des Münsters. Für die Zwecke
dieser Arbeit sind folgende Einzelheiten wichtig:
a. Die Kirchenfenster am Lang- und Querhaus sind trotz der
Verschiedenheit der Entstehungszeit (9.—12. Jahrhundert)
gleichmäßig als stehende, mit Rundbogen abgeschlossene Fen-
ster ausgebildet. Das ist für die Rekonstruktionen wichtig.
b. Das Ostquerhaus hat — unmittelbar nach dem Abbruch
des alten Klosters — seine beiden Obergadenfenster behalten;
darunter ist die Wandfläche undurchbrochen. An der West-
wand im Winkel gegen die Seitenschiffswand liegt eine Tür.
Die weitere Tür in der letzteren Wand wurde 1921 nicht ge-
funden,- es liegt eine Verwechslung mit der noch erhaltenen
Tür beim Westquerhaus vor.
c. Die Ostvierung hatte einen achteckigen hölzernen Turm.
3. Der Gemarkungsplan von 170242 mit seinen Randbildern
(GLA, Reichenau Gemark.-Pl. 1) (Abb. 3, 4).
42 O. Grubers Zeitangabe 1707 ist falsch, wie schon aus dem zuge-
hörigen Wappen des Bischofs Marquard Rudolf v. Rodt (1698 bis
1704) hervorgeht.
22