Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
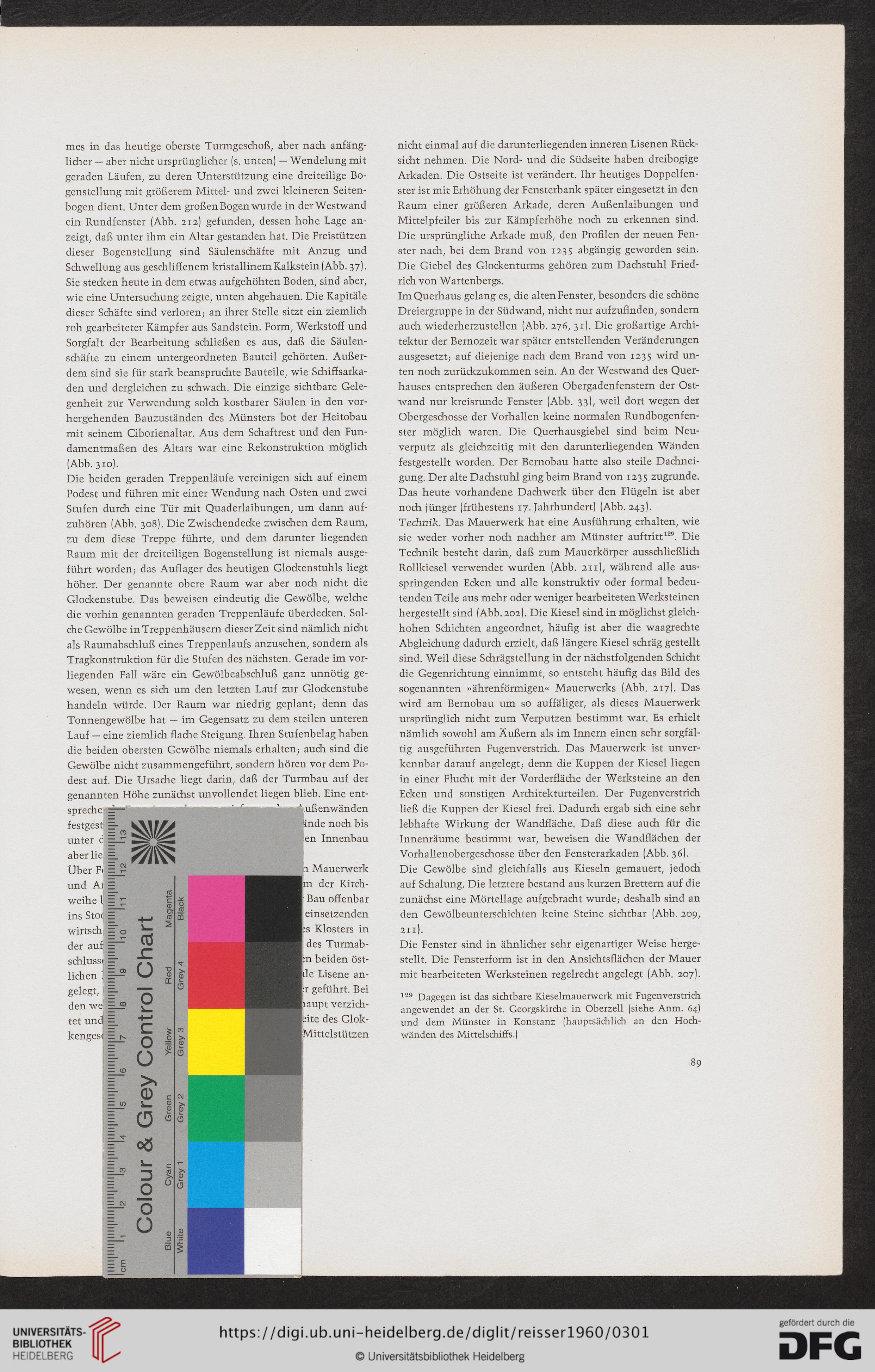
mes in das heutige oberste Turmgeschoß, aber nach anfäng-
licher — aber nicht ursprünglicher (s. unten) — Wendelung mit
geraden Läufen, zu deren Unterstützung eine dreiteilige Bo-
genstellung mit größerem Mittel- und zwei kleineren Seiten-
bogen dient. Unter dem großen Bogen wurde in der Westwand
ein Rundfenster (Abb. 212) gefunden, dessen hohe Lage an-
zeigt, daß unter ihm ein Altar gestanden hat. Die Freistützen
dieser Bogenstellung sind Säulenschäfte mit Anzug und
Schwellung aus geschliffenem kristallinem Kalkstein (Abb. 37).
Sie stecken heute in dem etwas aufgehöhten Boden, sind aber,
wie eine Untersuchung zeigte, unten abgehauen. Die Kapitale
dieser Schäfte sind verloren; an ihrer Stelle sitzt ein ziemlich
roh gearbeiteter Kämpfer aus Sandstein. Form, Werkstoff und
Sorgfalt der Bearbeitung schließen es aus, daß die Säulen-
schäfte zu einem untergeordneten Bauteil gehörten. Außer-
dem sind sie für stark beanspruchte Bauteile, wie Schiffsarka-
den und dergleichen zu schwach. Die einzige sichtbare Gele-
genheit zur Verwendung solch kostbarer Säulen in den vor-
hergehenden Bauzuständen des Münsters bot der Heitobau
mit seinem Ciborienaltar. Aus dem Schaftrest und den Fun-
damentmaßen des Altars war eine Rekonstruktion möglich
(Abb. 310).
Die beiden geraden Treppenläufe vereinigen sich auf einem
Podest und führen mit einer Wendung nach Osten und zwei
Stufen durch eine Tür mit Quaderlaibungen, um dann auf-
zuhören (Abb. 308). Die Zwischendecke zwischen dem Raum,
zu dem diese Treppe führte, und dem darunter liegenden
Raum mit der dreiteiligen Bogenstellung ist niemals ausge-
führt worden,- das Auflager des heutigen Glockenstuhls liegt
höher. Der genannte obere Raum war aber noch nicht die
Glockenstube. Das beweisen eindeutig die Gewölbe, welche
die vorhin genannten geraden Treppenläufe überdecken. Sol-
che Gewölbe in Treppenhäusern dieser Zeit sind nämlich nicht
als Raumabschluß eines Treppenlaufs anzusehen, sondern als
Tragkonstruktion für die Stufen des nächsten. Gerade im vor-
liegenden Fall wäre ein Gewölbeabschluß ganz unnötig ge-
wesen, wenn es sich um den letzten Lauf zur Glockenstube
handeln würde. Der Raum war niedrig geplant; denn das
Tonnengewölbe hat — im Gegensatz zu dem steilen unteren
Lauf — eine ziemlich flache Steigung. Ihren Stufenbelag haben
die beiden obersten Gewölbe niemals erhalten; auch sind die
o
o
s
o
5
.ußenwänden
finde noch bis
en Innenbau
n Mauerwerk
m der Kirch-
■ Bau offenbar
einsetzenden
es Klosters in
des Tunnab-
:n beiden öst-
de Lisene an-
:r geführt. Bei
laupt verzich-
eite des Glok-
Mittelstützen
o
<1)
0>
5
<N
<3
.9
ö
<D
0
CD
□
m
Gewölbe nicht zusammengeführt, sondern hören vor dem Po-
dest auf. Die Ursache liegt darin, daß der Turmbau auf der
genannten Höhe zunächst unvollendet liegen blieb. Eine ent-
spreche:
festgest
unter d
aber lie
Uber F<
und Ai
weihe l
ins Stoc
wirtsch
der auf
schlusst
liehen '
gelegt,
den we
tet und
kengesi
o
o
nicht einmal auf die darunterliegenden inneren Lisenen Rück-
sicht nehmen. Die Nord- und die Südseite haben dreibogige
Arkaden. Die Ostseite ist verändert. Ihr heutiges Doppelfen-
ster ist mit Erhöhung der Fensterbank später eingesetzt in den
Raum einer größeren Arkade, deren Außenlaibungen und
Mittelpfeiler bis zur Kämpferhöhe noch zu erkennen sind.
Die ursprüngliche Arkade muß, den Profilen der neuen Fen-
ster nach, bei dem Brand von 1235 abgängig geworden sein.
Die Giebel des Glockenturms gehören zum Dachstuhl Fried-
rich von Wartenbergs.
Im Querhaus gelang es, die alten Fenster, besonders die schöne
Dreiergruppe in der Südwand, nicht nur aufzufinden, sondern
auch wiederherzustellen (Abb. 276, 31). Die großartige Archi-
tektur der Bernozeit war später entstellenden Veränderungen
ausgesetzt; auf diejenige nach dem Brand von 1235 wird un-
ten noch zurückzukommen sein. An der Westwand des Quer-
hauses entsprechen den äußeren Obergadenfenstern der Ost-
wand nur kreisrunde Fenster (Abb. 33), weil dort wegen der
Obergeschosse der Vorhallen keine normalen Rundbogenfen-
ster möglich waren. Die Querhausgiebel sind beim Neu-
verputz als gleichzeitig mit den darunterliegenden Wänden
festgestellt worden. Der Bernobau hatte also steile Dachnei-
gung. Der alte Dachstuhl ging beim Brand von 1235 zugrunde.
Das heute vorhandene Dachwerk über den Flügeln ist aber
noch jünger (frühestens 17. Jahrhundert) (Abb. 243).
Technik. Das Mauerwerk hat eine Ausführung erhalten, wie
sie weder vorher noch nachher am Münster auftritt12’. Die
Technik besteht darin, daß zum Mauerkörper ausschließlich
Rollkiesel verwendet wurden (Abb. 211), während alle aus-
springenden Ecken und alle konstruktiv oder formal bedeu-
tenden Teile aus mehr oder weniger bearbeiteten Werksteinen
hergestellt sind (Abb. 202). Die Kiesel sind in möglichst gleich-
hohen Schichten angeordnet, häufig ist aber die waagrechte
Abgleichung dadurch erzielt, daß längere Kiesel schräg gestellt
sind. Weil diese Schrägstellung in der nächstfolgenden Schicht
die Gegenrichtung einnimmt, so entsteht häufig das Bild des
sogenannten »ährenförmigen« Mauerwerks (Abb. 217). Das
wird am Bernobau um so auffäliger, als dieses Mauerwerk
ursprünglich nicht zum Verputzen bestimmt war. Es erhielt
nämlich sowohl am Äußern als im Innern einen sehr sorgfäl-
tig ausgeführten Fugenverstrich. Das Mauerwerk ist unver-
kennbar darauf angelegt; denn die Kuppen der Kiesel liegen
in einer Flucht mit der Vorderfläche der Werksteine an den
Ecken und sonstigen Architekturteilen. Der Fugenverstrich
ließ die Kuppen der Kiesel frei. Dadurch ergab sich eine sehr
lebhafte Wirkung der Wandfläche. Daß diese auch für die
Innenräume bestimmt war, beweisen die Wandflächen der
Vorhallenobergeschosse über den Fensterarkaden (Abb. 36).
Die Gewölbe sind gleichfalls aus Kieseln gemauert, jedoch
auf Schalung. Die letztere bestand aus kurzen Brettern auf die
zunächst eine Mörtellage aufgebracht wurde; deshalb sind an
den Gewölbeunterschichten keine Steine sichtbar (Abb. 209,
211).
Die Fenster sind in ähnlicher sehr eigenartiger Weise herge-
stellt. Die Fensterform ist in den Ansichtsflächen der Mauer
mit bearbeiteten Werksteinen regelrecht angelegt (Abb. 207).
129 Dagegen ist das sichtbare Kieselmauerwerk mit Fugenverstrich
angewendet an der St. Georgskirche in Oberzell (siehe Anm. 64)
und dem Münster in Konstanz (hauptsächlich an den Hoch-
wänden des Mittelschiffs.)
89
licher — aber nicht ursprünglicher (s. unten) — Wendelung mit
geraden Läufen, zu deren Unterstützung eine dreiteilige Bo-
genstellung mit größerem Mittel- und zwei kleineren Seiten-
bogen dient. Unter dem großen Bogen wurde in der Westwand
ein Rundfenster (Abb. 212) gefunden, dessen hohe Lage an-
zeigt, daß unter ihm ein Altar gestanden hat. Die Freistützen
dieser Bogenstellung sind Säulenschäfte mit Anzug und
Schwellung aus geschliffenem kristallinem Kalkstein (Abb. 37).
Sie stecken heute in dem etwas aufgehöhten Boden, sind aber,
wie eine Untersuchung zeigte, unten abgehauen. Die Kapitale
dieser Schäfte sind verloren; an ihrer Stelle sitzt ein ziemlich
roh gearbeiteter Kämpfer aus Sandstein. Form, Werkstoff und
Sorgfalt der Bearbeitung schließen es aus, daß die Säulen-
schäfte zu einem untergeordneten Bauteil gehörten. Außer-
dem sind sie für stark beanspruchte Bauteile, wie Schiffsarka-
den und dergleichen zu schwach. Die einzige sichtbare Gele-
genheit zur Verwendung solch kostbarer Säulen in den vor-
hergehenden Bauzuständen des Münsters bot der Heitobau
mit seinem Ciborienaltar. Aus dem Schaftrest und den Fun-
damentmaßen des Altars war eine Rekonstruktion möglich
(Abb. 310).
Die beiden geraden Treppenläufe vereinigen sich auf einem
Podest und führen mit einer Wendung nach Osten und zwei
Stufen durch eine Tür mit Quaderlaibungen, um dann auf-
zuhören (Abb. 308). Die Zwischendecke zwischen dem Raum,
zu dem diese Treppe führte, und dem darunter liegenden
Raum mit der dreiteiligen Bogenstellung ist niemals ausge-
führt worden,- das Auflager des heutigen Glockenstuhls liegt
höher. Der genannte obere Raum war aber noch nicht die
Glockenstube. Das beweisen eindeutig die Gewölbe, welche
die vorhin genannten geraden Treppenläufe überdecken. Sol-
che Gewölbe in Treppenhäusern dieser Zeit sind nämlich nicht
als Raumabschluß eines Treppenlaufs anzusehen, sondern als
Tragkonstruktion für die Stufen des nächsten. Gerade im vor-
liegenden Fall wäre ein Gewölbeabschluß ganz unnötig ge-
wesen, wenn es sich um den letzten Lauf zur Glockenstube
handeln würde. Der Raum war niedrig geplant; denn das
Tonnengewölbe hat — im Gegensatz zu dem steilen unteren
Lauf — eine ziemlich flache Steigung. Ihren Stufenbelag haben
die beiden obersten Gewölbe niemals erhalten; auch sind die
o
o
s
o
5
.ußenwänden
finde noch bis
en Innenbau
n Mauerwerk
m der Kirch-
■ Bau offenbar
einsetzenden
es Klosters in
des Tunnab-
:n beiden öst-
de Lisene an-
:r geführt. Bei
laupt verzich-
eite des Glok-
Mittelstützen
o
<1)
0>
5
<N
<3
.9
ö
<D
0
CD
□
m
Gewölbe nicht zusammengeführt, sondern hören vor dem Po-
dest auf. Die Ursache liegt darin, daß der Turmbau auf der
genannten Höhe zunächst unvollendet liegen blieb. Eine ent-
spreche:
festgest
unter d
aber lie
Uber F<
und Ai
weihe l
ins Stoc
wirtsch
der auf
schlusst
liehen '
gelegt,
den we
tet und
kengesi
o
o
nicht einmal auf die darunterliegenden inneren Lisenen Rück-
sicht nehmen. Die Nord- und die Südseite haben dreibogige
Arkaden. Die Ostseite ist verändert. Ihr heutiges Doppelfen-
ster ist mit Erhöhung der Fensterbank später eingesetzt in den
Raum einer größeren Arkade, deren Außenlaibungen und
Mittelpfeiler bis zur Kämpferhöhe noch zu erkennen sind.
Die ursprüngliche Arkade muß, den Profilen der neuen Fen-
ster nach, bei dem Brand von 1235 abgängig geworden sein.
Die Giebel des Glockenturms gehören zum Dachstuhl Fried-
rich von Wartenbergs.
Im Querhaus gelang es, die alten Fenster, besonders die schöne
Dreiergruppe in der Südwand, nicht nur aufzufinden, sondern
auch wiederherzustellen (Abb. 276, 31). Die großartige Archi-
tektur der Bernozeit war später entstellenden Veränderungen
ausgesetzt; auf diejenige nach dem Brand von 1235 wird un-
ten noch zurückzukommen sein. An der Westwand des Quer-
hauses entsprechen den äußeren Obergadenfenstern der Ost-
wand nur kreisrunde Fenster (Abb. 33), weil dort wegen der
Obergeschosse der Vorhallen keine normalen Rundbogenfen-
ster möglich waren. Die Querhausgiebel sind beim Neu-
verputz als gleichzeitig mit den darunterliegenden Wänden
festgestellt worden. Der Bernobau hatte also steile Dachnei-
gung. Der alte Dachstuhl ging beim Brand von 1235 zugrunde.
Das heute vorhandene Dachwerk über den Flügeln ist aber
noch jünger (frühestens 17. Jahrhundert) (Abb. 243).
Technik. Das Mauerwerk hat eine Ausführung erhalten, wie
sie weder vorher noch nachher am Münster auftritt12’. Die
Technik besteht darin, daß zum Mauerkörper ausschließlich
Rollkiesel verwendet wurden (Abb. 211), während alle aus-
springenden Ecken und alle konstruktiv oder formal bedeu-
tenden Teile aus mehr oder weniger bearbeiteten Werksteinen
hergestellt sind (Abb. 202). Die Kiesel sind in möglichst gleich-
hohen Schichten angeordnet, häufig ist aber die waagrechte
Abgleichung dadurch erzielt, daß längere Kiesel schräg gestellt
sind. Weil diese Schrägstellung in der nächstfolgenden Schicht
die Gegenrichtung einnimmt, so entsteht häufig das Bild des
sogenannten »ährenförmigen« Mauerwerks (Abb. 217). Das
wird am Bernobau um so auffäliger, als dieses Mauerwerk
ursprünglich nicht zum Verputzen bestimmt war. Es erhielt
nämlich sowohl am Äußern als im Innern einen sehr sorgfäl-
tig ausgeführten Fugenverstrich. Das Mauerwerk ist unver-
kennbar darauf angelegt; denn die Kuppen der Kiesel liegen
in einer Flucht mit der Vorderfläche der Werksteine an den
Ecken und sonstigen Architekturteilen. Der Fugenverstrich
ließ die Kuppen der Kiesel frei. Dadurch ergab sich eine sehr
lebhafte Wirkung der Wandfläche. Daß diese auch für die
Innenräume bestimmt war, beweisen die Wandflächen der
Vorhallenobergeschosse über den Fensterarkaden (Abb. 36).
Die Gewölbe sind gleichfalls aus Kieseln gemauert, jedoch
auf Schalung. Die letztere bestand aus kurzen Brettern auf die
zunächst eine Mörtellage aufgebracht wurde; deshalb sind an
den Gewölbeunterschichten keine Steine sichtbar (Abb. 209,
211).
Die Fenster sind in ähnlicher sehr eigenartiger Weise herge-
stellt. Die Fensterform ist in den Ansichtsflächen der Mauer
mit bearbeiteten Werksteinen regelrecht angelegt (Abb. 207).
129 Dagegen ist das sichtbare Kieselmauerwerk mit Fugenverstrich
angewendet an der St. Georgskirche in Oberzell (siehe Anm. 64)
und dem Münster in Konstanz (hauptsächlich an den Hoch-
wänden des Mittelschiffs.)
89




