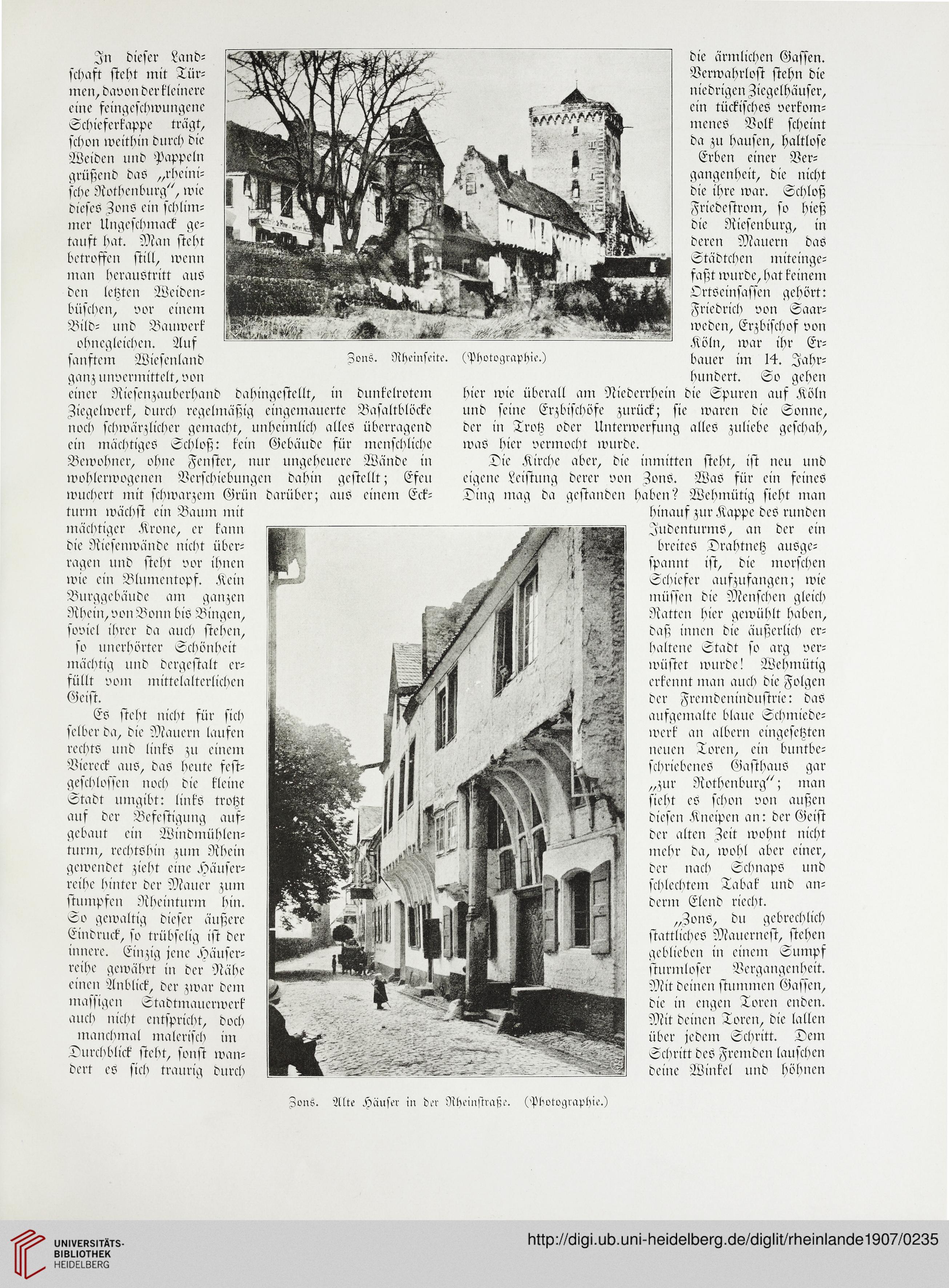Jn dieser Land-
schaft stebt mit Tür-
men, davon der kleinere
eine fei'ngeschwungene
Schieferkappe trägft
schon weitbin durch die
Weiden und Pappeln
grüßend daö „rheini-
sche RotbenburPft wie
dieseö stons ein schlim-
mer klngeschmack ge-
tauft hat. Man stebt
bctroffen still, wenn
man heraustritt aus
den letzten Weiden-
büschen, vor cinem
Bild- und Bauwerk
ohnegleichen. Aus
sanstem Wiesenland
ganz unvermittelt, von
einer Riesenzauberhand dahingestellt, in dunkelrotcm
Aiegelwerk, durch regelmäßig eingemauerte Basaltblöcke
noch schwärzlicher gemacht, unheimlich alleö überragend
ein mächtiges Schloß: kein Gebäude sür menschlichc
Bewohner, olme Fenster, nur ungeheuere Wände in
wohlerwogenen Verschiebungen dabin gestellt; Eseu
wuchert mit schwarzem Grün darüber; aus einem Eck-
turm wäcbst ein Baum mit
mächtiger Krone, er kann
die Riesenwände nicht über-
ragen und stebt vor ibnen
wie ein Blumentops. Kein
Burggebäude am ganzen
Rhein, von Bonn bis Bingen,
soviel ibrer da auch stehen,
so unerhörter Schönheit
mächtig und dergestalt er-
süllt vom mittelalterlichen
Geist.
Es steht nicht sür sich
selber da, die Mauern lausen
rechts und links zu einem
Viereck aus, das heute sest-
geschlossen noch die klcine
Stadt umgibt: links trotzt
aus der Besestigung aus-
gebaut ein Windmühlen-
turm, rechtshin zum Rhein
gewendet zieht eine Häuser-
rei'he hinter der Mauer zum
stumpsen Rheinturm hin.
So gewaltig dieser äußere
Eindruck, so trübselig ist der
innere. Einzig jene Häuser-
reihe gewabrt in der Näbe
einen Anblick, der zwar dem
masjigen Stadtmauerwerk
auch nicht entspricht, doch
manchmal malerisch im
Durchblick steht, sonst wan-
derr es sich traurig durch
die ärmlichen Gaffen.
Verwahrlost stehn die
niedrigen Ziegelhäuser,
ein tückisches verkom-
meneö Volk scheint
da zu hausen, haltlose
Erben einer Ver-
gangenheit, die nicht
die ihre war. Schloß
Friedestrom, so hieß
die Riesenburg, in
deren Mauern daö
Städtchen miteinge-
saßt wurde,hat keinem
Ortöeinsassen gehört:
Friedrich von Saar-
weden, Erzbischos von
Köln, war ihr Er-
bauer im 14. Jahr-
hundert. So gehen
hier ivie überall am Niederrhein die Spuren aus Köln
und seine Erzbischöse zurück; sie waren die Sonne,
dcr in Trotz oder Unterwersung alles zuliebe geschah,
was hier vermocht wurde.
Die Kirche aber, die inmitten steht, ist ncu und
eigene Lcistung derer von Zonö. Was sür ein seines
Ding mag da gestanden haben? Wehmütig sieht man
hinaus zur Kappe des runden
JudenturmS, an der ein
breites Drabtnetz ausge-
spannt ist, die morschen
Schiefer auszusangen; wie
müssen die Menschen gleich
Ratten hier gewühlt haben,
daß innen die äußerlich er-
haltene Stadr so arg ver-
wüstet wurde! Wehmütig
crkennt man auch die Folgen
der Fremdenindustrie: das
ausgemalte blaue Schmiede-
werk an albern eingesetzten
neucn Toren, ein buntbe-
schriebeneö GasthauS gar
„zur Rothenburg"; man
sieht es schon von außen
diesen Kneipen an: der Geist
der alten Zeit wohnt nicht
mehr da, wohl aber einer,
der nach Schnaps und
schlechtem Tabak und an-
derm Elend riecht.
„Zons, du gebrechlich
stattlicheö Mauernest, stehen
geblieben in einem Sumps
sturmloser Vergangenheit.
Mit deinen stummcn Gassen,
die in engen Toren enden.
Mit deinen Toren, die lallen
über jedcm Scbritt. Dem
Schritt deö Fremden lauschen
deine Winkel und höbnen
bonS. Rheinseite. (Photographie.)
Zons. Alte Hauser in der Nheinstraße. (Photographie.)
schaft stebt mit Tür-
men, davon der kleinere
eine fei'ngeschwungene
Schieferkappe trägft
schon weitbin durch die
Weiden und Pappeln
grüßend daö „rheini-
sche RotbenburPft wie
dieseö stons ein schlim-
mer klngeschmack ge-
tauft hat. Man stebt
bctroffen still, wenn
man heraustritt aus
den letzten Weiden-
büschen, vor cinem
Bild- und Bauwerk
ohnegleichen. Aus
sanstem Wiesenland
ganz unvermittelt, von
einer Riesenzauberhand dahingestellt, in dunkelrotcm
Aiegelwerk, durch regelmäßig eingemauerte Basaltblöcke
noch schwärzlicher gemacht, unheimlich alleö überragend
ein mächtiges Schloß: kein Gebäude sür menschlichc
Bewohner, olme Fenster, nur ungeheuere Wände in
wohlerwogenen Verschiebungen dabin gestellt; Eseu
wuchert mit schwarzem Grün darüber; aus einem Eck-
turm wäcbst ein Baum mit
mächtiger Krone, er kann
die Riesenwände nicht über-
ragen und stebt vor ibnen
wie ein Blumentops. Kein
Burggebäude am ganzen
Rhein, von Bonn bis Bingen,
soviel ibrer da auch stehen,
so unerhörter Schönheit
mächtig und dergestalt er-
süllt vom mittelalterlichen
Geist.
Es steht nicht sür sich
selber da, die Mauern lausen
rechts und links zu einem
Viereck aus, das heute sest-
geschlossen noch die klcine
Stadt umgibt: links trotzt
aus der Besestigung aus-
gebaut ein Windmühlen-
turm, rechtshin zum Rhein
gewendet zieht eine Häuser-
rei'he hinter der Mauer zum
stumpsen Rheinturm hin.
So gewaltig dieser äußere
Eindruck, so trübselig ist der
innere. Einzig jene Häuser-
reihe gewabrt in der Näbe
einen Anblick, der zwar dem
masjigen Stadtmauerwerk
auch nicht entspricht, doch
manchmal malerisch im
Durchblick steht, sonst wan-
derr es sich traurig durch
die ärmlichen Gaffen.
Verwahrlost stehn die
niedrigen Ziegelhäuser,
ein tückisches verkom-
meneö Volk scheint
da zu hausen, haltlose
Erben einer Ver-
gangenheit, die nicht
die ihre war. Schloß
Friedestrom, so hieß
die Riesenburg, in
deren Mauern daö
Städtchen miteinge-
saßt wurde,hat keinem
Ortöeinsassen gehört:
Friedrich von Saar-
weden, Erzbischos von
Köln, war ihr Er-
bauer im 14. Jahr-
hundert. So gehen
hier ivie überall am Niederrhein die Spuren aus Köln
und seine Erzbischöse zurück; sie waren die Sonne,
dcr in Trotz oder Unterwersung alles zuliebe geschah,
was hier vermocht wurde.
Die Kirche aber, die inmitten steht, ist ncu und
eigene Lcistung derer von Zonö. Was sür ein seines
Ding mag da gestanden haben? Wehmütig sieht man
hinaus zur Kappe des runden
JudenturmS, an der ein
breites Drabtnetz ausge-
spannt ist, die morschen
Schiefer auszusangen; wie
müssen die Menschen gleich
Ratten hier gewühlt haben,
daß innen die äußerlich er-
haltene Stadr so arg ver-
wüstet wurde! Wehmütig
crkennt man auch die Folgen
der Fremdenindustrie: das
ausgemalte blaue Schmiede-
werk an albern eingesetzten
neucn Toren, ein buntbe-
schriebeneö GasthauS gar
„zur Rothenburg"; man
sieht es schon von außen
diesen Kneipen an: der Geist
der alten Zeit wohnt nicht
mehr da, wohl aber einer,
der nach Schnaps und
schlechtem Tabak und an-
derm Elend riecht.
„Zons, du gebrechlich
stattlicheö Mauernest, stehen
geblieben in einem Sumps
sturmloser Vergangenheit.
Mit deinen stummcn Gassen,
die in engen Toren enden.
Mit deinen Toren, die lallen
über jedcm Scbritt. Dem
Schritt deö Fremden lauschen
deine Winkel und höbnen
bonS. Rheinseite. (Photographie.)
Zons. Alte Hauser in der Nheinstraße. (Photographie.)