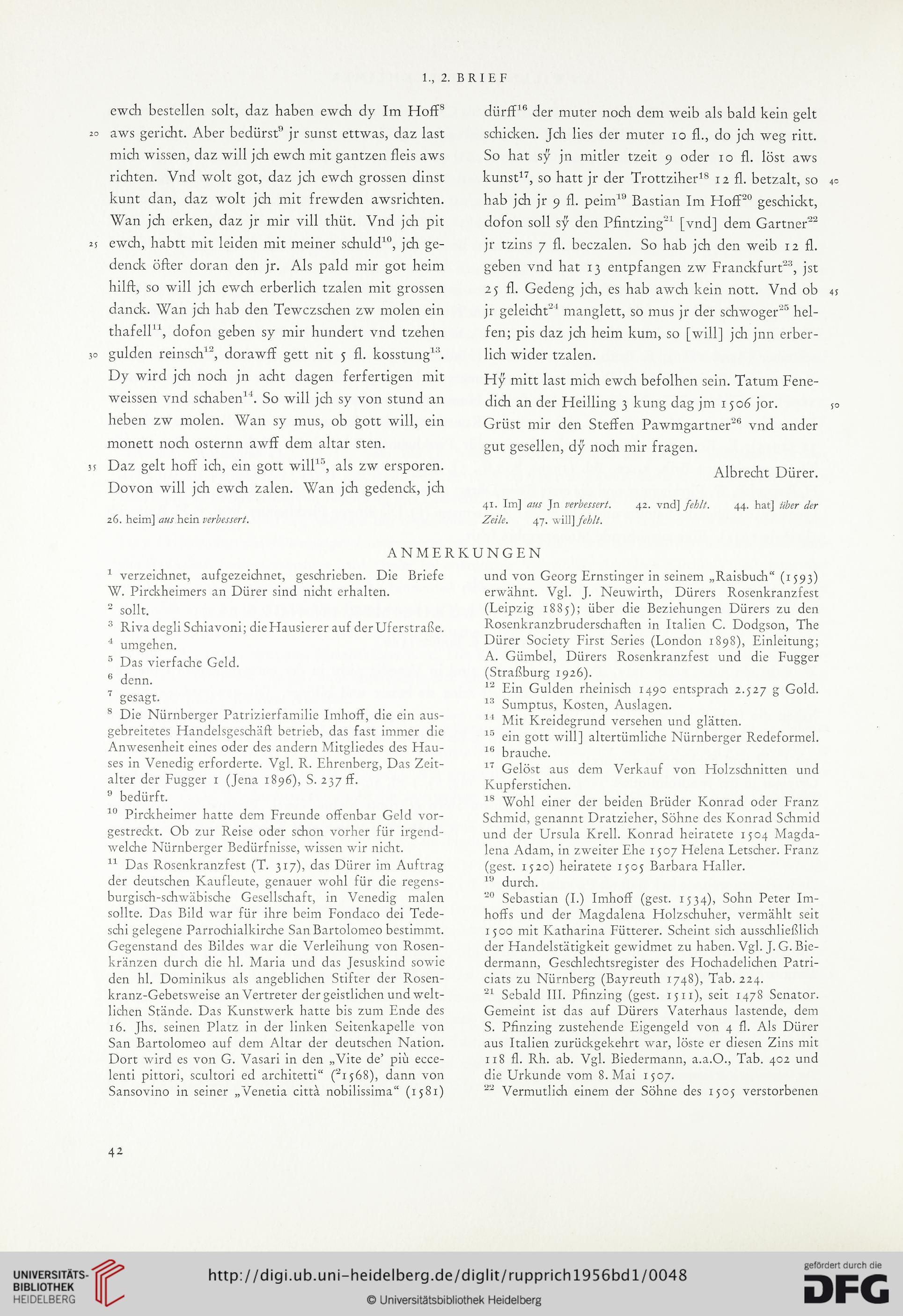1., 2. BRIEF
ewch bestellen solt, daz haben ewch dy Im Hoff8
20 aws gericht. Aber bedürst9 jr sunst ettwas, daz last
mich wissen, daz will jch ewch mit gantzen fleis aws
richten. Vnd wolt got, daz jch ewch grossen dinst
kunt dan, daz wolt jch mit frewden awsrichten.
Wan jch erken, daz jr mir will thüt. Vnd jch pit
2s ewch, habtt mit leiden mit meiner schuld10, jch ge-
denck öfter doran den jr. Als pald mir got heim
hilft, so will jch ewch erberlich tzalen mit grossen
danck. Wan jch hab den Tewczschen zw molen ein
thafell11, dofon geben sy mir hundert vnd tzehen
30 gülden reinsch12, dorawff gett nit 5 fl. kosstung13.
Dy wird jch noch jn acht dagen ferfertigen mit
weissen vnd schaben14. So will jch sy von stund an
heben zw molen. Wan sy mus, ob gott will, ein
monett noch osternn awff dem altar sten.
35 Daz gelt hoff ich, ein gott willlj, als zw ersporen.
Do von will jch ewch zalen. Wan jch gedenck, jch
26. heim] aus hein verbessert.
ANMER
1 verzeichnet, aufgezeichnet, geschrieben. Die Briefe
W. Pirckheimers an Dürer sind nicht erhalten.
2 sollt.
3 Riva degli Schiavoni; die Hausierer auf der Uferstraße.
4 umgehen.
0 Das vierfache Geld.
6 denn.
7 gesagt.
8 Die Nürnberger Patrizierfamilie Imhoff, die ein aus-
gebreitetes Handelsgeschäft betrieb, das fast immer die
Anwesenheit eines oder des andern Mitgliedes des Hau-
ses in Venedig erforderte. Vgl. R. Ehrenberg, Das Zeit-
alter der Fugger 1 (Jena 1896), S. 237 ff.
9 bedürft.
10 Pirckheimer hatte dem Freunde offenbar Geld vor-
gestreckt. Ob zur Reise oder schon vorher für irgend-
welche Nürnberger Bedürfnisse, wissen wir nicht.
11 Das Rosenkranzfest (T. 317), das Dürer im Auftrag
der deutschen Kaufleute, genauer wohl für die regens-
burgisch-schwäbische Gesellschaft, in Venedig malen
sollte. Das Bild war für ihre beim Fondaco dei Tede-
schi gelegene Parrochialkirche SanBartolomeo bestimmt.
Gegenstand des Bildes war die Verleihung von Rosen-
kränzen durch die hl. Maria und das Jesuskind sowie
den hl. Dominikus als angeblichen Stifter der Rosen-
kranz-Gebetsweise an Vertreter der geistlichen und welt-
lichen Stände. Das Kunstwerk hatte bis zum Ende des
16. Jhs. seinen Platz in der linken Seitenkapelle von
San Bartolomeo auf dem Altar der deutschen Nation.
Dort wird es von G. Vasari in den „Vite de’ piü ecce-
lenti pittori, scultori ed architetti“ (21568), dann von
Sansovino in seiner „Venetia cittä nobilissima“ (1581)
dürff16 der muter noch dem weib als bald kein gelt
schicken. Jch lies der muter 10 fl., do jch weg ritt.
So hat sy jn mitler tzeit 9 oder 10 fl. löst aws
kunst17, so hatt jr der Trottziher18 12 fl. betzalt, so 4c
hab jch jr 9 fl. peim19 Bastian Im Hoff20 geschickt,
dofon soll sy den Pfintzing21 [vnd] dem Gärtner22
jr tzins 7 fl. beczalen. So hab jch den weib 12 fl.
geben vnd hat 13 empfangen zw Franckfurt23, jst
25 fl. Gedeng jch, es hab awch kein nott. Vnd ob 45
jr geleicht2' manglett, so mus jr der schwoger25 hel-
fen; pis daz jch heim kum, so [will] jch jnn erber-
lich wider tzalen.
Hy mitt last mich ewch befolhen sein. Tatum Fene-
dich an der Heilling 3 kung dag jm 1506 jor. 5°
Grüst mir den Steffen Pawmgartner26 vnd ander
gut gesellen, dy noch mir fragen.
Albrecht Dürer.
41. Im] aus Jn verbessert. 42. vnd] fehlt. 44. hat] über der
Zeile. 47. will\ fehlt.
UNGEN
und von Georg Ernstinger in seinem „Raisbuch“ (1593)
erwähnt. Vgl. J. Neuwirth, Dürers Rosenkranzfest
(Leipzig 1885); über die Beziehungen Dürers zu den
Rosenkranzbruderschaften in Italien C. Dodgson, The
Dürer Society First Series (London 1898), Einleitung;
A. Gümbel, Dürers Rosenkranzfest und die Fugger
(Straßburg 1926).
12 Ein Gulden rheinisch 1490 entsprach 2.527 g Gold.
13 Sumptus, Kosten, Auslagen.
14 Mit Kreidegrund versehen und glätten.
10 ein gott will] altertümliche Nürnberger Redeformel.
16 brauche.
11 Gelöst aus dem Verkauf von Holzschnitten und
Kupferstichen.
18 Wohl einer der beiden Brüder Konrad oder Franz
Schmid, genannt Dratzieher, Söhne des Konrad Schmid
und der Ursula Krell. Konrad heiratete 1504 Magda-
lena Adam, in zweiter Ehe 1507 Helena Letscher. Franz
(gest. 1520) heiratete 1505 Barbara Haller.
19 durch.
20 Sebastian (I.) Imhoff (gest. 1534), Sohn Peter Im-
hoffs und der Magdalena Holzschuher, vermählt seit
1500 mit Katharina Fütterer. Scheint sich ausschließlich
der Handelstätigkeit gewidmet zu haben. Vgl. J. G. Bie-
dermann, Geschlechtsregister des Hochadelichen Patri-
ciats zu Nürnberg (Bayreuth 1748), Tab. 224.
21 Sebald III. Pfinzing (gest. 1511), seit 1478 Senator.
Gemeint ist das auf Dürers Vaterhaus lastende, dem
S. Pfinzing zustehende Eigengeld von 4 fl. Als Dürer
aus Italien zurückgekehrt war, löste er diesen Zins mit
118 fl. Rh. ab. Vgl. Biedermann, a.a.O., Tab. 402 und
die Urkunde vom 8. Mai 1507.
22 Vermutlich einem der Söhne des 1505 verstorbenen
42
ewch bestellen solt, daz haben ewch dy Im Hoff8
20 aws gericht. Aber bedürst9 jr sunst ettwas, daz last
mich wissen, daz will jch ewch mit gantzen fleis aws
richten. Vnd wolt got, daz jch ewch grossen dinst
kunt dan, daz wolt jch mit frewden awsrichten.
Wan jch erken, daz jr mir will thüt. Vnd jch pit
2s ewch, habtt mit leiden mit meiner schuld10, jch ge-
denck öfter doran den jr. Als pald mir got heim
hilft, so will jch ewch erberlich tzalen mit grossen
danck. Wan jch hab den Tewczschen zw molen ein
thafell11, dofon geben sy mir hundert vnd tzehen
30 gülden reinsch12, dorawff gett nit 5 fl. kosstung13.
Dy wird jch noch jn acht dagen ferfertigen mit
weissen vnd schaben14. So will jch sy von stund an
heben zw molen. Wan sy mus, ob gott will, ein
monett noch osternn awff dem altar sten.
35 Daz gelt hoff ich, ein gott willlj, als zw ersporen.
Do von will jch ewch zalen. Wan jch gedenck, jch
26. heim] aus hein verbessert.
ANMER
1 verzeichnet, aufgezeichnet, geschrieben. Die Briefe
W. Pirckheimers an Dürer sind nicht erhalten.
2 sollt.
3 Riva degli Schiavoni; die Hausierer auf der Uferstraße.
4 umgehen.
0 Das vierfache Geld.
6 denn.
7 gesagt.
8 Die Nürnberger Patrizierfamilie Imhoff, die ein aus-
gebreitetes Handelsgeschäft betrieb, das fast immer die
Anwesenheit eines oder des andern Mitgliedes des Hau-
ses in Venedig erforderte. Vgl. R. Ehrenberg, Das Zeit-
alter der Fugger 1 (Jena 1896), S. 237 ff.
9 bedürft.
10 Pirckheimer hatte dem Freunde offenbar Geld vor-
gestreckt. Ob zur Reise oder schon vorher für irgend-
welche Nürnberger Bedürfnisse, wissen wir nicht.
11 Das Rosenkranzfest (T. 317), das Dürer im Auftrag
der deutschen Kaufleute, genauer wohl für die regens-
burgisch-schwäbische Gesellschaft, in Venedig malen
sollte. Das Bild war für ihre beim Fondaco dei Tede-
schi gelegene Parrochialkirche SanBartolomeo bestimmt.
Gegenstand des Bildes war die Verleihung von Rosen-
kränzen durch die hl. Maria und das Jesuskind sowie
den hl. Dominikus als angeblichen Stifter der Rosen-
kranz-Gebetsweise an Vertreter der geistlichen und welt-
lichen Stände. Das Kunstwerk hatte bis zum Ende des
16. Jhs. seinen Platz in der linken Seitenkapelle von
San Bartolomeo auf dem Altar der deutschen Nation.
Dort wird es von G. Vasari in den „Vite de’ piü ecce-
lenti pittori, scultori ed architetti“ (21568), dann von
Sansovino in seiner „Venetia cittä nobilissima“ (1581)
dürff16 der muter noch dem weib als bald kein gelt
schicken. Jch lies der muter 10 fl., do jch weg ritt.
So hat sy jn mitler tzeit 9 oder 10 fl. löst aws
kunst17, so hatt jr der Trottziher18 12 fl. betzalt, so 4c
hab jch jr 9 fl. peim19 Bastian Im Hoff20 geschickt,
dofon soll sy den Pfintzing21 [vnd] dem Gärtner22
jr tzins 7 fl. beczalen. So hab jch den weib 12 fl.
geben vnd hat 13 empfangen zw Franckfurt23, jst
25 fl. Gedeng jch, es hab awch kein nott. Vnd ob 45
jr geleicht2' manglett, so mus jr der schwoger25 hel-
fen; pis daz jch heim kum, so [will] jch jnn erber-
lich wider tzalen.
Hy mitt last mich ewch befolhen sein. Tatum Fene-
dich an der Heilling 3 kung dag jm 1506 jor. 5°
Grüst mir den Steffen Pawmgartner26 vnd ander
gut gesellen, dy noch mir fragen.
Albrecht Dürer.
41. Im] aus Jn verbessert. 42. vnd] fehlt. 44. hat] über der
Zeile. 47. will\ fehlt.
UNGEN
und von Georg Ernstinger in seinem „Raisbuch“ (1593)
erwähnt. Vgl. J. Neuwirth, Dürers Rosenkranzfest
(Leipzig 1885); über die Beziehungen Dürers zu den
Rosenkranzbruderschaften in Italien C. Dodgson, The
Dürer Society First Series (London 1898), Einleitung;
A. Gümbel, Dürers Rosenkranzfest und die Fugger
(Straßburg 1926).
12 Ein Gulden rheinisch 1490 entsprach 2.527 g Gold.
13 Sumptus, Kosten, Auslagen.
14 Mit Kreidegrund versehen und glätten.
10 ein gott will] altertümliche Nürnberger Redeformel.
16 brauche.
11 Gelöst aus dem Verkauf von Holzschnitten und
Kupferstichen.
18 Wohl einer der beiden Brüder Konrad oder Franz
Schmid, genannt Dratzieher, Söhne des Konrad Schmid
und der Ursula Krell. Konrad heiratete 1504 Magda-
lena Adam, in zweiter Ehe 1507 Helena Letscher. Franz
(gest. 1520) heiratete 1505 Barbara Haller.
19 durch.
20 Sebastian (I.) Imhoff (gest. 1534), Sohn Peter Im-
hoffs und der Magdalena Holzschuher, vermählt seit
1500 mit Katharina Fütterer. Scheint sich ausschließlich
der Handelstätigkeit gewidmet zu haben. Vgl. J. G. Bie-
dermann, Geschlechtsregister des Hochadelichen Patri-
ciats zu Nürnberg (Bayreuth 1748), Tab. 224.
21 Sebald III. Pfinzing (gest. 1511), seit 1478 Senator.
Gemeint ist das auf Dürers Vaterhaus lastende, dem
S. Pfinzing zustehende Eigengeld von 4 fl. Als Dürer
aus Italien zurückgekehrt war, löste er diesen Zins mit
118 fl. Rh. ab. Vgl. Biedermann, a.a.O., Tab. 402 und
die Urkunde vom 8. Mai 1507.
22 Vermutlich einem der Söhne des 1505 verstorbenen
42