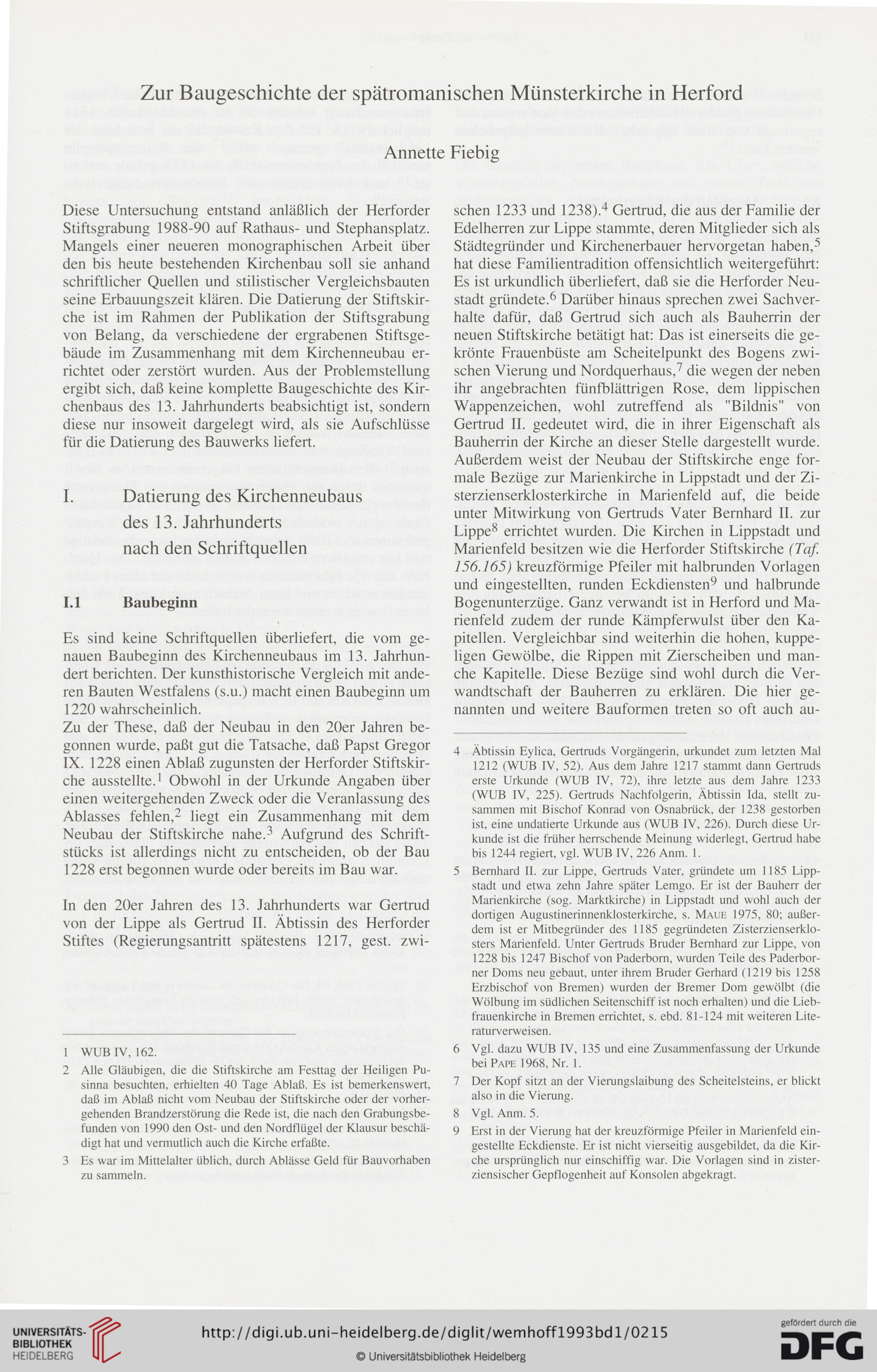Zur Baugeschichte der spätromanischen Münsterkirche in Herford
Annette Fiebig
Diese Untersuchung entstand anläßlich der Herforder
Stiftsgrabung 1988-90 auf Rathaus- und Stephansplatz.
Mangels einer neueren monographischen Arbeit über
den bis heute bestehenden Kirchenbau soll sie anhand
schriftlicher Quellen und stilistischer Vergleichsbauten
seine Erbauungszeit klären. Die Datierung der Stiftskir-
che ist im Rahmen der Publikation der Stiftsgrabung
von Belang, da verschiedene der ergrabenen Stiftsge-
bäude im Zusammenhang mit dem Kirchenneubau er-
richtet oder zerstört wurden. Aus der Problemstellung
ergibt sich, daß keine komplette Baugeschichte des Kir-
chenbaus des 13. Jahrhunderts beabsichtigt ist, sondem
diese nur insoweit dargelegt wird, als sie Aufschlüsse
für die Datierung des Bauwerks liefert.
I. Datierung des Kirchenneubaus
des 13. Jahrhunderts
nach den Schriftquellen
1.1 Baubeginn
Es sind keine Schriftquellen überliefert, die vom ge-
nauen Baubeginn des Kirchenneubaus im 13. Jahrhun-
dert berichten. Der kunsthistorische Vergleich mit ande-
ren Bauten Westfalens (s.u.) macht einen Baubeginn um
1220 wahrscheinlich.
Zu der These, daß der Neubau in den 20er Jahren be-
gonnen wurde, paßt gut die Tatsache, daß Papst Gregor
IX. 1228 einen Ablaß zugunsten der Herforder Stiftskir-
che ausstellte.1 Obwohl in der Urkunde Angaben über
einen weitergehenden Zweck oder die Veranlassung des
Ablasses fehlen,2 liegt ein Zusammenhang mit dem
Neubau der Stiftskirche nahe.3 Aufgrund des Schrift-
stücks ist allerdings nicht zu entscheiden, ob der Bau
1228 erst begonnen wurde oder bereits im Bau war.
In den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts war Gertrud
von der Lippe als Gertrud II. Äbtissin des Herforder
Stiftes (Regiemngsantritt spätestens 1217, gest. zwi-
1 WUB IV, 162.
2 Alle Gläubigen, die die Stiftskirche am Festtag der Heiligen Pu-
sinna besuchten, erhielten 40 Tage Ablaß. Es ist bemerkenswert,
daß im Ablaß nicht vom Neubau der Stiftskirche oder der vorher-
gehenden Brandzerstörung die Rede ist, die nach den Grabungsbe-
funden von 1990 den Ost- und den Nordflügel der Klausur beschä-
digt hat und vermutlich auch die Kirche erfaßte.
3 Es war im Mittelalter üblich, durch Ablässe Geld für Bauvorhaben
zu sammeln.
schen 1233 und 1238).4 Gertrud, die aus der Familie der
Edelherren zur Lippe stammte, deren Mitglieder sich als
Städtegründer und Kirchenerbauer hervorgetan haben,5
hat diese Familientradition offensichtlich weitergeführt:
Es ist urkundlich überliefert, daß sie die Herforder Neu-
stadt gründete.6 Darüber hinaus sprechen zwei Sachver-
halte dafür, daß Gertrud sich auch als Bauherrin der
neuen Stiftskirche betätigt hat: Das ist einerseits die ge-
krönte Frauenbüste am Scheitelpunkt des Bogens zwi-
schen Vierung und Nordquerhaus,7 die wegen der neben
ihr angebrachten fünfblättrigen Rose, dem lippischen
Wappenzeichen, wohl zutreffend als "Bildnis" von
Gertrud II. gedeutet wird, die in ihrer Eigenschaft als
Bauherrin der Kirche an dieser Stelle dargestellt wurde.
Außerdem weist der Neubau der Stiftskirche enge for-
male Bezüge zur Marienkirche in Lippstadt und der Zi-
sterzienserklosterkirche in Marienfeld auf, die beide
unter Mitwirkung von Gertruds Vater Bernhard II. zur
Lippe8 errichtet wurden. Die Kirchen in Lippstadt und
Marienfeld besitzen wie die Herforder Stiftskirche (Taf.
156.165) kreuzförmige Pfeiler mit halbrunden Vorlagen
und eingestellten, runden Eckdiensten9 und halbrunde
Bogenunterzüge. Ganz verwandt ist in Herford und Ma-
rienfeld zudem der runde Kämpferwulst über den Ka-
pitellen. Vergleichbar sind weiterhin die hohen, kuppe-
ligen Gewölbe, die Rippen mit Zierscheiben und man-
che Kapitelle. Diese Bezüge sind wohl durch die Ver-
wandtschaft der Bauherren zu erklären. Die hier ge-
nannten und weitere Bauformen treten so oft auch au-
4 Äbtissin Eylica, Gertruds Vorgängerin, urkundet zum letzten Mal
1212 (WUB IV, 52). Aus dem Jahre 1217 stammt dann Gertruds
erste Urkunde (WUB IV, 72), ihre letzte aus dem Jahre 1233
(WUB IV, 225). Gertruds Nachfolgerin, Äbtissin Ida, stellt zu-
sammen mit Bischof Konrad von Osnabrück, der 1238 gestorben
ist, eine undatierte Urkunde aus (WUB IV, 226). Durch diese Ur-
kunde ist die früher herrschende Meinung widerlegt, Gertrud habe
bis 1244 regiert, vgl. WUB IV, 226 Anm. 1.
5 Bernhard II. zur Lippe, Gertruds Vater, gründete um 1185 Lipp-
stadt und etwa zehn Jahre später Lemgo. Er ist der Bauherr der
Marienkirche (sog. Marktkirche) in Lippstadt und wohl auch der
dortigen Augustinerinnenklosterkirche, s. Maue 1975, 80; außer-
dem ist er Mitbegründer des 1185 gegründeten Zisterzienserklo-
sters Marienfeld. Unter Gertruds Bruder Bemhard zur Lippe, von
1228 bis 1247 Bischof von Paderborn, wurden Teile des Paderbor-
ner Doms neu gebaut, unter ihrem Bruder Gerhard (1219 bis 1258
Erzbischof von Bremen) wurden der Bremer Dom gewölbt (die
Wölbung im südlichen Seitenschiff ist noch erhalten) und die Lieb-
frauenkirche in Bremen errichtet, s. ebd. 81-124 mit weiteren Lite-
raturverweisen.
6 Vgl. dazu WUB IV, 135 und eine Zusammenfassung der Urkunde
bei Pape 1968, Nr. 1.
7 Der Kopf sitzt an der Vierungslaibung des Scheitelsteins, er blickt
also in die Viemng.
8 Vgl. Anm. 5.
9 Erst in der Viemng hat der kreuzförmige Pfeiler in Marienfeld ein-
gestellte Eckdienste. Er ist nicht vierseitig ausgebildet, da die Kir-
che ursprünglich nur einschiffig war. Die Vorlagen sind in zister-
ziensischer Gepflogenheit auf Konsolen abgekragt.
Annette Fiebig
Diese Untersuchung entstand anläßlich der Herforder
Stiftsgrabung 1988-90 auf Rathaus- und Stephansplatz.
Mangels einer neueren monographischen Arbeit über
den bis heute bestehenden Kirchenbau soll sie anhand
schriftlicher Quellen und stilistischer Vergleichsbauten
seine Erbauungszeit klären. Die Datierung der Stiftskir-
che ist im Rahmen der Publikation der Stiftsgrabung
von Belang, da verschiedene der ergrabenen Stiftsge-
bäude im Zusammenhang mit dem Kirchenneubau er-
richtet oder zerstört wurden. Aus der Problemstellung
ergibt sich, daß keine komplette Baugeschichte des Kir-
chenbaus des 13. Jahrhunderts beabsichtigt ist, sondem
diese nur insoweit dargelegt wird, als sie Aufschlüsse
für die Datierung des Bauwerks liefert.
I. Datierung des Kirchenneubaus
des 13. Jahrhunderts
nach den Schriftquellen
1.1 Baubeginn
Es sind keine Schriftquellen überliefert, die vom ge-
nauen Baubeginn des Kirchenneubaus im 13. Jahrhun-
dert berichten. Der kunsthistorische Vergleich mit ande-
ren Bauten Westfalens (s.u.) macht einen Baubeginn um
1220 wahrscheinlich.
Zu der These, daß der Neubau in den 20er Jahren be-
gonnen wurde, paßt gut die Tatsache, daß Papst Gregor
IX. 1228 einen Ablaß zugunsten der Herforder Stiftskir-
che ausstellte.1 Obwohl in der Urkunde Angaben über
einen weitergehenden Zweck oder die Veranlassung des
Ablasses fehlen,2 liegt ein Zusammenhang mit dem
Neubau der Stiftskirche nahe.3 Aufgrund des Schrift-
stücks ist allerdings nicht zu entscheiden, ob der Bau
1228 erst begonnen wurde oder bereits im Bau war.
In den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts war Gertrud
von der Lippe als Gertrud II. Äbtissin des Herforder
Stiftes (Regiemngsantritt spätestens 1217, gest. zwi-
1 WUB IV, 162.
2 Alle Gläubigen, die die Stiftskirche am Festtag der Heiligen Pu-
sinna besuchten, erhielten 40 Tage Ablaß. Es ist bemerkenswert,
daß im Ablaß nicht vom Neubau der Stiftskirche oder der vorher-
gehenden Brandzerstörung die Rede ist, die nach den Grabungsbe-
funden von 1990 den Ost- und den Nordflügel der Klausur beschä-
digt hat und vermutlich auch die Kirche erfaßte.
3 Es war im Mittelalter üblich, durch Ablässe Geld für Bauvorhaben
zu sammeln.
schen 1233 und 1238).4 Gertrud, die aus der Familie der
Edelherren zur Lippe stammte, deren Mitglieder sich als
Städtegründer und Kirchenerbauer hervorgetan haben,5
hat diese Familientradition offensichtlich weitergeführt:
Es ist urkundlich überliefert, daß sie die Herforder Neu-
stadt gründete.6 Darüber hinaus sprechen zwei Sachver-
halte dafür, daß Gertrud sich auch als Bauherrin der
neuen Stiftskirche betätigt hat: Das ist einerseits die ge-
krönte Frauenbüste am Scheitelpunkt des Bogens zwi-
schen Vierung und Nordquerhaus,7 die wegen der neben
ihr angebrachten fünfblättrigen Rose, dem lippischen
Wappenzeichen, wohl zutreffend als "Bildnis" von
Gertrud II. gedeutet wird, die in ihrer Eigenschaft als
Bauherrin der Kirche an dieser Stelle dargestellt wurde.
Außerdem weist der Neubau der Stiftskirche enge for-
male Bezüge zur Marienkirche in Lippstadt und der Zi-
sterzienserklosterkirche in Marienfeld auf, die beide
unter Mitwirkung von Gertruds Vater Bernhard II. zur
Lippe8 errichtet wurden. Die Kirchen in Lippstadt und
Marienfeld besitzen wie die Herforder Stiftskirche (Taf.
156.165) kreuzförmige Pfeiler mit halbrunden Vorlagen
und eingestellten, runden Eckdiensten9 und halbrunde
Bogenunterzüge. Ganz verwandt ist in Herford und Ma-
rienfeld zudem der runde Kämpferwulst über den Ka-
pitellen. Vergleichbar sind weiterhin die hohen, kuppe-
ligen Gewölbe, die Rippen mit Zierscheiben und man-
che Kapitelle. Diese Bezüge sind wohl durch die Ver-
wandtschaft der Bauherren zu erklären. Die hier ge-
nannten und weitere Bauformen treten so oft auch au-
4 Äbtissin Eylica, Gertruds Vorgängerin, urkundet zum letzten Mal
1212 (WUB IV, 52). Aus dem Jahre 1217 stammt dann Gertruds
erste Urkunde (WUB IV, 72), ihre letzte aus dem Jahre 1233
(WUB IV, 225). Gertruds Nachfolgerin, Äbtissin Ida, stellt zu-
sammen mit Bischof Konrad von Osnabrück, der 1238 gestorben
ist, eine undatierte Urkunde aus (WUB IV, 226). Durch diese Ur-
kunde ist die früher herrschende Meinung widerlegt, Gertrud habe
bis 1244 regiert, vgl. WUB IV, 226 Anm. 1.
5 Bernhard II. zur Lippe, Gertruds Vater, gründete um 1185 Lipp-
stadt und etwa zehn Jahre später Lemgo. Er ist der Bauherr der
Marienkirche (sog. Marktkirche) in Lippstadt und wohl auch der
dortigen Augustinerinnenklosterkirche, s. Maue 1975, 80; außer-
dem ist er Mitbegründer des 1185 gegründeten Zisterzienserklo-
sters Marienfeld. Unter Gertruds Bruder Bemhard zur Lippe, von
1228 bis 1247 Bischof von Paderborn, wurden Teile des Paderbor-
ner Doms neu gebaut, unter ihrem Bruder Gerhard (1219 bis 1258
Erzbischof von Bremen) wurden der Bremer Dom gewölbt (die
Wölbung im südlichen Seitenschiff ist noch erhalten) und die Lieb-
frauenkirche in Bremen errichtet, s. ebd. 81-124 mit weiteren Lite-
raturverweisen.
6 Vgl. dazu WUB IV, 135 und eine Zusammenfassung der Urkunde
bei Pape 1968, Nr. 1.
7 Der Kopf sitzt an der Vierungslaibung des Scheitelsteins, er blickt
also in die Viemng.
8 Vgl. Anm. 5.
9 Erst in der Viemng hat der kreuzförmige Pfeiler in Marienfeld ein-
gestellte Eckdienste. Er ist nicht vierseitig ausgebildet, da die Kir-
che ursprünglich nur einschiffig war. Die Vorlagen sind in zister-
ziensischer Gepflogenheit auf Konsolen abgekragt.