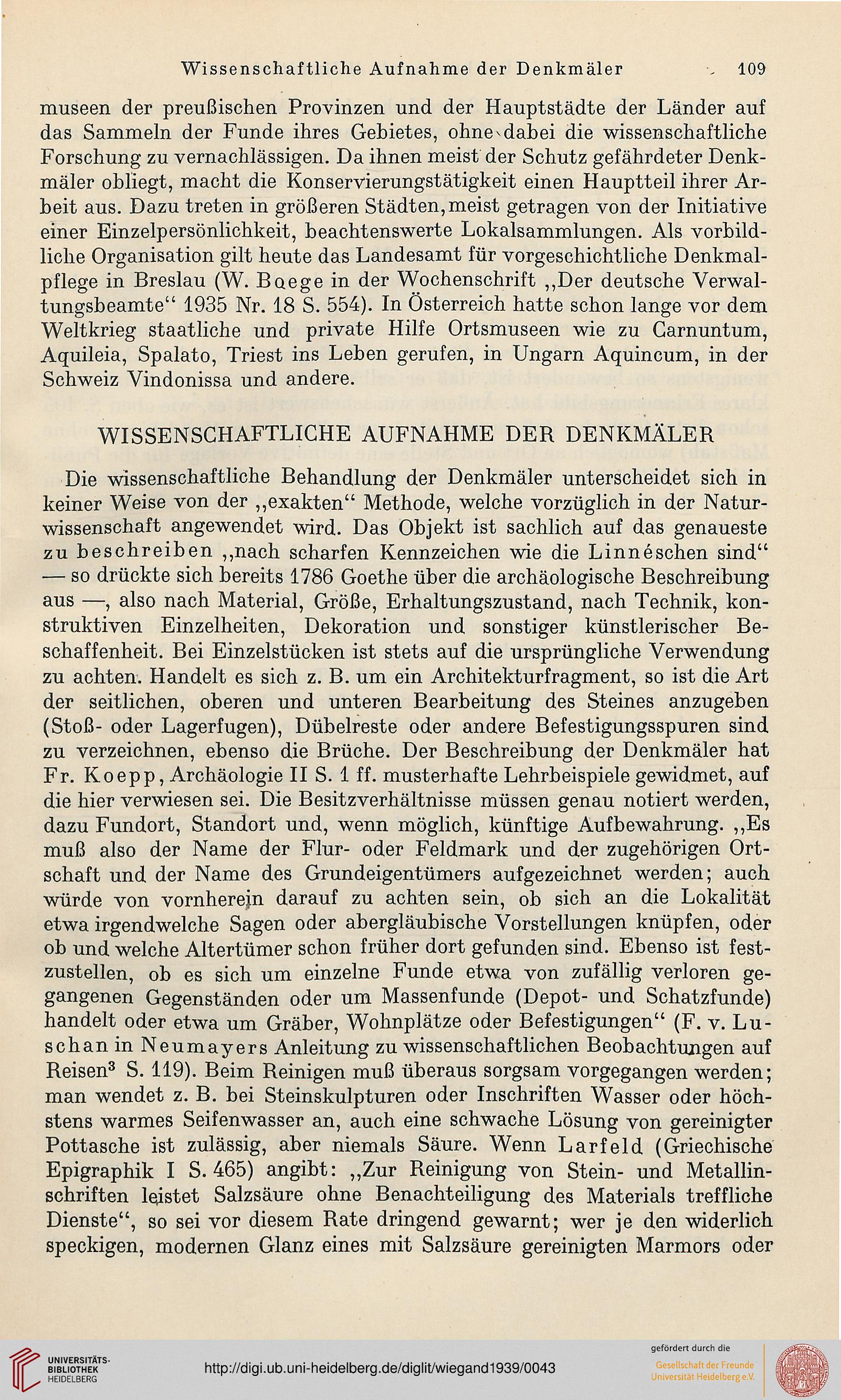Wissenschaftliche Aufnahme der Denkmäler
109
museen der preußischen Provinzen und der Hauptstädte der Länder auf
das Sammeln der Funde ihres Gebietes, ohne ^ dabei die wissenschaftliche
Forschung zu vernachlässigen. Da ihnen meist der Schutz gefährdeter Denk-
mäler obliegt, macht die Konservierungstätigkeit einen Hauptteil ihrer Ar-
beit aus. Dazu treten in größeren Städten, meist getragen von der Initiative
einer Einzelpersönlichkeit, beachtenswerte Lokalsammlungen. Als vorbild-
liche Organisation gilt heute das Landesamt für vorgeschichtliche Denkmal-
pflege in Breslau (W. Boege in der Wochenschrift „Der deutsche Verwal-
tungsbeamte" 1935 Nr. 18 S. 554). In Österreich hatte schon lange vor dem
Weltkrieg staatliche und private Hilfe Ortsmuseen wie zu Garnuntum,
Aquileia, Spalato, Triest ins Leben gerufen, in Ungarn Aquincum, in der
Schweiz Vindonissa und andere.
WISSENSCHAFTLICHE AUFNAHME DER DENKMÄLER
Die wissenschaftliche Behandlung der Denkmäler unterscheidet sich in
keiner Weise von der „exakten" Methode, welche vorzüglich in der Natur-
wissenschaft angewendet wird. Das Objekt ist sachlich auf das genaueste
zu beschreiben „nach scharfen Kennzeichen wie die Linn eschen sind"
■— so drückte sich bereits 1786 Goethe über die archäologische Beschreibung
aus —, also nach Material, Größe, Erhaltungszustand, nach Technik, kon-
struktiven Einzelheiten, Dekoration und sonstiger künstlerischer Be-
schaffenheit. Bei Einzelstücken ist stets auf die ursprüngliche Verwendung
zu achten. Handelt es sich z. B. um ein Architekturfragment, so ist die Art
der seitlichen, oberen und unteren Bearbeitung des Steines anzugeben
(Stoß- oder Lagerfugen), Dübelreste oder andere Befestigungsspuren sind
zu verzeichnen, ebenso die Brüche. Der Beschreibung der Denkmäler hat
Fr. Koepp, Archäologie II S. 1 ff. musterhafte Lehrbeispiele gewidmet, auf
die hier verwiesen sei. Die Besitzverhältnisse müssen genau notiert werden,
dazu Fundort, Standort und, wenn möglich, künftige Aufbewahrung. „Es
muß also der Name der Flur- oder Feldmark und der zugehörigen Ort-
schaft und der Name des Grundeigentümers aufgezeichnet werden; auch
würde von vornherein darauf zu achten sein, ob sich an die Lokalität
etwa irgendwelche Sagen oder abergläubische Vorstellungen knüpfen, oder
ob und welche Altertümer schon früher dort gefunden sind. Ebenso ist fest-
zustellen, ob es sich um einzelne Funde etwa von zufällig verloren ge-
gangenen Gegenständen oder um Massenfunde (Depot- und Schatzfunde)
handelt oder etwa um Gräber, Wohnplätze oder Befestigungen" (F. v. Lu-
schan in Neumayers Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf
Reisen3 S. 119). Beim Reinigen muß überaus sorgsam vorgegangen werden;
man wendet z. B. bei Steinskulpturen oder Inschriften Wasser oder höch-
stens warmes Seifenwasser an, auch eine schwache Lösung von gereinigter
Pottasche ist zulässig, aber niemals Säure. Wenn Larfeld (Griechische
Epigraphik I S. 465) angibt: „Zur Reinigung von Stein- und Metallin-
schriften leistet Salzsäure ohne Benachteiligung des Materials treffliche
Dienste", so sei vor diesem Rate dringend gewarnt; wer je den widerlich
speckigen, modernen Glanz eines mit Salzsäure gereinigten Marmors oder
109
museen der preußischen Provinzen und der Hauptstädte der Länder auf
das Sammeln der Funde ihres Gebietes, ohne ^ dabei die wissenschaftliche
Forschung zu vernachlässigen. Da ihnen meist der Schutz gefährdeter Denk-
mäler obliegt, macht die Konservierungstätigkeit einen Hauptteil ihrer Ar-
beit aus. Dazu treten in größeren Städten, meist getragen von der Initiative
einer Einzelpersönlichkeit, beachtenswerte Lokalsammlungen. Als vorbild-
liche Organisation gilt heute das Landesamt für vorgeschichtliche Denkmal-
pflege in Breslau (W. Boege in der Wochenschrift „Der deutsche Verwal-
tungsbeamte" 1935 Nr. 18 S. 554). In Österreich hatte schon lange vor dem
Weltkrieg staatliche und private Hilfe Ortsmuseen wie zu Garnuntum,
Aquileia, Spalato, Triest ins Leben gerufen, in Ungarn Aquincum, in der
Schweiz Vindonissa und andere.
WISSENSCHAFTLICHE AUFNAHME DER DENKMÄLER
Die wissenschaftliche Behandlung der Denkmäler unterscheidet sich in
keiner Weise von der „exakten" Methode, welche vorzüglich in der Natur-
wissenschaft angewendet wird. Das Objekt ist sachlich auf das genaueste
zu beschreiben „nach scharfen Kennzeichen wie die Linn eschen sind"
■— so drückte sich bereits 1786 Goethe über die archäologische Beschreibung
aus —, also nach Material, Größe, Erhaltungszustand, nach Technik, kon-
struktiven Einzelheiten, Dekoration und sonstiger künstlerischer Be-
schaffenheit. Bei Einzelstücken ist stets auf die ursprüngliche Verwendung
zu achten. Handelt es sich z. B. um ein Architekturfragment, so ist die Art
der seitlichen, oberen und unteren Bearbeitung des Steines anzugeben
(Stoß- oder Lagerfugen), Dübelreste oder andere Befestigungsspuren sind
zu verzeichnen, ebenso die Brüche. Der Beschreibung der Denkmäler hat
Fr. Koepp, Archäologie II S. 1 ff. musterhafte Lehrbeispiele gewidmet, auf
die hier verwiesen sei. Die Besitzverhältnisse müssen genau notiert werden,
dazu Fundort, Standort und, wenn möglich, künftige Aufbewahrung. „Es
muß also der Name der Flur- oder Feldmark und der zugehörigen Ort-
schaft und der Name des Grundeigentümers aufgezeichnet werden; auch
würde von vornherein darauf zu achten sein, ob sich an die Lokalität
etwa irgendwelche Sagen oder abergläubische Vorstellungen knüpfen, oder
ob und welche Altertümer schon früher dort gefunden sind. Ebenso ist fest-
zustellen, ob es sich um einzelne Funde etwa von zufällig verloren ge-
gangenen Gegenständen oder um Massenfunde (Depot- und Schatzfunde)
handelt oder etwa um Gräber, Wohnplätze oder Befestigungen" (F. v. Lu-
schan in Neumayers Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf
Reisen3 S. 119). Beim Reinigen muß überaus sorgsam vorgegangen werden;
man wendet z. B. bei Steinskulpturen oder Inschriften Wasser oder höch-
stens warmes Seifenwasser an, auch eine schwache Lösung von gereinigter
Pottasche ist zulässig, aber niemals Säure. Wenn Larfeld (Griechische
Epigraphik I S. 465) angibt: „Zur Reinigung von Stein- und Metallin-
schriften leistet Salzsäure ohne Benachteiligung des Materials treffliche
Dienste", so sei vor diesem Rate dringend gewarnt; wer je den widerlich
speckigen, modernen Glanz eines mit Salzsäure gereinigten Marmors oder