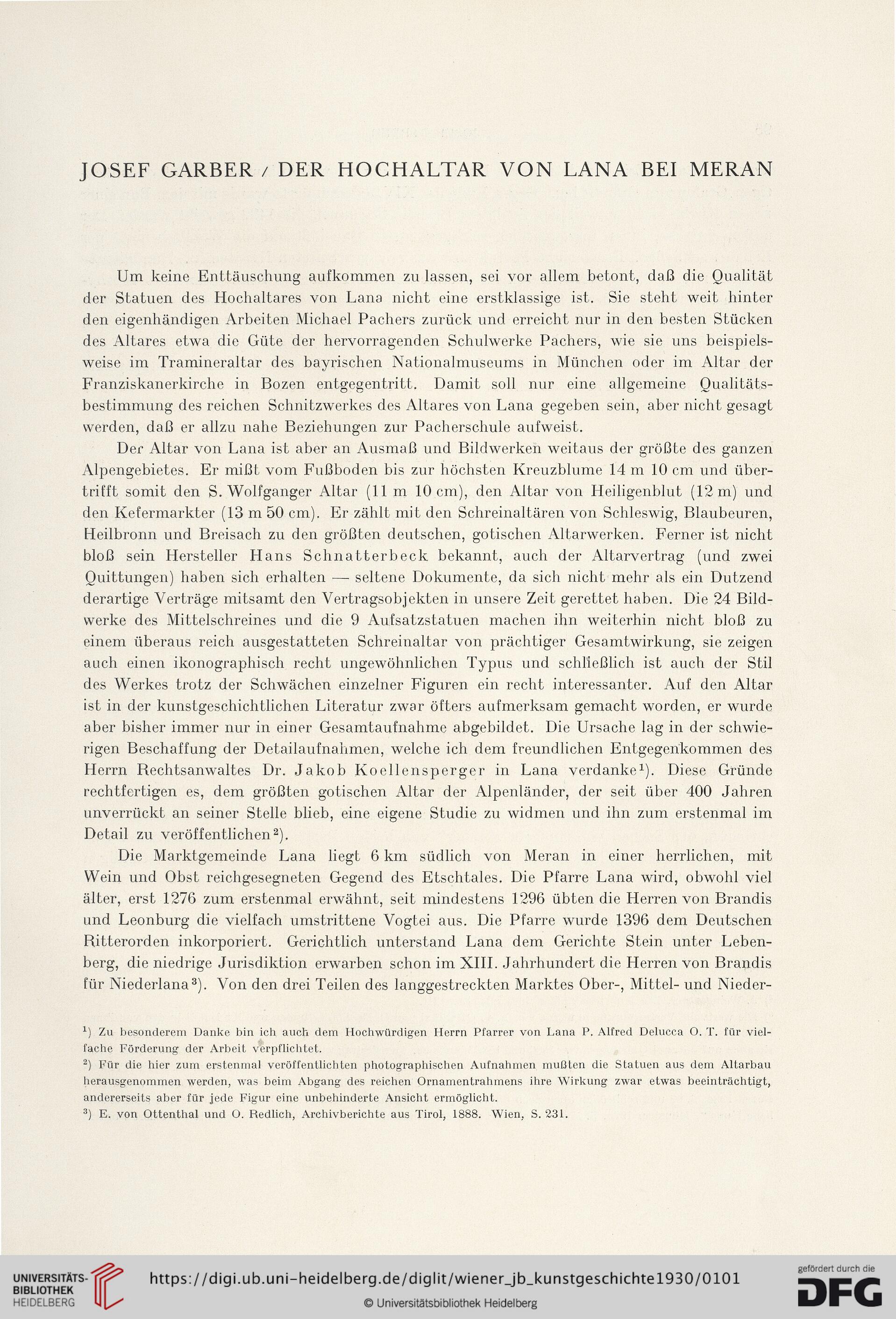JOSEF GARBER / DER HOCHALTAR VON LANA BEI MERAN
Um keine Enttäuschung aufkommen zu lassen, sei vor allem betont, daß die Qualität
der Statuen des Hochaltares von Lana nicht eine erstklassige ist. Sie steht weit hinter
den eigenhändigen Arbeiten Michael Pachers zurück und erreicht nur in den besten Stücken
des Altares etwa die Güte der hervorragenden Schulwerke Pachers, wie sie uns beispiels-
weise im Tramineraltar des bayrischen Nationalmuseums in München oder im Altar der
Franziskanerkirche in Bozen entgegentritt. Damit soll nur eine allgemeine Qualitäts-
bestimmung des reichen Schnitzwerkes des Altares von Lana gegeben sein, aber nicht gesagt
werden, daß er allzu nahe Beziehungen zur Pacherschule aufweist.
Der Altar von Lana ist aber an Ausmaß und Bildwerken weitaus der größte des ganzen
Alpengebietes. Er mißt vom Fußboden bis zur höchsten Kreuzblume 14 m 10 cm und über-
trifft somit den S. Wolfganger Altar (11 m 10 cm), den Altar von Heiligenblut (12 m) und
den Kefermarkter (13 m 50 cm). Er zählt mit den Schreinaltären von Schleswig, Blaubeuren,
Heilbronn und Breisach zu den größten deutschen, gotischen Altarwerken. Ferner ist nicht
bloß sein Hersteller Hans Schnatterbeck bekannt, auch der Altarvertrag (und zwei
Quittungen) haben sich erhalten — seltene Dokumente, da sich nicht mehr als ein Dutzend
derartige Verträge mitsamt den Vertragsobjekten in unsere Zeit gerettet haben. Die 24 Bild-
werke des Mittelschreines und die 9 Aufsatzstatuen machen ihn weiterhin nicht bloß zu
einem überaus reich ausgestatteten Schreinaltar von prächtiger Gesamtwirkung, sie zeigen
auch einen ikonographisch recht ungewöhnlichen Typus und schließlich ist auch der Stil
des Werkes trotz der Schwächen einzelner Figuren ein recht interessanter. Auf den Altar
ist in der kunstgeschichtlichen Literatur zwar öfters aufmerksam gemacht worden, er wurde
aber bisher immer nur in einer Gesamtaufnahme abgebildet. Die Ursache lag in der schwie-
rigen Beschaffung der Detailaufnahmen, welche ich dem freundlichen Entgegenkommen des
Herrn Rechtsanwaltes Dr. Jakob Koellensperger in Lana verdanke1). Diese Gründe
rechtfertigen es, dem größten gotischen Altar der Alpenländer, der seit über 400 Jahren
unverrückt an seiner Stelle blieb, eine eigene Studie zu widmen und ihn zum erstenmal im
Detail zu veröffentlichen2).
Die Marktgemeinde Lana liegt 6 km südlich von Meran in einer herrlichen, mit
Wein und Obst reichgesegneten Gegend des Etschtales. Die Pfarre Lana wird, obwohl viel
älter, erst 1276 zum erstenmal erwähnt, seit mindestens 1296 übten die Herren von Brandis
und Leonburg die vielfach umstrittene Vogtei aus. Die Pfarre wurde 1396 dem Deutschen
Ritterorden inkorporiert. Gerichtlich unterstand Lana dem Gerichte Stein unter Leben-
berg, die niedrige Jurisdiktion erwarben schon im XIII. Jahrhundert die Herren von Brandis
für Niederlana3). Von den drei Teilen des langgestreckten Marktes Ober-, Mittel- und Nieder-
0 Zu besonderem Danke bin ich auch dem Hochwürdigen Herrn Pfarrer von Lana P. Alfred Delucca O. T. für viel-
fache Förderung der Arbeit verpflichtet.
2) Für die hier zum erstenmal veröffentlichten photographischen Aufnahmen mußten die Statuen aus dem Altarbau
herausgenommen werden, was beim Abgang des reichen Ornamentrahmens ihre Wirkung zwar etwas beeinträchtigt,
andererseits aber für jede Figur eine unbehinderte Ansicht ermöglicht.
3) E. von Ottenthal und O. Redlich, Archivberichte aus Tirol, 1888. Wien, S. 231.
Um keine Enttäuschung aufkommen zu lassen, sei vor allem betont, daß die Qualität
der Statuen des Hochaltares von Lana nicht eine erstklassige ist. Sie steht weit hinter
den eigenhändigen Arbeiten Michael Pachers zurück und erreicht nur in den besten Stücken
des Altares etwa die Güte der hervorragenden Schulwerke Pachers, wie sie uns beispiels-
weise im Tramineraltar des bayrischen Nationalmuseums in München oder im Altar der
Franziskanerkirche in Bozen entgegentritt. Damit soll nur eine allgemeine Qualitäts-
bestimmung des reichen Schnitzwerkes des Altares von Lana gegeben sein, aber nicht gesagt
werden, daß er allzu nahe Beziehungen zur Pacherschule aufweist.
Der Altar von Lana ist aber an Ausmaß und Bildwerken weitaus der größte des ganzen
Alpengebietes. Er mißt vom Fußboden bis zur höchsten Kreuzblume 14 m 10 cm und über-
trifft somit den S. Wolfganger Altar (11 m 10 cm), den Altar von Heiligenblut (12 m) und
den Kefermarkter (13 m 50 cm). Er zählt mit den Schreinaltären von Schleswig, Blaubeuren,
Heilbronn und Breisach zu den größten deutschen, gotischen Altarwerken. Ferner ist nicht
bloß sein Hersteller Hans Schnatterbeck bekannt, auch der Altarvertrag (und zwei
Quittungen) haben sich erhalten — seltene Dokumente, da sich nicht mehr als ein Dutzend
derartige Verträge mitsamt den Vertragsobjekten in unsere Zeit gerettet haben. Die 24 Bild-
werke des Mittelschreines und die 9 Aufsatzstatuen machen ihn weiterhin nicht bloß zu
einem überaus reich ausgestatteten Schreinaltar von prächtiger Gesamtwirkung, sie zeigen
auch einen ikonographisch recht ungewöhnlichen Typus und schließlich ist auch der Stil
des Werkes trotz der Schwächen einzelner Figuren ein recht interessanter. Auf den Altar
ist in der kunstgeschichtlichen Literatur zwar öfters aufmerksam gemacht worden, er wurde
aber bisher immer nur in einer Gesamtaufnahme abgebildet. Die Ursache lag in der schwie-
rigen Beschaffung der Detailaufnahmen, welche ich dem freundlichen Entgegenkommen des
Herrn Rechtsanwaltes Dr. Jakob Koellensperger in Lana verdanke1). Diese Gründe
rechtfertigen es, dem größten gotischen Altar der Alpenländer, der seit über 400 Jahren
unverrückt an seiner Stelle blieb, eine eigene Studie zu widmen und ihn zum erstenmal im
Detail zu veröffentlichen2).
Die Marktgemeinde Lana liegt 6 km südlich von Meran in einer herrlichen, mit
Wein und Obst reichgesegneten Gegend des Etschtales. Die Pfarre Lana wird, obwohl viel
älter, erst 1276 zum erstenmal erwähnt, seit mindestens 1296 übten die Herren von Brandis
und Leonburg die vielfach umstrittene Vogtei aus. Die Pfarre wurde 1396 dem Deutschen
Ritterorden inkorporiert. Gerichtlich unterstand Lana dem Gerichte Stein unter Leben-
berg, die niedrige Jurisdiktion erwarben schon im XIII. Jahrhundert die Herren von Brandis
für Niederlana3). Von den drei Teilen des langgestreckten Marktes Ober-, Mittel- und Nieder-
0 Zu besonderem Danke bin ich auch dem Hochwürdigen Herrn Pfarrer von Lana P. Alfred Delucca O. T. für viel-
fache Förderung der Arbeit verpflichtet.
2) Für die hier zum erstenmal veröffentlichten photographischen Aufnahmen mußten die Statuen aus dem Altarbau
herausgenommen werden, was beim Abgang des reichen Ornamentrahmens ihre Wirkung zwar etwas beeinträchtigt,
andererseits aber für jede Figur eine unbehinderte Ansicht ermöglicht.
3) E. von Ottenthal und O. Redlich, Archivberichte aus Tirol, 1888. Wien, S. 231.