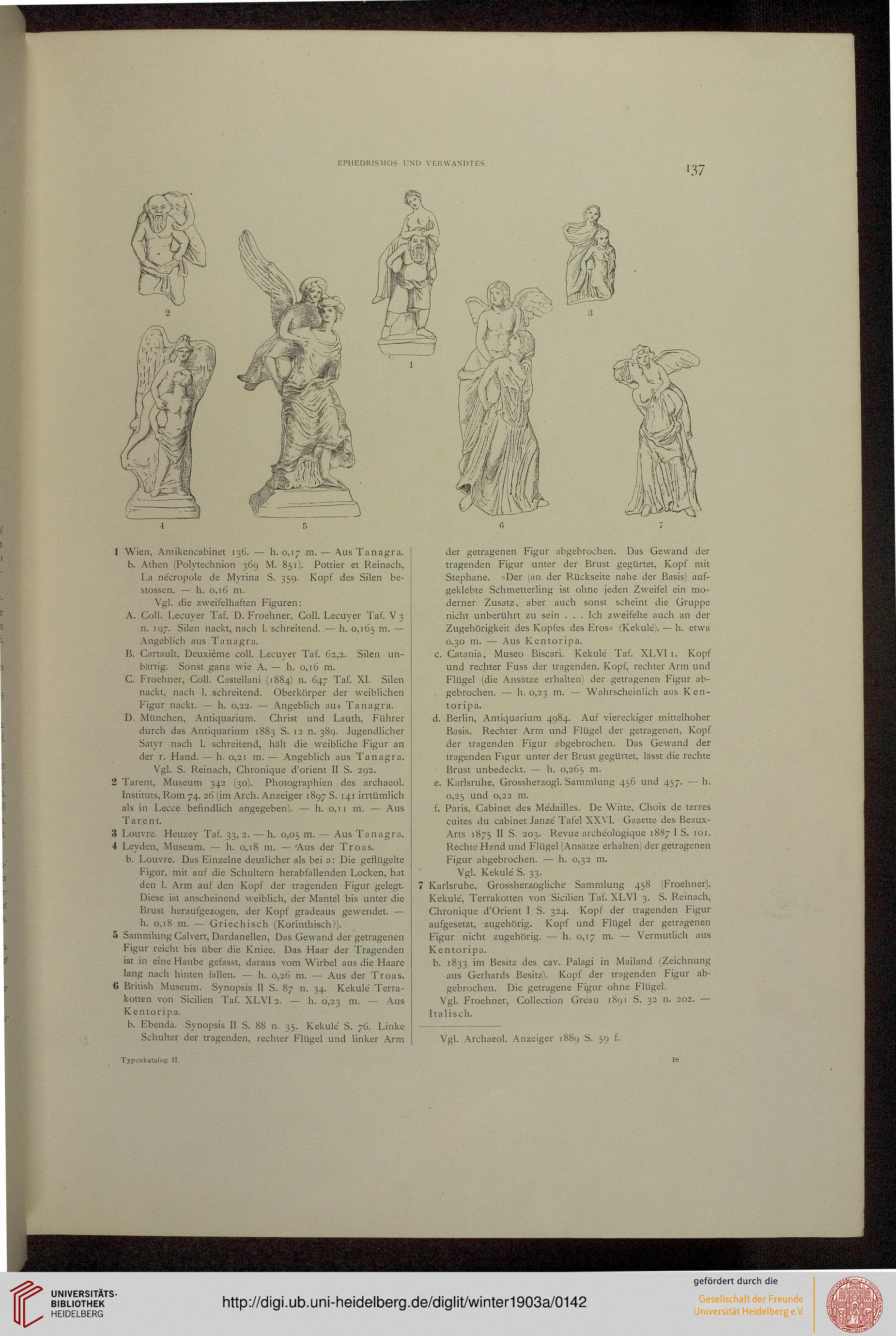EPHEDRIS.MOS UND VERWANDTES
37
im mm
mim
1 Wien, Antikencabinet 136. — h. 0,17 m. ■— Aus Tanagra.
b. Athen (Polytechnion 369 M. 851). Pottier et Reinach,
La ne'cropole de Myrina S. 359. Kopf des Silen be-
stossen. — h. 0,16 m.
Vgl. die zweifelhaften Figuren:
A. Coli. Lecuyer Tat D. Froehner, Coli. Lecuyer Taf. V 3
n. 197. Silen nackt, nach 1. schreitend. — h. 0,165 nl- —
Angeblich aus Tanagra.
B. Cartault, Deuxieme coli. Lecuyer Taf. 62,2. Silen un-
bärtig. Sonst ganz wie A. — h. o, 16 m.
C. Froehner, Colh Castellani (1884) n. 647 Taf. XI. Silen
nackt, nach 1. schreitend. Oberkörper der weiblichen
Figur nackt. — h. 0,22. — Angeblich aus Tanagra.
D. München, Antiquarium. Christ und Lauth, Führer
durch das Antiquarium 1883 S. 12 n. 389. Jugendlicher
Satyr nach 1. schreitend, hält die weibliche Figur an
der r. Hand. — h. 0,21 m. — Angeblich aus Tanagra.
Vgl. S. Reinach, Chronique d'orient II S. 292.
2 Tarent, Museum 342 (30). Photographien des archaeol.
Instituts, Rom 74, 26 (im Arch. Anzeiger 1897 S. 141 irrtümlich
als in Lecce befindlich angegeben). — h. 0,11 m. — Aus
Tarent.
3 Louvre. Heuzey Taf. 33, 2. — h. 0,05 m. — Aus Tanagra.
4 Leyden, Museum. — h. 0,18 m. — Aus der Troas.
b. Louvre. Das Einzelne deutlicher als bei a: Die geflügelte
Figur, mit auf die Schultern herabfallenden Locken, hat
den 1. Arm auf den Kopf der tragenden Figur gelegt.
Diese ist anscheinend weiblich, der Mantel bis unter die
Brust heraufgezogen, der Kopf gradeaus gewendet. —
h. 0,18 m. — Griechisch (Korinthisch?).
5 Sammlung Calvert, Dardanellen, Das Gewand der getragenen
Figur reicht bis über die Kniee. Das Haar der Tragenden
ist in eine Haube gefasst, daraus vom Wirbel aus die Haare
lang nach hinten fallen. — h. 0,26 m. — Aus der Troas.
6 British Museum. Synopsis II S. 87 n. 34. Kekule Terra-
kotten von Sicilien Taf. XLVI2. — h. 0,23 m. — Aus
Kentoripa.
b. Ebenda. Synopsis II S. 88 n. 35. Kekule S. 76. Linke
Schulter der tragenden, rechter Flügel und linker Arm
der getragenen Figur abgebrochen. Das Gewand der
tragenden Figur unter der Brust gegürtet, Kopf mit
Stephane. »Der (an der Rückseite nahe der Basis) auf-
geklebte Schmetterling ist ohne jeden Zweifel ein mo-
derner Zusatz, aber auch sonst scheint die Gruppe
nicht unberührt zu sein . . . Ich zweifelte auch an der
Zugehörigkeit des Kopfes des Eros« (Kekule'). — h. etwa
0,30 m. — Aus Kentoripa.
c. Catania, Museo Biscari. Kekule Taf. XLVI 1. Kopf
und rechter Fuss der tragenden. Kopf, rechter Arm und
Flügel (die Ansätze erhalten) der getragenen Figur ab-
gebrochen. — h. 0,23 m. — Wahrscheinlich aus Ken-
toripa.
d. Berlin, Antiquarium 4984. Auf viereckiger mittelhoher
Basis. Rechter Arm und Flügel der getragenen, Kopf
der tragenden Figur abgebrochen. Das Gewand der
tragenden Figur unter der Brust gegürtet, lässt die rechte
Brust unbedeckt. — h. 0,265 m-
e. Karlsruhe, Grossherzogl. Sammlung 456 und 457. — h.
0,25 und 0,22 m.
f. Paris, Cabinet des Me'dailles. De Witte, Choix de terres
cuites du cabinet Janze' Tafel XXVI. Gazette des Beaux-
Arts 1875 II S. 203. Revue arche'ologique 1887 I S. 101.
Rechte Hand und Flügel (Ansätze erhalten) der getragenen
Figur abgebrochen. — h. 0,32 m.
Vgl. Kekule' S. 33.
Karlsruhe, Grossherzogliche Sammlung 458 (Froehner).
Kekule, Terrakotten von Sicilien Taf. XLVI 3. S. Reinach,
Chronique d'Orient I S. 324. Kopf der tragenden Figur
aufgesetzt, zugehörig. Kopf und Flügel der getragenen
Figur nicht zugehörig. — h. 0,17 m. — Vermutlich aus
Kentoripa.
b. 1833 im Besitz des cav. Palagi in Mailand (Zeichnung
aus Gerhards Besitz). Kopf der tragenden Figur ab-
gebrochen. Die getragene Figur ohne Flügel.
Vgl. Froehner, Collection Gre'au 1891 S. 32 n. 202. —
Italisch.
Vgl. Archaeol. Anzeiger 1889 S. 59 f.
Typcnliutalog II
37
im mm
mim
1 Wien, Antikencabinet 136. — h. 0,17 m. ■— Aus Tanagra.
b. Athen (Polytechnion 369 M. 851). Pottier et Reinach,
La ne'cropole de Myrina S. 359. Kopf des Silen be-
stossen. — h. 0,16 m.
Vgl. die zweifelhaften Figuren:
A. Coli. Lecuyer Tat D. Froehner, Coli. Lecuyer Taf. V 3
n. 197. Silen nackt, nach 1. schreitend. — h. 0,165 nl- —
Angeblich aus Tanagra.
B. Cartault, Deuxieme coli. Lecuyer Taf. 62,2. Silen un-
bärtig. Sonst ganz wie A. — h. o, 16 m.
C. Froehner, Colh Castellani (1884) n. 647 Taf. XI. Silen
nackt, nach 1. schreitend. Oberkörper der weiblichen
Figur nackt. — h. 0,22. — Angeblich aus Tanagra.
D. München, Antiquarium. Christ und Lauth, Führer
durch das Antiquarium 1883 S. 12 n. 389. Jugendlicher
Satyr nach 1. schreitend, hält die weibliche Figur an
der r. Hand. — h. 0,21 m. — Angeblich aus Tanagra.
Vgl. S. Reinach, Chronique d'orient II S. 292.
2 Tarent, Museum 342 (30). Photographien des archaeol.
Instituts, Rom 74, 26 (im Arch. Anzeiger 1897 S. 141 irrtümlich
als in Lecce befindlich angegeben). — h. 0,11 m. — Aus
Tarent.
3 Louvre. Heuzey Taf. 33, 2. — h. 0,05 m. — Aus Tanagra.
4 Leyden, Museum. — h. 0,18 m. — Aus der Troas.
b. Louvre. Das Einzelne deutlicher als bei a: Die geflügelte
Figur, mit auf die Schultern herabfallenden Locken, hat
den 1. Arm auf den Kopf der tragenden Figur gelegt.
Diese ist anscheinend weiblich, der Mantel bis unter die
Brust heraufgezogen, der Kopf gradeaus gewendet. —
h. 0,18 m. — Griechisch (Korinthisch?).
5 Sammlung Calvert, Dardanellen, Das Gewand der getragenen
Figur reicht bis über die Kniee. Das Haar der Tragenden
ist in eine Haube gefasst, daraus vom Wirbel aus die Haare
lang nach hinten fallen. — h. 0,26 m. — Aus der Troas.
6 British Museum. Synopsis II S. 87 n. 34. Kekule Terra-
kotten von Sicilien Taf. XLVI2. — h. 0,23 m. — Aus
Kentoripa.
b. Ebenda. Synopsis II S. 88 n. 35. Kekule S. 76. Linke
Schulter der tragenden, rechter Flügel und linker Arm
der getragenen Figur abgebrochen. Das Gewand der
tragenden Figur unter der Brust gegürtet, Kopf mit
Stephane. »Der (an der Rückseite nahe der Basis) auf-
geklebte Schmetterling ist ohne jeden Zweifel ein mo-
derner Zusatz, aber auch sonst scheint die Gruppe
nicht unberührt zu sein . . . Ich zweifelte auch an der
Zugehörigkeit des Kopfes des Eros« (Kekule'). — h. etwa
0,30 m. — Aus Kentoripa.
c. Catania, Museo Biscari. Kekule Taf. XLVI 1. Kopf
und rechter Fuss der tragenden. Kopf, rechter Arm und
Flügel (die Ansätze erhalten) der getragenen Figur ab-
gebrochen. — h. 0,23 m. — Wahrscheinlich aus Ken-
toripa.
d. Berlin, Antiquarium 4984. Auf viereckiger mittelhoher
Basis. Rechter Arm und Flügel der getragenen, Kopf
der tragenden Figur abgebrochen. Das Gewand der
tragenden Figur unter der Brust gegürtet, lässt die rechte
Brust unbedeckt. — h. 0,265 m-
e. Karlsruhe, Grossherzogl. Sammlung 456 und 457. — h.
0,25 und 0,22 m.
f. Paris, Cabinet des Me'dailles. De Witte, Choix de terres
cuites du cabinet Janze' Tafel XXVI. Gazette des Beaux-
Arts 1875 II S. 203. Revue arche'ologique 1887 I S. 101.
Rechte Hand und Flügel (Ansätze erhalten) der getragenen
Figur abgebrochen. — h. 0,32 m.
Vgl. Kekule' S. 33.
Karlsruhe, Grossherzogliche Sammlung 458 (Froehner).
Kekule, Terrakotten von Sicilien Taf. XLVI 3. S. Reinach,
Chronique d'Orient I S. 324. Kopf der tragenden Figur
aufgesetzt, zugehörig. Kopf und Flügel der getragenen
Figur nicht zugehörig. — h. 0,17 m. — Vermutlich aus
Kentoripa.
b. 1833 im Besitz des cav. Palagi in Mailand (Zeichnung
aus Gerhards Besitz). Kopf der tragenden Figur ab-
gebrochen. Die getragene Figur ohne Flügel.
Vgl. Froehner, Collection Gre'au 1891 S. 32 n. 202. —
Italisch.
Vgl. Archaeol. Anzeiger 1889 S. 59 f.
Typcnliutalog II