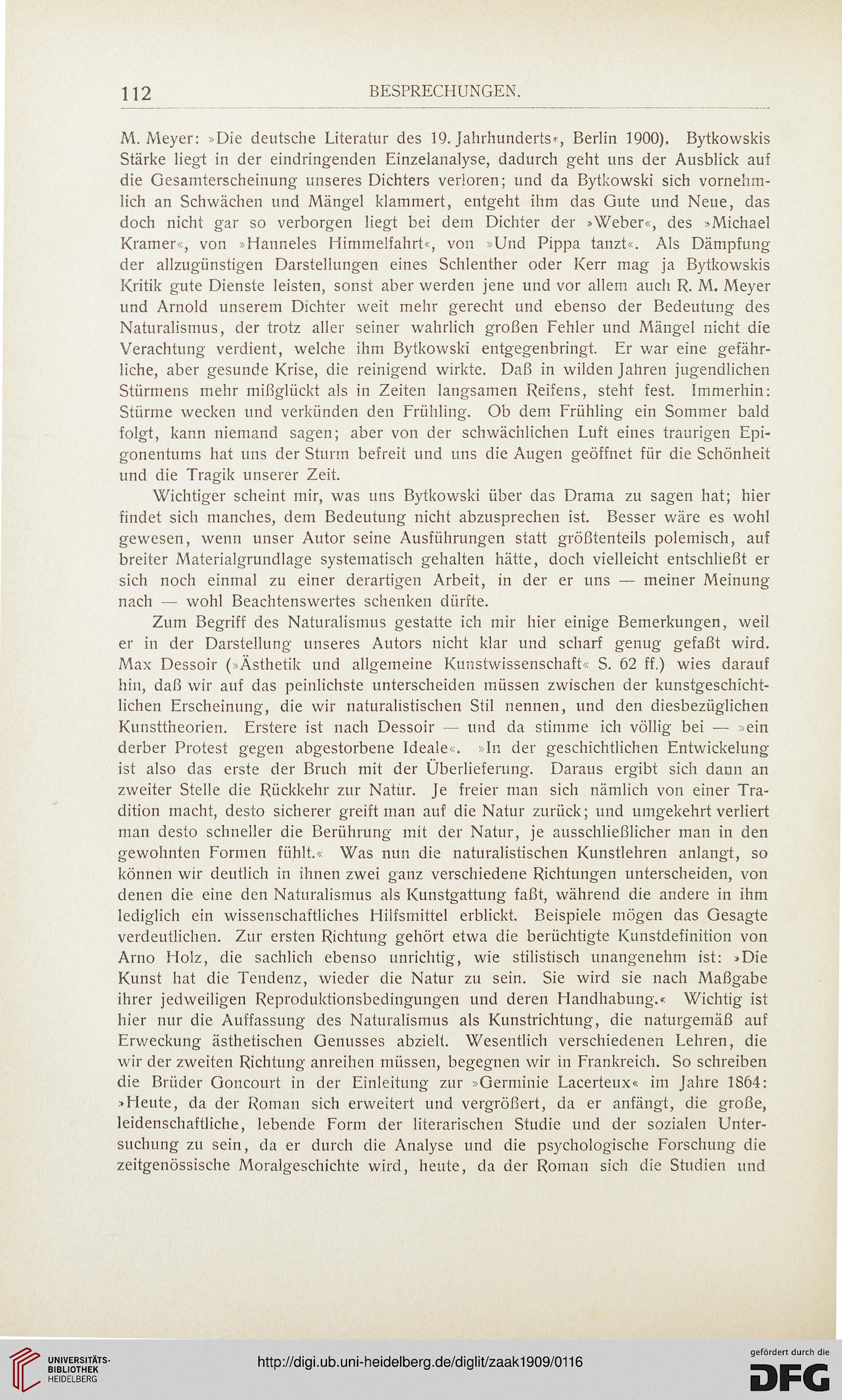112
BESPRECHUNGEN.
M. Meyer: »Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts-'-, Berlin 1900). Bytkowskis
Stärke liegt in der eindringenden Einzelanalyse, dadurch geht uns der Ausblick auf
die Gesamterscheinung unseres Dichters verloren; und da Bytkowski sich vornehm-
lich an Schwächen und Mängel klammert, entgeht ihm das Gute und Neue, das
doch nicht gar so verborgen liegt bei dem Dichter der »Weber«, des »Michael
Kramer«, von »Hanneles Himmelfahrt«, von »Und Pippa tanzt«. Als Dämpfung
der allzugünstigen Darstellungen eines Schlenther oder Kerr mag ja Bytkowskis
Kritik gute Dienste leisten, sonst aber werden jene und vor allem auch R. M. Meyer
und Arnold unserem Dichter weit mehr gerecht und ebenso der Bedeutung des
Naturalismus, der trotz aller seiner wahrlich großen Fehler und Mängel nicht die
Verachtung verdient, welche ihm Bytkowski entgegenbringt. Er war eine gefähr-
liche, aber gesunde Krise, die reinigend wirkte. Daß in wilden Jahren jugendlichen
Stürmens mehr mißglückt als in Zeiten langsamen Reifens, steht fest. Immerhin:
Stürme wecken und verkünden den Frühling. Ob dem Frühling ein Sommer bald
folgt, kann niemand sagen; aber von der schwächlichen Luft eines traurigen Epi-
gonentums hat uns der Sturm befreit und uns die Augen geöffnet für die Schönheit
und die Tragik unserer Zeit.
Wichtiger scheint mir, was uns Bytkowski über das Drama zu sagen hat; hier
findet sich manches, dem Bedeutung nicht abzusprechen ist. Besser wäre es wohl
gewesen, wenn unser Autor seine Ausführungen statt größtenteils polemisch, auf
breiter Materialgrundlage systematisch gehalten hätte, doch vielleicht entschließt er
sich noch einmal zu einer derartigen Arbeit, in der er uns — meiner Meinung
nach — wohl Beachtenswertes schenken dürfte.
Zum Begriff des Naturalismus gestatte ich mir hier einige Bemerkungen, weil
er in der Darstellung unseres Autors nicht klar und scharf genug gefaßt wird.
Max Dessoir (»Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft« S. 62 ff.) wies darauf
hin, daß wir auf das peinlichste unterscheiden müssen zwischen der kunstgeschicht-
lichen Erscheinung, die wir naturalistischen Stil nennen, und den diesbezüglichen
Kunsttheorien. Erstere ist nach Dessoir — und da stimme ich völlig bei — »ein
derber Protest gegen abgestorbene Ideale«. »In der geschichtlichen Entwickelung
ist also das erste der Bruch mit der Überlieferung. Daraus ergibt sich dann an
zweiter Stelle die Rückkehr zur Natür. Je freier man sich nämlich von einer Tra-
dition macht, desto sicherer greift man auf die Natur zurück; und umgekehrt verliert
man desto schneller die Berührung mit der Natur, je ausschließlicher man in den
gewohnten Formen fühlt.« Was nun die naturalistischen Kunstlehren anlangt, so
können wir deutlich in ihnen zwei ganz verschiedene Richtungen unterscheiden, von
denen die eine den Naturalismus als Kunstgattung faßt, während die andere in ihm
lediglich ein wissenschaftliches Hilfsmittel erblickt. Beispiele mögen das Gesagte
verdeutlichen. Zur ersten Richtung gehört etwa die berüchtigte Kunstdefinition von
Arno Holz, die sachlich ebenso unrichtig, wie stilistisch unangenehm ist: »Die
Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe
ihrer jedweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung.« Wichtig ist
hier nur die Auffassung des Naturalismus als Kunstrichtung, die naturgemäß auf
Erweckung ästhetischen Genusses abzielt. Wesentlich verschiedenen Lehren, die
wir der zweiten Richtung anreihen müssen, begegnen wir in Frankreich. So schreiben
die Brüder Goncourt in der Einleitung zur »Germinie Lacerteux« im Jahre 1864:
»Heute, da der Roman sich erweitert und vergrößert, da er anfängt, die große,
leidenschaftliche, lebende Form der literarischen Studie und der sozialen Unter-
suchung zu sein, da er durch die Analyse und die psychologische Forschung die
zeitgenössische Moralgeschichte wird, heute, da der Roman sich die Studien und
BESPRECHUNGEN.
M. Meyer: »Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts-'-, Berlin 1900). Bytkowskis
Stärke liegt in der eindringenden Einzelanalyse, dadurch geht uns der Ausblick auf
die Gesamterscheinung unseres Dichters verloren; und da Bytkowski sich vornehm-
lich an Schwächen und Mängel klammert, entgeht ihm das Gute und Neue, das
doch nicht gar so verborgen liegt bei dem Dichter der »Weber«, des »Michael
Kramer«, von »Hanneles Himmelfahrt«, von »Und Pippa tanzt«. Als Dämpfung
der allzugünstigen Darstellungen eines Schlenther oder Kerr mag ja Bytkowskis
Kritik gute Dienste leisten, sonst aber werden jene und vor allem auch R. M. Meyer
und Arnold unserem Dichter weit mehr gerecht und ebenso der Bedeutung des
Naturalismus, der trotz aller seiner wahrlich großen Fehler und Mängel nicht die
Verachtung verdient, welche ihm Bytkowski entgegenbringt. Er war eine gefähr-
liche, aber gesunde Krise, die reinigend wirkte. Daß in wilden Jahren jugendlichen
Stürmens mehr mißglückt als in Zeiten langsamen Reifens, steht fest. Immerhin:
Stürme wecken und verkünden den Frühling. Ob dem Frühling ein Sommer bald
folgt, kann niemand sagen; aber von der schwächlichen Luft eines traurigen Epi-
gonentums hat uns der Sturm befreit und uns die Augen geöffnet für die Schönheit
und die Tragik unserer Zeit.
Wichtiger scheint mir, was uns Bytkowski über das Drama zu sagen hat; hier
findet sich manches, dem Bedeutung nicht abzusprechen ist. Besser wäre es wohl
gewesen, wenn unser Autor seine Ausführungen statt größtenteils polemisch, auf
breiter Materialgrundlage systematisch gehalten hätte, doch vielleicht entschließt er
sich noch einmal zu einer derartigen Arbeit, in der er uns — meiner Meinung
nach — wohl Beachtenswertes schenken dürfte.
Zum Begriff des Naturalismus gestatte ich mir hier einige Bemerkungen, weil
er in der Darstellung unseres Autors nicht klar und scharf genug gefaßt wird.
Max Dessoir (»Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft« S. 62 ff.) wies darauf
hin, daß wir auf das peinlichste unterscheiden müssen zwischen der kunstgeschicht-
lichen Erscheinung, die wir naturalistischen Stil nennen, und den diesbezüglichen
Kunsttheorien. Erstere ist nach Dessoir — und da stimme ich völlig bei — »ein
derber Protest gegen abgestorbene Ideale«. »In der geschichtlichen Entwickelung
ist also das erste der Bruch mit der Überlieferung. Daraus ergibt sich dann an
zweiter Stelle die Rückkehr zur Natür. Je freier man sich nämlich von einer Tra-
dition macht, desto sicherer greift man auf die Natur zurück; und umgekehrt verliert
man desto schneller die Berührung mit der Natur, je ausschließlicher man in den
gewohnten Formen fühlt.« Was nun die naturalistischen Kunstlehren anlangt, so
können wir deutlich in ihnen zwei ganz verschiedene Richtungen unterscheiden, von
denen die eine den Naturalismus als Kunstgattung faßt, während die andere in ihm
lediglich ein wissenschaftliches Hilfsmittel erblickt. Beispiele mögen das Gesagte
verdeutlichen. Zur ersten Richtung gehört etwa die berüchtigte Kunstdefinition von
Arno Holz, die sachlich ebenso unrichtig, wie stilistisch unangenehm ist: »Die
Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe
ihrer jedweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung.« Wichtig ist
hier nur die Auffassung des Naturalismus als Kunstrichtung, die naturgemäß auf
Erweckung ästhetischen Genusses abzielt. Wesentlich verschiedenen Lehren, die
wir der zweiten Richtung anreihen müssen, begegnen wir in Frankreich. So schreiben
die Brüder Goncourt in der Einleitung zur »Germinie Lacerteux« im Jahre 1864:
»Heute, da der Roman sich erweitert und vergrößert, da er anfängt, die große,
leidenschaftliche, lebende Form der literarischen Studie und der sozialen Unter-
suchung zu sein, da er durch die Analyse und die psychologische Forschung die
zeitgenössische Moralgeschichte wird, heute, da der Roman sich die Studien und