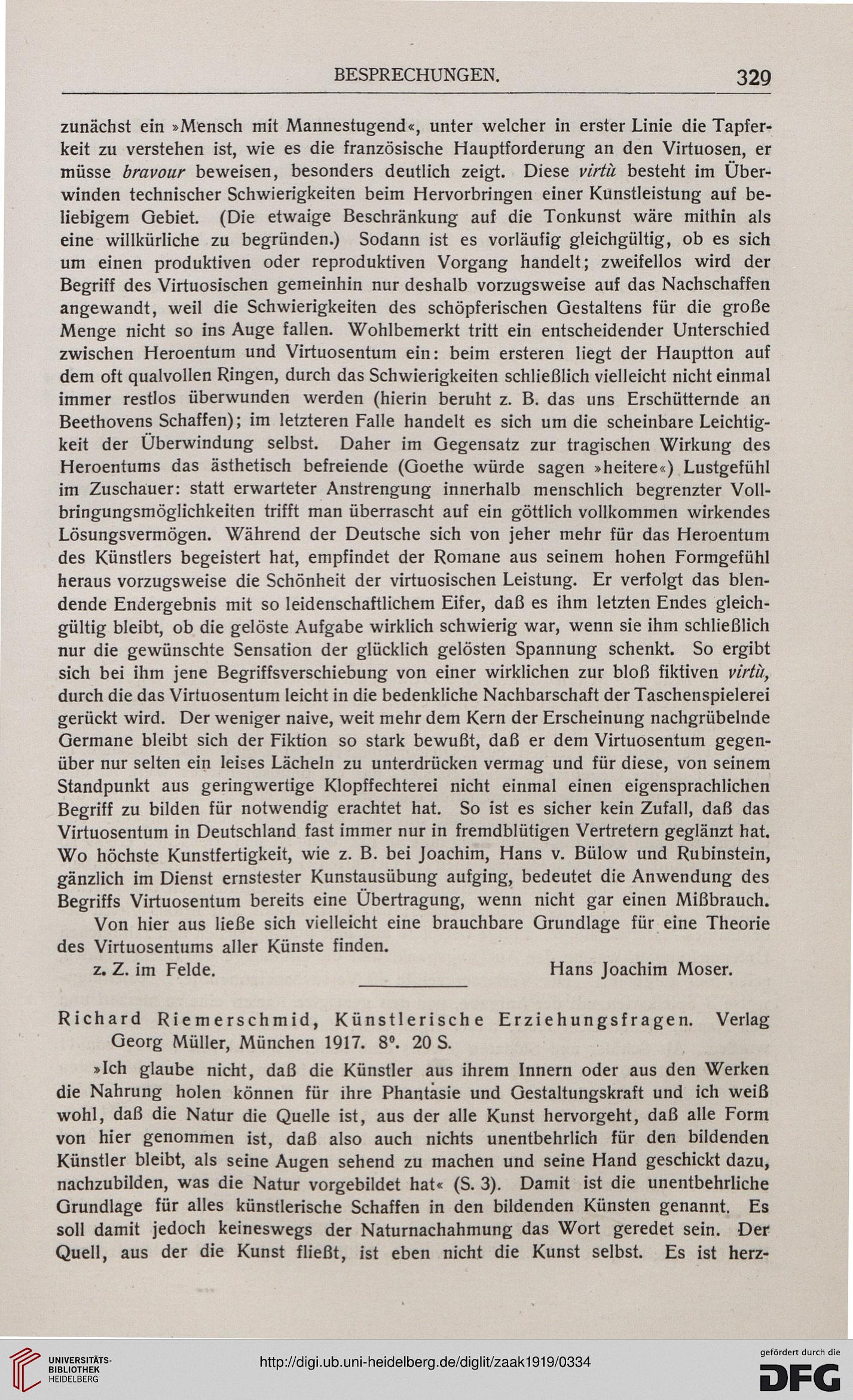BESPRECHUNGEN. 32g
zunächst ein »Mensch mit Mannestugend«, unter welcher in erster Linie die Tapfer-
keit zu verstehen ist, wie es die französische Hauptforderung an den Virtuosen, er
müsse bravour beweisen, besonders deutlich zeigt. Diese virtu besteht im Über-
winden technischer Schwierigkeiten beim Hervorbringen einer Kunstleistung auf be-
liebigem Gebiet. (Die etwaige Beschränkung auf die Tonkunst wäre mithin als
eine willkürliche zu begründen.) Sodann ist es vorläufig gleichgültig, ob es sich
um einen produktiven oder reproduktiven Vorgang handelt; zweifellos wird der
Begriff des Virtuosischen gemeinhin nur deshalb vorzugsweise auf das Nachschaffen
angewandt, weil die Schwierigkeiten des schöpferischen Oestaltens für die große
Menge nicht so ins Auge fallen. Wohlbemerkt tritt ein entscheidender Unterschied
zwischen Heroentum und Virtuosentum ein: beim ersteren liegt der Hauptton auf
dem oft qualvollen Ringen, durch das Schwierigkeiten schließlich vielleicht nicht einmal
immer restlos überwunden werden (hierin beruht z. B. das uns Erschütternde an
Beethovens Schaffen); im letzteren Falle handelt es sich um die scheinbare Leichtig-
keit der Überwindung selbst. Daher im Gegensatz zur tragischen Wirkung des
Heroentums das ästhetisch befreiende (Goethe würde sagen »heitere«) Lustgefühl
im Zuschauer: statt erwarteter Anstrengung innerhalb menschlich begrenzter Voll-
bringungsmöglichkeiten trifft man überrascht auf ein göttlich vollkommen wirkendes
Lösungsvermögen. Während der Deutsche sich von jeher mehr für das Heroentum
des Künstlers begeistert hat, empfindet der Romane aus seinem hohen Formgefühl
heraus vorzugsweise die Schönheit der virtuosischen Leistung. Er verfolgt das blen-
dende Endergebnis mit so leidenschaftlichem Eifer, daß es ihm letzten Endes gleich-
gültig bleibt, ob die gelöste Aufgabe wirklich schwierig war, wenn sie ihm schließlich
nur die gewünschte Sensation der glücklich gelösten Spannung schenkt. So ergibt
sich bei ihm jene Begriffsverschiebung von einer wirklichen zur bloß fiktiven virtu,
durch die das Virtuosentum leicht in die bedenkliche Nachbarschaft der Taschenspielerei
gerückt wird. Der weniger naive, weit mehr dem Kern der Erscheinung nachgrübelnde
Germane bleibt sich der Fiktion so stark bewußt, daß er dem Virtuosentum gegen-
über nur selten ein leises Lächeln zu unterdrücken vermag und für diese, von seinem
Standpunkt aus geringwertige Klopffechterei nicht einmal einen eigensprachlichen
Begriff zu bilden für notwendig erachtet hat. So ist es sicher kein Zufall, daß das
Virtuosentum in Deutschland fast immer nur in fremdblütigen Vertretern geglänzt hat.
Wo höchste Kunstfertigkeit, wie z. B. bei Joachim, Hans v. Bülow und Rubinstein,
gänzlich im Dienst ernstester Kunstausübung aufging, bedeutet die Anwendung des
Begriffs Virtuosentum bereits eine Übertragung, wenn nicht gar einen Mißbrauch.
Von hier aus ließe sich vielleicht eine brauchbare Grundlage für eine Theorie
des Virtuosentums aller Künste finden.
z. Z. im Felde. Hans Joachim Moser.
Richard Riemerschmid, Künstlerische Erziehungsfragen. Verlag
Georg Müller, München 1917. 8°. 20 S.
»Ich glaube nicht, daß die Künstler aus ihrem Innern oder aus den Werken
die Nahrung holen können für ihre Phantasie und Gestaltungskraft und ich weiß
wohl, daß die Natur die Quelle ist, aus der alle Kunst hervorgeht, daß alle Form
von hier genommen ist, daß also auch nichts unentbehrlich für den bildenden
Künstler bleibt, als seine Augen sehend zu machen und seine Hand geschickt dazu,
nachzubilden, was die Natur vorgebildet hat« (S. 3). Damit ist die unentbehrliche
Grundlage für alles künstlerische Schaffen in den bildenden Künsten genannt. Es
soll damit jedoch keineswegs der Naturnachahmung das Wort geredet sein. Der
Quell, aus der die Kunst fließt, ist eben nicht die Kunst selbst. Es ist herz-
zunächst ein »Mensch mit Mannestugend«, unter welcher in erster Linie die Tapfer-
keit zu verstehen ist, wie es die französische Hauptforderung an den Virtuosen, er
müsse bravour beweisen, besonders deutlich zeigt. Diese virtu besteht im Über-
winden technischer Schwierigkeiten beim Hervorbringen einer Kunstleistung auf be-
liebigem Gebiet. (Die etwaige Beschränkung auf die Tonkunst wäre mithin als
eine willkürliche zu begründen.) Sodann ist es vorläufig gleichgültig, ob es sich
um einen produktiven oder reproduktiven Vorgang handelt; zweifellos wird der
Begriff des Virtuosischen gemeinhin nur deshalb vorzugsweise auf das Nachschaffen
angewandt, weil die Schwierigkeiten des schöpferischen Oestaltens für die große
Menge nicht so ins Auge fallen. Wohlbemerkt tritt ein entscheidender Unterschied
zwischen Heroentum und Virtuosentum ein: beim ersteren liegt der Hauptton auf
dem oft qualvollen Ringen, durch das Schwierigkeiten schließlich vielleicht nicht einmal
immer restlos überwunden werden (hierin beruht z. B. das uns Erschütternde an
Beethovens Schaffen); im letzteren Falle handelt es sich um die scheinbare Leichtig-
keit der Überwindung selbst. Daher im Gegensatz zur tragischen Wirkung des
Heroentums das ästhetisch befreiende (Goethe würde sagen »heitere«) Lustgefühl
im Zuschauer: statt erwarteter Anstrengung innerhalb menschlich begrenzter Voll-
bringungsmöglichkeiten trifft man überrascht auf ein göttlich vollkommen wirkendes
Lösungsvermögen. Während der Deutsche sich von jeher mehr für das Heroentum
des Künstlers begeistert hat, empfindet der Romane aus seinem hohen Formgefühl
heraus vorzugsweise die Schönheit der virtuosischen Leistung. Er verfolgt das blen-
dende Endergebnis mit so leidenschaftlichem Eifer, daß es ihm letzten Endes gleich-
gültig bleibt, ob die gelöste Aufgabe wirklich schwierig war, wenn sie ihm schließlich
nur die gewünschte Sensation der glücklich gelösten Spannung schenkt. So ergibt
sich bei ihm jene Begriffsverschiebung von einer wirklichen zur bloß fiktiven virtu,
durch die das Virtuosentum leicht in die bedenkliche Nachbarschaft der Taschenspielerei
gerückt wird. Der weniger naive, weit mehr dem Kern der Erscheinung nachgrübelnde
Germane bleibt sich der Fiktion so stark bewußt, daß er dem Virtuosentum gegen-
über nur selten ein leises Lächeln zu unterdrücken vermag und für diese, von seinem
Standpunkt aus geringwertige Klopffechterei nicht einmal einen eigensprachlichen
Begriff zu bilden für notwendig erachtet hat. So ist es sicher kein Zufall, daß das
Virtuosentum in Deutschland fast immer nur in fremdblütigen Vertretern geglänzt hat.
Wo höchste Kunstfertigkeit, wie z. B. bei Joachim, Hans v. Bülow und Rubinstein,
gänzlich im Dienst ernstester Kunstausübung aufging, bedeutet die Anwendung des
Begriffs Virtuosentum bereits eine Übertragung, wenn nicht gar einen Mißbrauch.
Von hier aus ließe sich vielleicht eine brauchbare Grundlage für eine Theorie
des Virtuosentums aller Künste finden.
z. Z. im Felde. Hans Joachim Moser.
Richard Riemerschmid, Künstlerische Erziehungsfragen. Verlag
Georg Müller, München 1917. 8°. 20 S.
»Ich glaube nicht, daß die Künstler aus ihrem Innern oder aus den Werken
die Nahrung holen können für ihre Phantasie und Gestaltungskraft und ich weiß
wohl, daß die Natur die Quelle ist, aus der alle Kunst hervorgeht, daß alle Form
von hier genommen ist, daß also auch nichts unentbehrlich für den bildenden
Künstler bleibt, als seine Augen sehend zu machen und seine Hand geschickt dazu,
nachzubilden, was die Natur vorgebildet hat« (S. 3). Damit ist die unentbehrliche
Grundlage für alles künstlerische Schaffen in den bildenden Künsten genannt. Es
soll damit jedoch keineswegs der Naturnachahmung das Wort geredet sein. Der
Quell, aus der die Kunst fließt, ist eben nicht die Kunst selbst. Es ist herz-