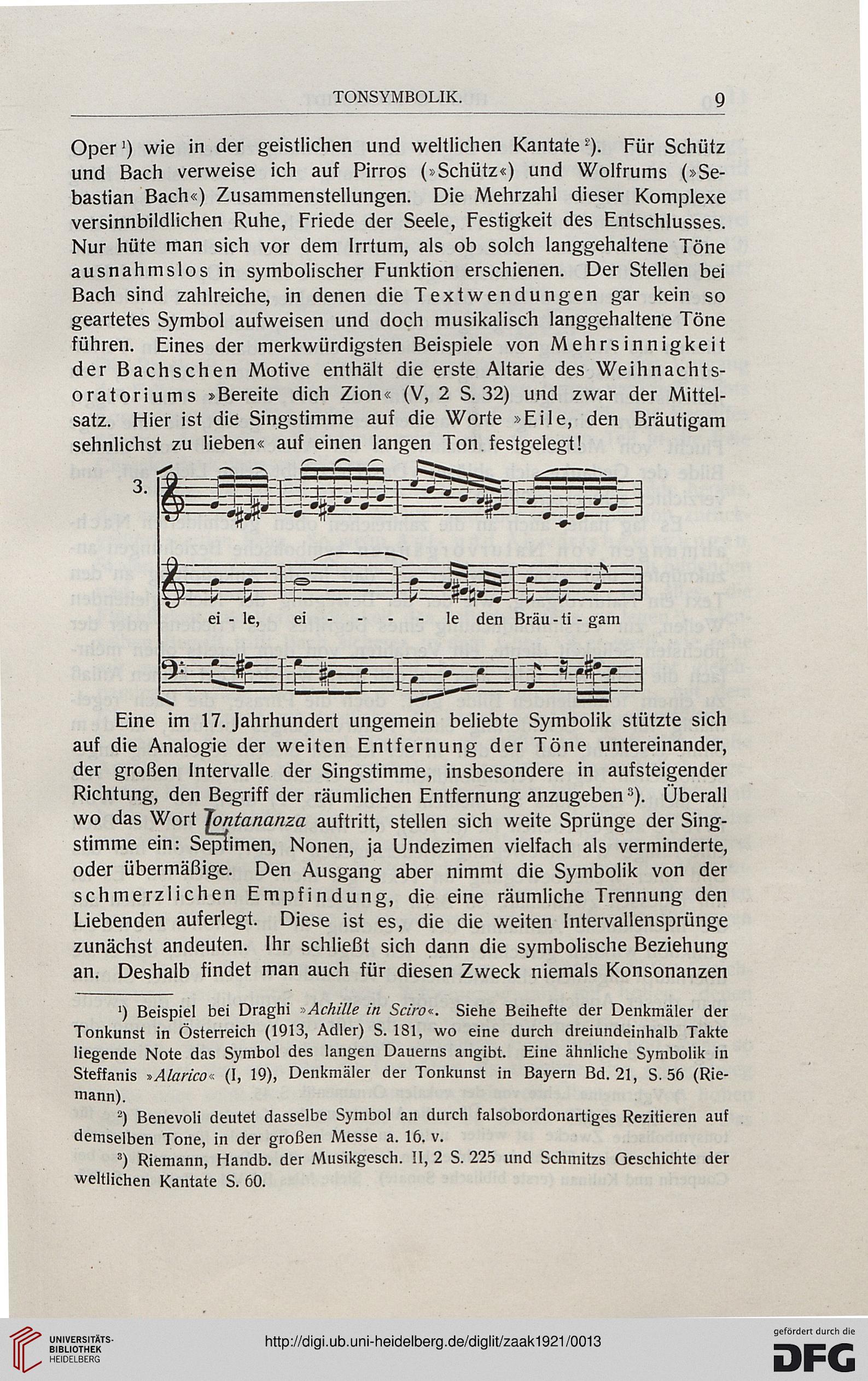TONSYMBOLIK.
Oper:) wie in der geistlichen und weltlichen Kantates). Für Schütz
und Bach verweise ich auf Pirros (»Schütz«) und Wolfrums (»Se-
bastian Bach«) Zusammenstellungen. Die Mehrzahl dieser Komplexe
versinnbildlichen Ruhe, Friede der Seele, Festigkeit des Entschlusses.
Nur hüte man sich vor dem Irrtum, als ob solch langgehaltene Töne
ausnahmslos in symbolischer Funktion erschienen. Der Stellen bei
Bach sind zahlreiche, in denen die Textwen düngen gar kein so
geartetes Symbol aufweisen und doch musikalisch langgehaltene Töne
führen. Eines der merkwürdigsten Beispiele von Mehrsinnigkeit
der Bachschen Motive enthält die erste Altarie des Weih n ach ts-
oratoriums »Bereite dich Zion« (V, 2 S. 32) und zwar der Mittel-
satz. Hier ist die Singstimme auf die Worte »Eile, den Bräutigam
sehnlichst zu lieben« auf einen langen Ton. festgelegt!
3.
S^S
--*-
i
:fi3
^Fte
•Ü*-
ei - le,
le den Bräu - ti - gam
$
ß-
3fc
-ß-
mm
Eine im 17. Jahrhundert ungemein beliebte Symbolik stützte sich
auf die Analogie der weiten Entfernung der Töne untereinander,
der großen Intervalle der Singstimme, insbesondere in aufsteigender
Richtung, den Begriff der räumlichen Entfernung anzugeben3). Überall
wo das Wort Jontananza auftritt, stellen sich weite Sprünge der Sing-
stimme ein: Septimen, Nonen, ja Undezimen vielfach als verminderte,
oder übermäßige. Den Ausgang aber nimmt die Symbolik von der
schmerzlichen Empfindung, die eine räumliche Trennung den
Liebenden auferlegt. Diese ist es, die die weiten Intervallensprünge
zunächst andeuten. Ihr schließt sich dann die symbolische Beziehung
an. Deshalb findet man auch für diesen Zweck niemals Konsonanzen
') Beispiel bei Draghi »Achille in Sciro«. Siehe Beihefte der Denkmäler der
Tonkunst in Österreich (1913, Adler) S. 181, wo eine durch dreiundeinhalb Takte
liegende Note das Symbol des langen Dauerns angibt. Eine ähnliche Symbolik in
Steffanis »Alarico« (I, 19), Denkmäler der Tonkunst in Bayern Bd. 21, S. 56 (Rie-
mann).
2) Benevoli deutet dasselbe Symbol an durch falsobordonartiges Rezitieren auf
demselben Tone, in der großen Messe a. 16. v.
3) Riemann, Handb. der Musikgesch. II, 2 S. 225 und Schmitzs Geschichte der
weltlichen Kantate S. 60.
Oper:) wie in der geistlichen und weltlichen Kantates). Für Schütz
und Bach verweise ich auf Pirros (»Schütz«) und Wolfrums (»Se-
bastian Bach«) Zusammenstellungen. Die Mehrzahl dieser Komplexe
versinnbildlichen Ruhe, Friede der Seele, Festigkeit des Entschlusses.
Nur hüte man sich vor dem Irrtum, als ob solch langgehaltene Töne
ausnahmslos in symbolischer Funktion erschienen. Der Stellen bei
Bach sind zahlreiche, in denen die Textwen düngen gar kein so
geartetes Symbol aufweisen und doch musikalisch langgehaltene Töne
führen. Eines der merkwürdigsten Beispiele von Mehrsinnigkeit
der Bachschen Motive enthält die erste Altarie des Weih n ach ts-
oratoriums »Bereite dich Zion« (V, 2 S. 32) und zwar der Mittel-
satz. Hier ist die Singstimme auf die Worte »Eile, den Bräutigam
sehnlichst zu lieben« auf einen langen Ton. festgelegt!
3.
S^S
--*-
i
:fi3
^Fte
•Ü*-
ei - le,
le den Bräu - ti - gam
$
ß-
3fc
-ß-
mm
Eine im 17. Jahrhundert ungemein beliebte Symbolik stützte sich
auf die Analogie der weiten Entfernung der Töne untereinander,
der großen Intervalle der Singstimme, insbesondere in aufsteigender
Richtung, den Begriff der räumlichen Entfernung anzugeben3). Überall
wo das Wort Jontananza auftritt, stellen sich weite Sprünge der Sing-
stimme ein: Septimen, Nonen, ja Undezimen vielfach als verminderte,
oder übermäßige. Den Ausgang aber nimmt die Symbolik von der
schmerzlichen Empfindung, die eine räumliche Trennung den
Liebenden auferlegt. Diese ist es, die die weiten Intervallensprünge
zunächst andeuten. Ihr schließt sich dann die symbolische Beziehung
an. Deshalb findet man auch für diesen Zweck niemals Konsonanzen
') Beispiel bei Draghi »Achille in Sciro«. Siehe Beihefte der Denkmäler der
Tonkunst in Österreich (1913, Adler) S. 181, wo eine durch dreiundeinhalb Takte
liegende Note das Symbol des langen Dauerns angibt. Eine ähnliche Symbolik in
Steffanis »Alarico« (I, 19), Denkmäler der Tonkunst in Bayern Bd. 21, S. 56 (Rie-
mann).
2) Benevoli deutet dasselbe Symbol an durch falsobordonartiges Rezitieren auf
demselben Tone, in der großen Messe a. 16. v.
3) Riemann, Handb. der Musikgesch. II, 2 S. 225 und Schmitzs Geschichte der
weltlichen Kantate S. 60.