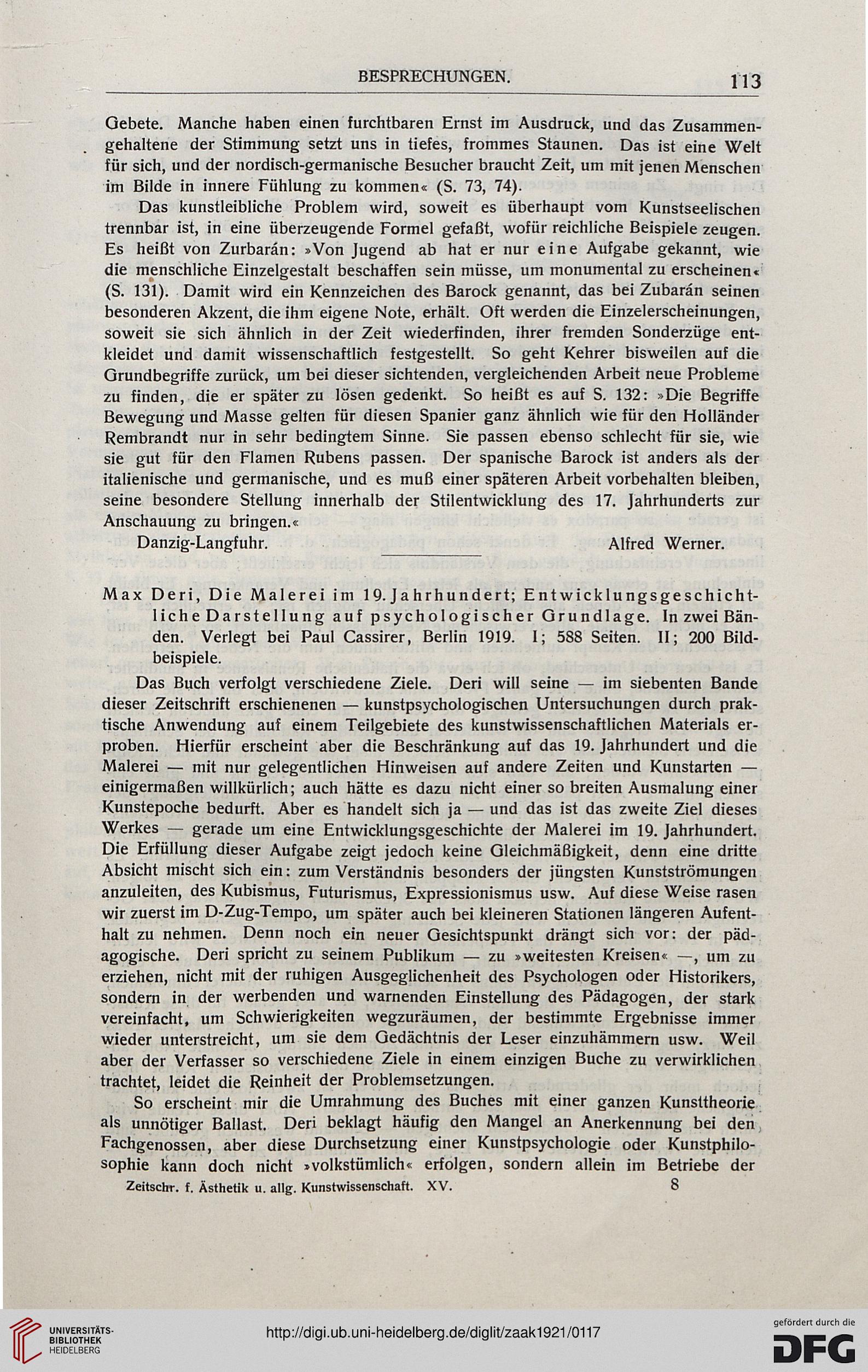BESPRECHUNGEN.
113
Gebete. Manche haben einen furchtbaren Ernst im Ausdruck, und das Zusammen-
gehaltene der Stimmung setzt uns in tiefes, frommes Staunen. Das ist eine Welt
für sich, und der nordisch-germanische Besucher braucht Zeit, um mit jenen Menschen
im Bilde in innere Fühlung zu kommen« (S. 73, 74).
Das kunstleibliche Problem wird, soweit es überhaupt vom Kunstseelischen
trennbar ist, in eine überzeugende Formel gefaßt, wofür reichliche Beispiele zeugen.
Es heißt von Zurbarän: »Von Jugend ab hat er nur eine Aufgabe gekannt, wie
die menschliche Einzelgestalt beschaffen sein müsse, um monumental zu erscheinen«
(S. 131). Damit wird ein Kennzeichen des Barock genannt, das bei Zubarän seinen
besonderen Akzent, die ihm eigene Note, erhält. Oft werden die Einzelerscheinungen,
soweit sie sich ähnlich in der Zeit wiederfinden, ihrer fremden Sonderzüge ent-
kleidet und damit wissenschaftlich festgestellt. So geht Kehrer bisweilen auf die
Grundbegriffe zurück, um bei dieser sichtenden, vergleichenden Arbeit neue Probleme
zu finden, die er später zu lösen gedenkt. So heißt es auf S. 132: »Die Begriffe
Bewegung und Masse gelten für diesen Spanier ganz ähnlich wie für den Holländer
Rembrandt nur in sehr bedingtem Sinne. Sie passen ebenso schlecht für sie, wie
sie gut für den Flamen Rubens passen. Der spanische Barock ist anders als der
italienische und germanische, und es muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben,
seine besondere Stellung innerhalb der Stilentwicklung des 17. Jahrhunderts zur
Anschauung zu bringen.«
Danzig-Langfuhr. Alfred Werner.
Max Deri, Die Malerei im 19.Jahrhundert; Entwicklungsgeschicht-
lich e Darstellung auf psychologischer Grundlage. In zwei Bän-
den. Verlegt bei Paul Cassirer, Berlin 1919. I; 588 Seiten. II; 200 Bild-
beispiele.
Das Buch verfolgt verschiedene Ziele. Deri will seine — im siebenten Bande
dieser Zeitschrift erschienenen — kunstpsychologischen Untersuchungen durch prak-
tische Anwendung auf einem Teilgebiete des kunstwissenschaftlichen Materials er-
proben. Hierfür erscheint aber die Beschränkung auf das 19. Jahrhundert und die
Malerei — mit nur gelegentlichen Hinweisen auf andere Zeiten und Kunstarten —
einigermaßen willkürlich; auch hätte es dazu nicht einer so breiten Ausmalung einer
Kunstepoche bedurft. Aber es handelt sich ja — und das ist das zweite Ziel dieses
Werkes — gerade um eine Entwicklungsgeschichte der Malerei im 19. Jahrhundert.
Die Erfüllung dieser Aufgabe zeigt jedoch keine Gleichmäßigkeit, denn eine dritte
Absicht mischt sich ein: zum Verständnis besonders der jüngsten Kunstströmungen
anzuleiten, des Kubismus, Futurismus, Expressionismus usw. Auf diese Weise rasen
wir zuerst im D-Zug-Tempo, um später auch bei kleineren Stationen längeren Aufent-
halt zu nehmen. Denn noch ein neuer Gesichtspunkt drängt sich vor: der päd-
agogische. Deri spricht zu seinem Publikum — zu »weitesten Kreisen« —, um zu
erziehen, nicht mit der ruhigen Ausgeglichenheit des Psychologen oder Historikers,
sondern in der werbenden und warnenden Einstellung des Pädagogen, der stark
vereinfacht, um Schwierigkeiten wegzuräumen, der bestimmte Ergebnisse immer
wieder unterstreicht, um sie dem Gedächtnis der Leser einzuhämmern usw. Weil
aber der Verfasser so verschiedene Ziele in einem einzigen Buche zu verwirklichen
trachtet, leidet die Reinheit der Problemsetzungen.
So erscheint mir die Umrahmung des Buches mit einer ganzen Kunsttheorie
als unnötiger Baliast. Deri beklagt häufig den Mangel an Anerkennung bei den
Fachgenossen, aber diese Durchsetzung einer Kunstpsychologie oder Kunstphilo-
sophie kann doch nicht »volkstümlich« erfolgen, sondern allein im Betriebe der
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XV. 8
113
Gebete. Manche haben einen furchtbaren Ernst im Ausdruck, und das Zusammen-
gehaltene der Stimmung setzt uns in tiefes, frommes Staunen. Das ist eine Welt
für sich, und der nordisch-germanische Besucher braucht Zeit, um mit jenen Menschen
im Bilde in innere Fühlung zu kommen« (S. 73, 74).
Das kunstleibliche Problem wird, soweit es überhaupt vom Kunstseelischen
trennbar ist, in eine überzeugende Formel gefaßt, wofür reichliche Beispiele zeugen.
Es heißt von Zurbarän: »Von Jugend ab hat er nur eine Aufgabe gekannt, wie
die menschliche Einzelgestalt beschaffen sein müsse, um monumental zu erscheinen«
(S. 131). Damit wird ein Kennzeichen des Barock genannt, das bei Zubarän seinen
besonderen Akzent, die ihm eigene Note, erhält. Oft werden die Einzelerscheinungen,
soweit sie sich ähnlich in der Zeit wiederfinden, ihrer fremden Sonderzüge ent-
kleidet und damit wissenschaftlich festgestellt. So geht Kehrer bisweilen auf die
Grundbegriffe zurück, um bei dieser sichtenden, vergleichenden Arbeit neue Probleme
zu finden, die er später zu lösen gedenkt. So heißt es auf S. 132: »Die Begriffe
Bewegung und Masse gelten für diesen Spanier ganz ähnlich wie für den Holländer
Rembrandt nur in sehr bedingtem Sinne. Sie passen ebenso schlecht für sie, wie
sie gut für den Flamen Rubens passen. Der spanische Barock ist anders als der
italienische und germanische, und es muß einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben,
seine besondere Stellung innerhalb der Stilentwicklung des 17. Jahrhunderts zur
Anschauung zu bringen.«
Danzig-Langfuhr. Alfred Werner.
Max Deri, Die Malerei im 19.Jahrhundert; Entwicklungsgeschicht-
lich e Darstellung auf psychologischer Grundlage. In zwei Bän-
den. Verlegt bei Paul Cassirer, Berlin 1919. I; 588 Seiten. II; 200 Bild-
beispiele.
Das Buch verfolgt verschiedene Ziele. Deri will seine — im siebenten Bande
dieser Zeitschrift erschienenen — kunstpsychologischen Untersuchungen durch prak-
tische Anwendung auf einem Teilgebiete des kunstwissenschaftlichen Materials er-
proben. Hierfür erscheint aber die Beschränkung auf das 19. Jahrhundert und die
Malerei — mit nur gelegentlichen Hinweisen auf andere Zeiten und Kunstarten —
einigermaßen willkürlich; auch hätte es dazu nicht einer so breiten Ausmalung einer
Kunstepoche bedurft. Aber es handelt sich ja — und das ist das zweite Ziel dieses
Werkes — gerade um eine Entwicklungsgeschichte der Malerei im 19. Jahrhundert.
Die Erfüllung dieser Aufgabe zeigt jedoch keine Gleichmäßigkeit, denn eine dritte
Absicht mischt sich ein: zum Verständnis besonders der jüngsten Kunstströmungen
anzuleiten, des Kubismus, Futurismus, Expressionismus usw. Auf diese Weise rasen
wir zuerst im D-Zug-Tempo, um später auch bei kleineren Stationen längeren Aufent-
halt zu nehmen. Denn noch ein neuer Gesichtspunkt drängt sich vor: der päd-
agogische. Deri spricht zu seinem Publikum — zu »weitesten Kreisen« —, um zu
erziehen, nicht mit der ruhigen Ausgeglichenheit des Psychologen oder Historikers,
sondern in der werbenden und warnenden Einstellung des Pädagogen, der stark
vereinfacht, um Schwierigkeiten wegzuräumen, der bestimmte Ergebnisse immer
wieder unterstreicht, um sie dem Gedächtnis der Leser einzuhämmern usw. Weil
aber der Verfasser so verschiedene Ziele in einem einzigen Buche zu verwirklichen
trachtet, leidet die Reinheit der Problemsetzungen.
So erscheint mir die Umrahmung des Buches mit einer ganzen Kunsttheorie
als unnötiger Baliast. Deri beklagt häufig den Mangel an Anerkennung bei den
Fachgenossen, aber diese Durchsetzung einer Kunstpsychologie oder Kunstphilo-
sophie kann doch nicht »volkstümlich« erfolgen, sondern allein im Betriebe der
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XV. 8