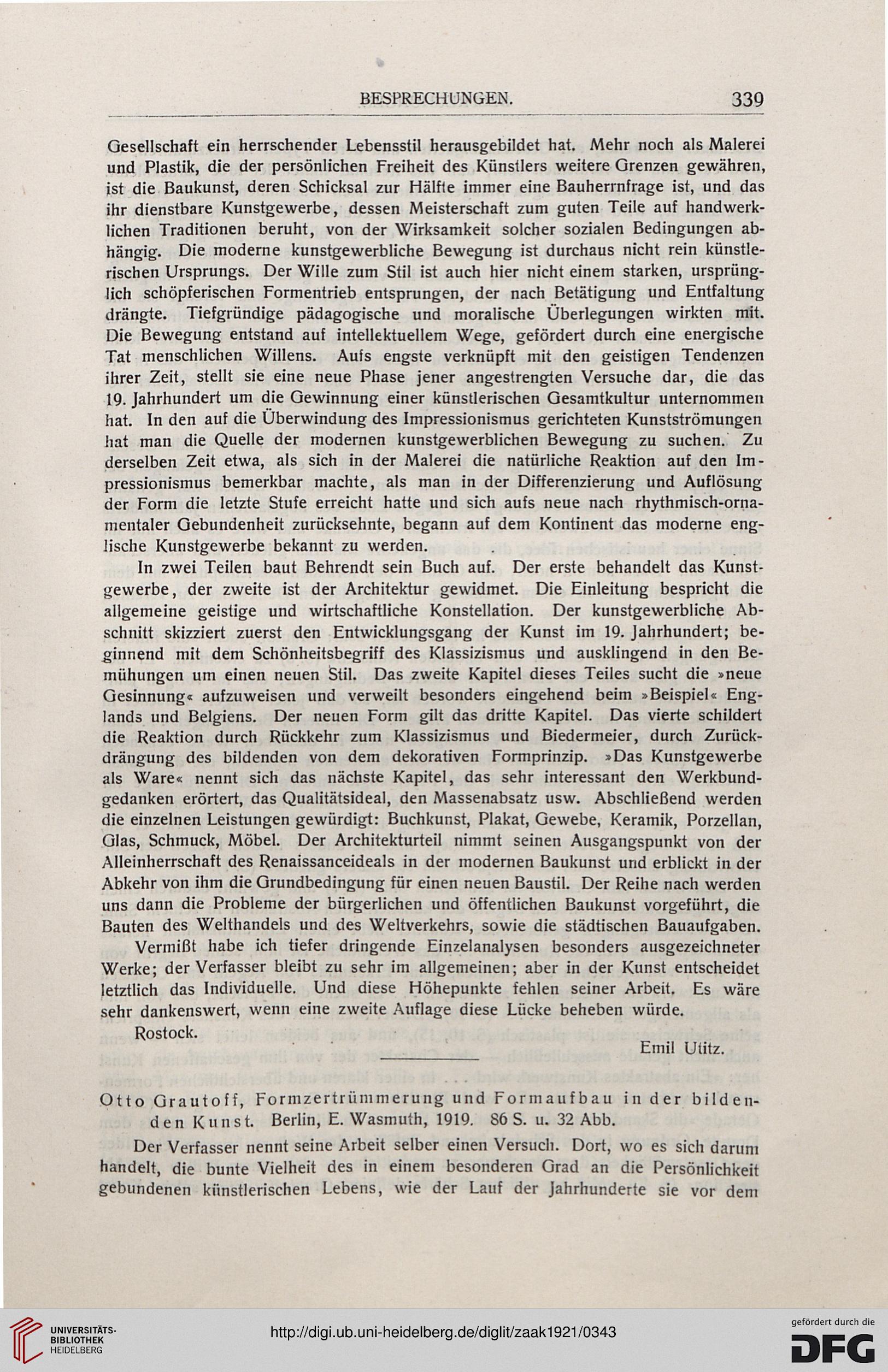BESPRECHUNGEN. 339
Gesellschaft ein herrschender Lebensstil herausgebildet hat. Mehr noch als Malerei
und Plastik, die der persönlichen Freiheit des Künstlers weitere Grenzen gewähren,
ist die Baukunst, deren Schicksal zur Hälfte immer eine Bauherrnfrage ist, und das
ihr dienstbare Kunstgewerbe, dessen Meisterschaft zum guten Teile auf handwerk-
lichen Traditionen beruht, von der Wirksamkeit solcher sozialen Bedingungen ab-
hängig. Die moderne kunstgewerbliche Bewegung ist durchaus nicht rein künstle-
rischen Ursprungs. Der Wille zum Stil ist auch hier nicht einem starken, ursprüng-
lich schöpferischen Formentrieb entsprungen, der nach Betätigung und Entfaltung
drängte. Tiefgründige pädagogische und moralische Überlegungen wirkten mit.
Die Bewegung entstand auf intellektuellem Wege, gefördert durch eine energische
Tat menschlichen Willens. Aufs engste verknüpft mit den geistigen Tendenzen
ihrer Zeit, stellt sie eine neue Phase jener angestrengten Versuche dar, die das
19. Jahrhundert um die Gewinnung einer künstlerischen Gesamtkultur unternommen
hat. In den auf die Überwindung des Impressionismus gerichteten Kunstströmungen
hat man die Quelle der modernen kunstgewerblichen Bewegung zu suchen. Zu
derselben Zeit etwa, als sich in der Malerei die natürliche Reaktion auf den Im-
pressionismus bemerkbar machte, als man in der Differenzierung und Auflösung
der Form die letzte Stufe erreicht hatte und sich aufs neue nach rhythmisch-orna-
mentaler Gebundenheit zurücksehnte, begann auf dem Kontinent das moderne eng-
lische Kunstgewerbe bekannt zu werden.
In zwei Teilen baut Behrendt sein Buch auf. Der erste behandelt das Kunst-
gewerbe, der zweite ist der Architektur gewidmet. Die Einleitung bespricht die
allgemeine geistige und wirtschaftliche Konstellation. Der kunstgewerbliche Ab-
schnitt skizziert zuerst den Entwicklungsgang der Kunst im 19. Jahrhundert; be-
ginnend mit dem Schönheitsbegriff des Klassizismus und ausklingend in den Be-
mühungen um einen neuen Stil. Das zweite Kapitel dieses Teiles sucht die »neue
Gesinnung« aufzuweisen und verweilt besonders eingehend beim »Beispiel« Eng-
lands und Belgiens. Der neuen Form gilt das dritte Kapitel. Das vierte schildert
die Reaktion durch Rückkehr zum Klassizismus und Biedermeier, durch Zurück-
drängung des bildenden von dem dekorativen Formprinzip. »Das Kunstgewerbe
als Ware« nennt sich das nächste Kapitel, das sehr interessant den Werkbund-
gedanken erörtert, das Qualitätsideal, den Massenabsatz usw. Abschließend werden
die einzelnen Leistungen gewürdigt: Buchkunst, Plakat, Gewebe, Keramik, Porzellan,
Glas, Schmuck, Möbel. Der Architekturteil nimmt seinen Ausgangspunkt von der
Alleinherrschaft des Renaissanceideals in der modernen Baukunst und erblickt in der
Abkehr von ihm die Grundbedingung für einen neuen Baustil. Der Reihe nach werden
uns dann die Probleme der bürgerlichen und öffentlichen Baukunst vorgeführt, die
Bauten des Welthandels und des Weltverkehrs, sowie die städtischen Bauaufgaben.
Vermißt habe ich tiefer dringende Einzelanalysen besonders ausgezeichneter
Werke; der Verfasser bleibt zu sehr im allgemeinen; aber in der Kunst entscheidet
letztlich das Individuelle. Und diese Höhepunkte fehlen seiner Arbeit. Es wäre
sehr dankenswert, wenn eine zweite Auflage diese Lücke beheben würde.
Rostock.
Emil Ulitz.
Otto Grautoff, Formzertrümmerung und Formaufbau in der bilden-
den Kunst. Berlin, E. Wasmuth, 1919. 86 S. u. 32 Abb.
Der Verfasser nennt seine Arbeit selber einen Versuch. Dort, wo es sich darum
handelt, die bunte Vielheit des in einem besonderen Grad an die Persönlichkeit
gebundenen künstlerischen Lebens, wie der Lauf der Jahrhunderte sie vor dem
Gesellschaft ein herrschender Lebensstil herausgebildet hat. Mehr noch als Malerei
und Plastik, die der persönlichen Freiheit des Künstlers weitere Grenzen gewähren,
ist die Baukunst, deren Schicksal zur Hälfte immer eine Bauherrnfrage ist, und das
ihr dienstbare Kunstgewerbe, dessen Meisterschaft zum guten Teile auf handwerk-
lichen Traditionen beruht, von der Wirksamkeit solcher sozialen Bedingungen ab-
hängig. Die moderne kunstgewerbliche Bewegung ist durchaus nicht rein künstle-
rischen Ursprungs. Der Wille zum Stil ist auch hier nicht einem starken, ursprüng-
lich schöpferischen Formentrieb entsprungen, der nach Betätigung und Entfaltung
drängte. Tiefgründige pädagogische und moralische Überlegungen wirkten mit.
Die Bewegung entstand auf intellektuellem Wege, gefördert durch eine energische
Tat menschlichen Willens. Aufs engste verknüpft mit den geistigen Tendenzen
ihrer Zeit, stellt sie eine neue Phase jener angestrengten Versuche dar, die das
19. Jahrhundert um die Gewinnung einer künstlerischen Gesamtkultur unternommen
hat. In den auf die Überwindung des Impressionismus gerichteten Kunstströmungen
hat man die Quelle der modernen kunstgewerblichen Bewegung zu suchen. Zu
derselben Zeit etwa, als sich in der Malerei die natürliche Reaktion auf den Im-
pressionismus bemerkbar machte, als man in der Differenzierung und Auflösung
der Form die letzte Stufe erreicht hatte und sich aufs neue nach rhythmisch-orna-
mentaler Gebundenheit zurücksehnte, begann auf dem Kontinent das moderne eng-
lische Kunstgewerbe bekannt zu werden.
In zwei Teilen baut Behrendt sein Buch auf. Der erste behandelt das Kunst-
gewerbe, der zweite ist der Architektur gewidmet. Die Einleitung bespricht die
allgemeine geistige und wirtschaftliche Konstellation. Der kunstgewerbliche Ab-
schnitt skizziert zuerst den Entwicklungsgang der Kunst im 19. Jahrhundert; be-
ginnend mit dem Schönheitsbegriff des Klassizismus und ausklingend in den Be-
mühungen um einen neuen Stil. Das zweite Kapitel dieses Teiles sucht die »neue
Gesinnung« aufzuweisen und verweilt besonders eingehend beim »Beispiel« Eng-
lands und Belgiens. Der neuen Form gilt das dritte Kapitel. Das vierte schildert
die Reaktion durch Rückkehr zum Klassizismus und Biedermeier, durch Zurück-
drängung des bildenden von dem dekorativen Formprinzip. »Das Kunstgewerbe
als Ware« nennt sich das nächste Kapitel, das sehr interessant den Werkbund-
gedanken erörtert, das Qualitätsideal, den Massenabsatz usw. Abschließend werden
die einzelnen Leistungen gewürdigt: Buchkunst, Plakat, Gewebe, Keramik, Porzellan,
Glas, Schmuck, Möbel. Der Architekturteil nimmt seinen Ausgangspunkt von der
Alleinherrschaft des Renaissanceideals in der modernen Baukunst und erblickt in der
Abkehr von ihm die Grundbedingung für einen neuen Baustil. Der Reihe nach werden
uns dann die Probleme der bürgerlichen und öffentlichen Baukunst vorgeführt, die
Bauten des Welthandels und des Weltverkehrs, sowie die städtischen Bauaufgaben.
Vermißt habe ich tiefer dringende Einzelanalysen besonders ausgezeichneter
Werke; der Verfasser bleibt zu sehr im allgemeinen; aber in der Kunst entscheidet
letztlich das Individuelle. Und diese Höhepunkte fehlen seiner Arbeit. Es wäre
sehr dankenswert, wenn eine zweite Auflage diese Lücke beheben würde.
Rostock.
Emil Ulitz.
Otto Grautoff, Formzertrümmerung und Formaufbau in der bilden-
den Kunst. Berlin, E. Wasmuth, 1919. 86 S. u. 32 Abb.
Der Verfasser nennt seine Arbeit selber einen Versuch. Dort, wo es sich darum
handelt, die bunte Vielheit des in einem besonderen Grad an die Persönlichkeit
gebundenen künstlerischen Lebens, wie der Lauf der Jahrhunderte sie vor dem