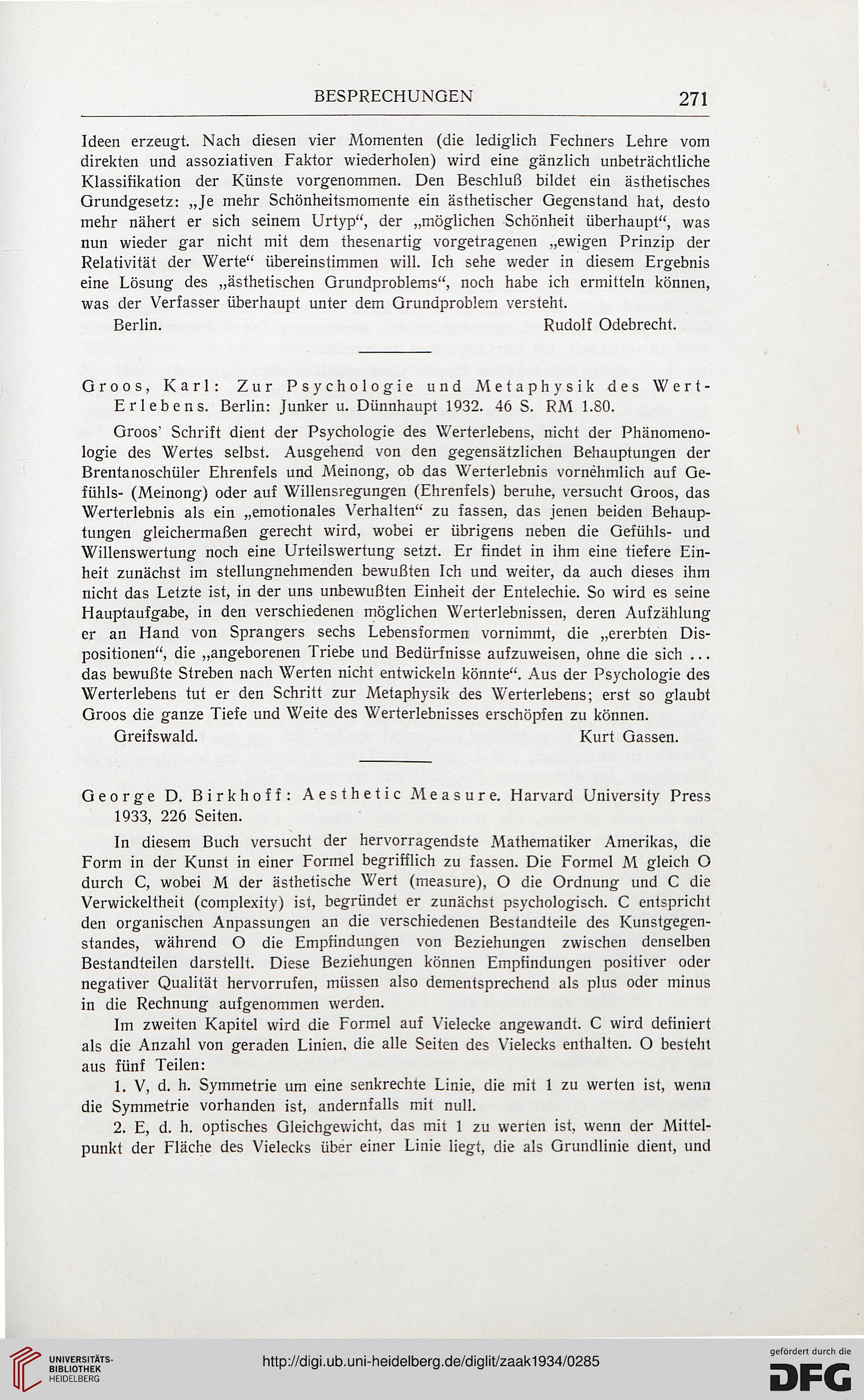BESPRECHUNGEN
271
Ideen erzeugt. Nach diesen vier Momenten (die lediglich Fechners Lehre vom
direkten und assoziativen Faktor wiederholen) wird eine gänzlich unbeträchtliche
Klassifikation der Künste vorgenommen. Den Beschluß bildet ein ästhetisches
Grundgesetz: „Je mehr Schönheitsmomente ein ästhetischer Gegenstand hat, desto
mehr nähert er sich seinem Urtyp", der „möglichen Schönheit überhaupt", was
nun wieder gar nicht mit dem thesenartig vorgetragenen „ewigen Prinzip der
Relativität der Werte" übereinstimmen will. Ich sehe weder in diesem Ergebnis
eine Lösung des „ästhetischen Grundproblems", noch habe ich ermitteln können,
was der Verfasser überhaupt unter dem Grundproblem versteht.
Berlin. Rudolf Odebrecht.
Gr oos, Karl: Zur Psychologie und Metaphysik des Wert-
Erlebens. Berlin: Junker u. Dünnhaupt 1932. 46 S. RM 1.80.
Groos' Schrift dient der Psychologie des Werterlebens, nicht der Phänomeno-
logie des Wertes selbst. Ausgehend von den gegensätzlichen Behauptungen der
Brentanoschüler Ehrenfels und Meinong, ob das Werterlebnis vornehmlich auf Ge-
fühls- (Meinong) oder auf Willensregungen (Ehrenfels) beruhe, versucht Groos, das
Werterlebnis als ein „emotionales Verhalten" zu fassen, das jenen beiden Behaup-
tungen gleichermaßen gerecht wird, wobei er übrigens neben die Gefühls- und
Willenswertung noch eine Urteilswertung setzt. Er findet in ihm eine tiefere Ein-
heit zunächst im stellungnehmenden bewußten Ich und weiter, da auch dieses ihm
nicht das Letzte ist, in der uns unbewußten Einheit der Entelechie. So wird es seine
Hauptaufgabe, in den verschiedenen möglichen Werterlebnissen, deren Aufzählung
er an Hand von Sprangers sechs Lebensformen vornimmt, die „ererbten Dis-
positionen", die „angeborenen Triebe und Bedürfnisse aufzuweisen, ohne die sich ...
das bewußte Streben nach Werten nicht entwickeln könnte". Aus der Psychologie des
Werterlebens tut er den Schritt zur Metaphysik des Werterlebens; erst so glaubt
Groos die ganze Tiefe und Weite des Werterlebnisses erschöpfen zu können.
Greifswald. Kurt Gassen.
George D. Birkhoff: Aesthetic Measure. Harvard University Press
1933, 226 Seiten.
In diesem Buch versucht der hervorragendste Mathematiker Amerikas, die
Form in der Kunst in einer Formel begrifflich zu fassen. Die Formel M gleich O
durch C, wobei M der ästhetische Wert (measure), O die Ordnung und C die
Verwickeltheit (complexity) ist, begründet er zunächst psychologisch. C entspricht
den organischen Anpassungen an die verschiedenen Bestandteile des Kunstgegen-
standes, während O die Empfindungen von Beziehungen zwischen denselben
Bestandteilen darstellt. Diese Beziehungen können Empfindungen positiver oder
negativer Qualität hervorrufen, müssen also dementsprechend als plus oder minus
in die Rechnung aufgenommen werden.
Im zweiten Kapitel wird die Formel auf Vielecke angewandt. C wird definiert
als die Anzahl von geraden Linien, die alle Seiten des Vielecks enthalten. O besteht
aus fünf Teilen:
1. V, d. h. Symmetrie um eine senkrechte Linie, die mit 1 zu werten ist, wenn
die Symmetrie vorhanden ist, andernfalls mit null.
2. E, d. h. optisches Gleichgewicht, das mit 1 zu werten ist, wenn der Mittel-
punkt der Fläche des Vielecks über einer Linie liegt, die als Grundlinie dient, und
271
Ideen erzeugt. Nach diesen vier Momenten (die lediglich Fechners Lehre vom
direkten und assoziativen Faktor wiederholen) wird eine gänzlich unbeträchtliche
Klassifikation der Künste vorgenommen. Den Beschluß bildet ein ästhetisches
Grundgesetz: „Je mehr Schönheitsmomente ein ästhetischer Gegenstand hat, desto
mehr nähert er sich seinem Urtyp", der „möglichen Schönheit überhaupt", was
nun wieder gar nicht mit dem thesenartig vorgetragenen „ewigen Prinzip der
Relativität der Werte" übereinstimmen will. Ich sehe weder in diesem Ergebnis
eine Lösung des „ästhetischen Grundproblems", noch habe ich ermitteln können,
was der Verfasser überhaupt unter dem Grundproblem versteht.
Berlin. Rudolf Odebrecht.
Gr oos, Karl: Zur Psychologie und Metaphysik des Wert-
Erlebens. Berlin: Junker u. Dünnhaupt 1932. 46 S. RM 1.80.
Groos' Schrift dient der Psychologie des Werterlebens, nicht der Phänomeno-
logie des Wertes selbst. Ausgehend von den gegensätzlichen Behauptungen der
Brentanoschüler Ehrenfels und Meinong, ob das Werterlebnis vornehmlich auf Ge-
fühls- (Meinong) oder auf Willensregungen (Ehrenfels) beruhe, versucht Groos, das
Werterlebnis als ein „emotionales Verhalten" zu fassen, das jenen beiden Behaup-
tungen gleichermaßen gerecht wird, wobei er übrigens neben die Gefühls- und
Willenswertung noch eine Urteilswertung setzt. Er findet in ihm eine tiefere Ein-
heit zunächst im stellungnehmenden bewußten Ich und weiter, da auch dieses ihm
nicht das Letzte ist, in der uns unbewußten Einheit der Entelechie. So wird es seine
Hauptaufgabe, in den verschiedenen möglichen Werterlebnissen, deren Aufzählung
er an Hand von Sprangers sechs Lebensformen vornimmt, die „ererbten Dis-
positionen", die „angeborenen Triebe und Bedürfnisse aufzuweisen, ohne die sich ...
das bewußte Streben nach Werten nicht entwickeln könnte". Aus der Psychologie des
Werterlebens tut er den Schritt zur Metaphysik des Werterlebens; erst so glaubt
Groos die ganze Tiefe und Weite des Werterlebnisses erschöpfen zu können.
Greifswald. Kurt Gassen.
George D. Birkhoff: Aesthetic Measure. Harvard University Press
1933, 226 Seiten.
In diesem Buch versucht der hervorragendste Mathematiker Amerikas, die
Form in der Kunst in einer Formel begrifflich zu fassen. Die Formel M gleich O
durch C, wobei M der ästhetische Wert (measure), O die Ordnung und C die
Verwickeltheit (complexity) ist, begründet er zunächst psychologisch. C entspricht
den organischen Anpassungen an die verschiedenen Bestandteile des Kunstgegen-
standes, während O die Empfindungen von Beziehungen zwischen denselben
Bestandteilen darstellt. Diese Beziehungen können Empfindungen positiver oder
negativer Qualität hervorrufen, müssen also dementsprechend als plus oder minus
in die Rechnung aufgenommen werden.
Im zweiten Kapitel wird die Formel auf Vielecke angewandt. C wird definiert
als die Anzahl von geraden Linien, die alle Seiten des Vielecks enthalten. O besteht
aus fünf Teilen:
1. V, d. h. Symmetrie um eine senkrechte Linie, die mit 1 zu werten ist, wenn
die Symmetrie vorhanden ist, andernfalls mit null.
2. E, d. h. optisches Gleichgewicht, das mit 1 zu werten ist, wenn der Mittel-
punkt der Fläche des Vielecks über einer Linie liegt, die als Grundlinie dient, und