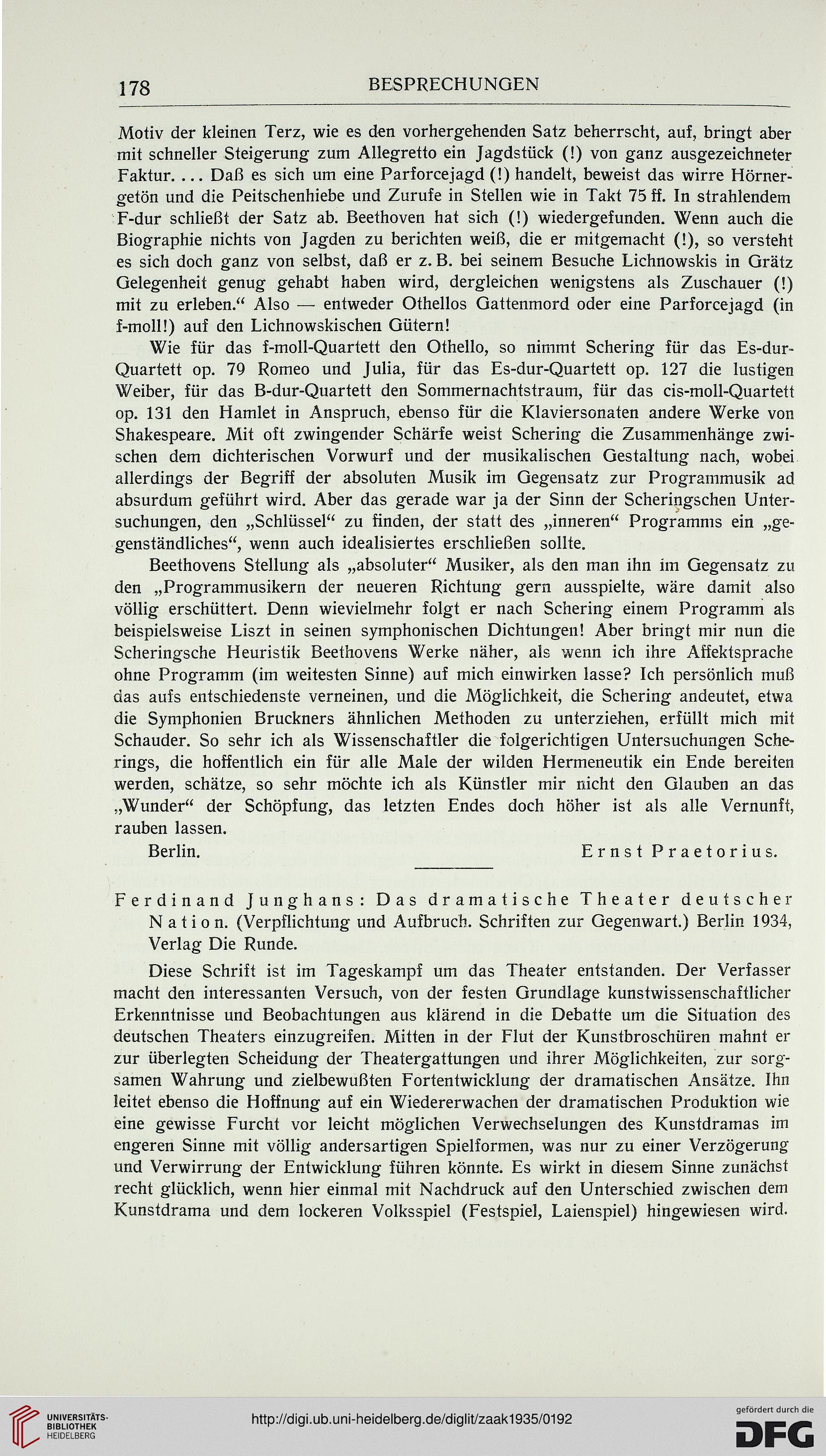178
BESPRECHUNGEN
Motiv der kleinen Terz, wie es den vorhergehenden Satz beherrscht, auf, bringt aber
mit schneller Steigerung zum Allegretto ein Jagdstück (!) von ganz ausgezeichneter
Faktur. ... Daß es sich um eine Parforcejagd (!) handelt, beweist das wirre Hörner-
getön und die Peitschenhiebe und Zurufe in Stellen wie in Takt 75 ff. In strahlendem
F-dur schließt der Satz ab. Beethoven hat sich (!) wiedergefunden. Wenn auch die
Biographie nichts von Jagden zu berichten weiß, die er mitgemacht (!), so versteht
es sich doch ganz von selbst, daß er z. B. bei seinem Besuche Lichnowskis in Grätz
Gelegenheit genug gehabt haben wird, dergleichen wenigstens als Zuschauer (!)
mit zu erleben." Also — entweder Othellos Gattenmord oder eine Parforcejagd (in
f-moll!) auf den Lichnowskischen Gütern!
Wie für das f-moll-Quartett den Othello, so nimmt Schering für das Es-dur-
Quartett op. 79 Romeo und Julia, für das Es-dur-Quartett op. 127 die lustigen
Weiber, für das B-dur-Quartett den Sommernachtstraum, für das cis-moll-Quartett
op. 131 den Hamlet in Anspruch, ebenso für die Klaviersonaten andere Werke von
Shakespeare. Mit oft zwingender Schärfe weist Schering die Zusammenhänge zwi-
schen dem dichterischen Vorwurf und der musikalischen Gestaltung nach, wobei
allerdings der Begriff der absoluten Musik im Gegensatz zur Programmusik ad
absurdum geführt wird. Aber das gerade war ja der Sinn der Scheringschen Unter-
suchungen, den „Schlüssel" zu finden, der statt des „inneren" Programms ein „ge-
genständliches", wenn auch idealisiertes erschließen sollte.
Beethovens Stellung als „absoluter" Musiker, als den man ihn im Gegensatz zu
den „Programmusikern der neueren Richtung gern ausspielte, wäre damit also
völlig erschüttert. Denn wievielmehr folgt er nach Schering einem Programm als
beispielsweise Liszt in seinen symphonischen Dichtungen! Aber bringt mir nun die
Scheringsche Heuristik Beethovens Werke näher, als wenn ich ihre Affektsprache
ohne Programm (im weitesten Sinne) auf mich einwirken lasse? Ich persönlich muß
das aufs entschiedenste verneinen, und die Möglichkeit, die Schering andeutet, etwa
die Symphonien Bruckners ähnlichen Methoden zu unterziehen, erfüllt mich mit
Schauder. So sehr ich als Wissenschaftler die folgerichtigen Untersuchungen Sche-
rings, die hoffentlich ein für alle Male der wilden Hermeneutik ein Ende bereiten
werden, schätze, so sehr möchte ich als Künstler mir nicht den Glauben an das
„Wunder" der Schöpfung, das letzten Endes doch höher ist als alle Vernunft,
rauben lassen.
Berlin. Ernst Praetorius.
Ferdinand Junghans: Das dramatische Theater deutscher
Nation. (Verpflichtung und Aufbruch. Schriften zur Gegenwart.) Berlin 1934,
Verlag Die Runde.
Diese Schrift ist im Tageskampf um das Theater entstanden. Der Verfasser
macht den interessanten Versuch, von der festen Grundlage kunstwissenschaftlicher
Erkenntnisse und Beobachtungen aus klärend in die Debatte um die Situation des
deutschen Theaters einzugreifen. Mitten in der Flut der Kunstbroschüren mahnt er
zur überlegten Scheidung der Theatergattungen und ihrer Möglichkeiten, zur sorg-
samen Wahrung und zielbewußten Fortentwicklung der dramatischen Ansätze. Ihn
leitet ebenso die Hoffnung auf ein Wiedererwachen der dramatischen Produktion wie
eine gewisse Furcht vor leicht möglichen Verwechselungen des Kunstdramas im
engeren Sinne mit völlig andersartigen Spielformen, was nur zu einer Verzögerung
und Verwirrung der Entwicklung führen könnte. Es wirkt in diesem Sinne zunächst
recht glücklich, wenn hier einmal mit Nachdruck auf den Unterschied zwischen dem
Kunstdrama und dem lockeren Volksspiel (Festspiel, Laienspiel) hingewiesen wird.
BESPRECHUNGEN
Motiv der kleinen Terz, wie es den vorhergehenden Satz beherrscht, auf, bringt aber
mit schneller Steigerung zum Allegretto ein Jagdstück (!) von ganz ausgezeichneter
Faktur. ... Daß es sich um eine Parforcejagd (!) handelt, beweist das wirre Hörner-
getön und die Peitschenhiebe und Zurufe in Stellen wie in Takt 75 ff. In strahlendem
F-dur schließt der Satz ab. Beethoven hat sich (!) wiedergefunden. Wenn auch die
Biographie nichts von Jagden zu berichten weiß, die er mitgemacht (!), so versteht
es sich doch ganz von selbst, daß er z. B. bei seinem Besuche Lichnowskis in Grätz
Gelegenheit genug gehabt haben wird, dergleichen wenigstens als Zuschauer (!)
mit zu erleben." Also — entweder Othellos Gattenmord oder eine Parforcejagd (in
f-moll!) auf den Lichnowskischen Gütern!
Wie für das f-moll-Quartett den Othello, so nimmt Schering für das Es-dur-
Quartett op. 79 Romeo und Julia, für das Es-dur-Quartett op. 127 die lustigen
Weiber, für das B-dur-Quartett den Sommernachtstraum, für das cis-moll-Quartett
op. 131 den Hamlet in Anspruch, ebenso für die Klaviersonaten andere Werke von
Shakespeare. Mit oft zwingender Schärfe weist Schering die Zusammenhänge zwi-
schen dem dichterischen Vorwurf und der musikalischen Gestaltung nach, wobei
allerdings der Begriff der absoluten Musik im Gegensatz zur Programmusik ad
absurdum geführt wird. Aber das gerade war ja der Sinn der Scheringschen Unter-
suchungen, den „Schlüssel" zu finden, der statt des „inneren" Programms ein „ge-
genständliches", wenn auch idealisiertes erschließen sollte.
Beethovens Stellung als „absoluter" Musiker, als den man ihn im Gegensatz zu
den „Programmusikern der neueren Richtung gern ausspielte, wäre damit also
völlig erschüttert. Denn wievielmehr folgt er nach Schering einem Programm als
beispielsweise Liszt in seinen symphonischen Dichtungen! Aber bringt mir nun die
Scheringsche Heuristik Beethovens Werke näher, als wenn ich ihre Affektsprache
ohne Programm (im weitesten Sinne) auf mich einwirken lasse? Ich persönlich muß
das aufs entschiedenste verneinen, und die Möglichkeit, die Schering andeutet, etwa
die Symphonien Bruckners ähnlichen Methoden zu unterziehen, erfüllt mich mit
Schauder. So sehr ich als Wissenschaftler die folgerichtigen Untersuchungen Sche-
rings, die hoffentlich ein für alle Male der wilden Hermeneutik ein Ende bereiten
werden, schätze, so sehr möchte ich als Künstler mir nicht den Glauben an das
„Wunder" der Schöpfung, das letzten Endes doch höher ist als alle Vernunft,
rauben lassen.
Berlin. Ernst Praetorius.
Ferdinand Junghans: Das dramatische Theater deutscher
Nation. (Verpflichtung und Aufbruch. Schriften zur Gegenwart.) Berlin 1934,
Verlag Die Runde.
Diese Schrift ist im Tageskampf um das Theater entstanden. Der Verfasser
macht den interessanten Versuch, von der festen Grundlage kunstwissenschaftlicher
Erkenntnisse und Beobachtungen aus klärend in die Debatte um die Situation des
deutschen Theaters einzugreifen. Mitten in der Flut der Kunstbroschüren mahnt er
zur überlegten Scheidung der Theatergattungen und ihrer Möglichkeiten, zur sorg-
samen Wahrung und zielbewußten Fortentwicklung der dramatischen Ansätze. Ihn
leitet ebenso die Hoffnung auf ein Wiedererwachen der dramatischen Produktion wie
eine gewisse Furcht vor leicht möglichen Verwechselungen des Kunstdramas im
engeren Sinne mit völlig andersartigen Spielformen, was nur zu einer Verzögerung
und Verwirrung der Entwicklung führen könnte. Es wirkt in diesem Sinne zunächst
recht glücklich, wenn hier einmal mit Nachdruck auf den Unterschied zwischen dem
Kunstdrama und dem lockeren Volksspiel (Festspiel, Laienspiel) hingewiesen wird.