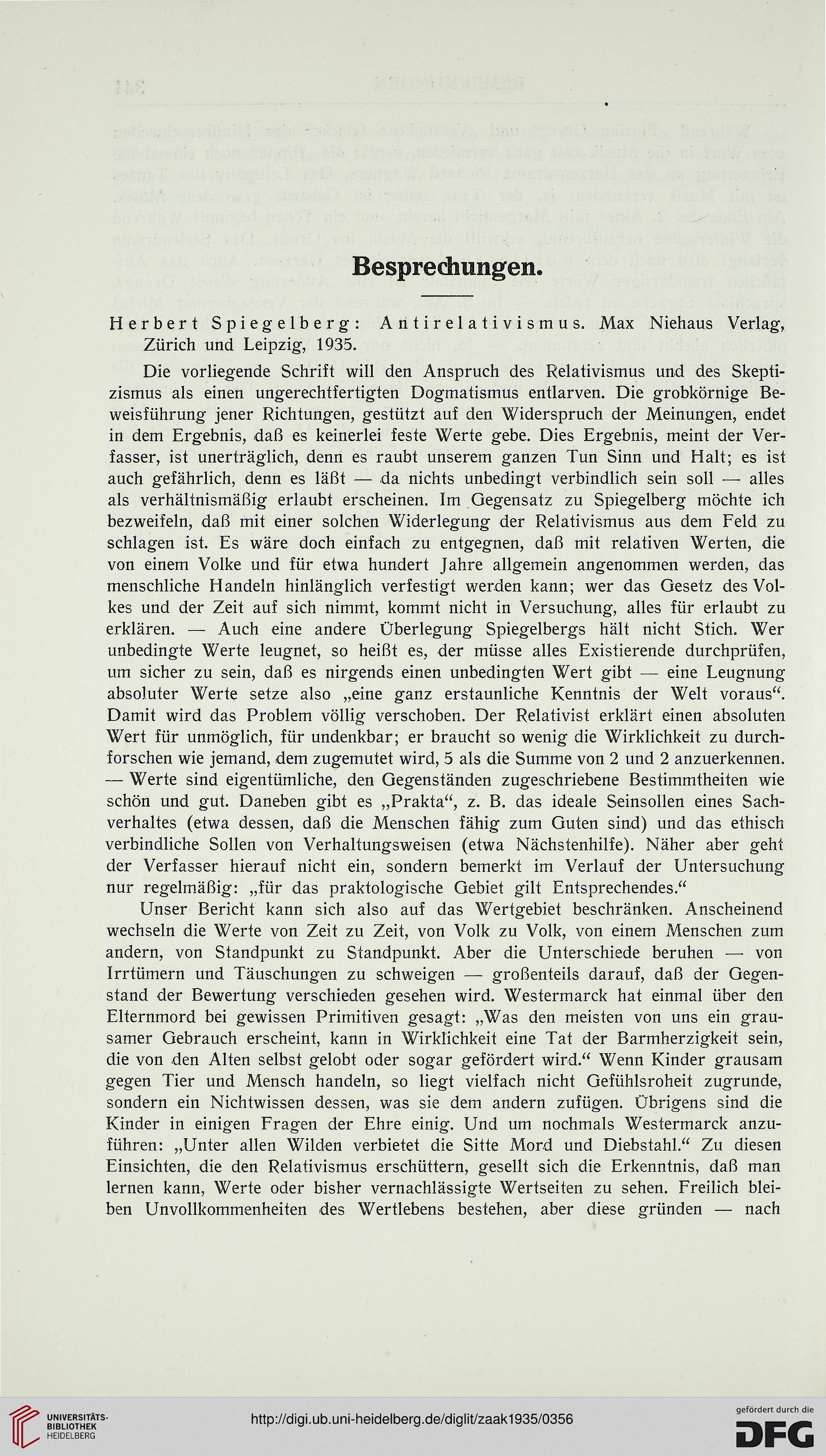Besprechungen.
Herbert Spiegelberg: Antirelativismus. Max Niehaus Verlag,
Zürich und Leipzig, 1935.
Die vorliegende Schrift will den Anspruch des Relativismus und des Skepti-
zismus als einen ungerechtfertigten Dogmatismus entlarven. Die grobkörnige Be-
weisführung jener Richtungen, gestützt auf den Widerspruch der Meinungen, endet
in dem Ergebnis, daß es keinerlei feste Werte gebe. Dies Ergebnis, meint der Ver-
fasser, ist unerträglich, denn es raubt unserem ganzen Tun Sinn und Halt; es ist
auch gefährlich, denn es läßt — da nichts unbedingt verbindlich sein soll — alles
als verhältnismäßig erlaubt erscheinen. Im Gegensatz zu Spiegelberg möchte ich
bezweifeln, daß mit einer solchen Widerlegung der Relativismus aus dem Feld zu
schlagen ist. Es wäre doch einfach zu entgegnen, daß mit relativen Werten, die
von einem Volke und für etwa hundert Jahre allgemein angenommen werden, das
menschliche Handeln hinlänglich verfestigt werden kann; wer das Gesetz des Vol-
kes und der Zeit auf sich nimmt, kommt nicht in Versuchung, alles für erlaubt zu
erklären. — Auch eine andere Überlegung Spiegelbergs hält nicht Stich. Wer
unbedingte Werte leugnet, so heißt es, der müsse alles Existierende durchprüfen,
um sicher zu sein, daß es nirgends einen unbedingten Wert gibt — eine Leugnung
absoluter Werte setze also „eine ganz erstaunliche Kenntnis der Welt voraus".
Damit wird das Problem völlig verschoben. Der Relativist erklärt einen absoluten
Wert für unmöglich, für undenkbar; er braucht so wenig die Wirklichkeit zu durch-
forschen wie jemand, dem zugemutet wird, 5 als die Summe von 2 und 2 anzuerkennen.
— Werte sind eigentümliche, den Gegenständen zugeschriebene Bestimmtheiten wie
schön und gut. Daneben gibt es „Prakta", z. B. das ideale Seinsollen eines Sach-
verhaltes (etwa dessen, daß die Menschen fähig zum Guten sind) und das ethisch
verbindliche Sollen von Verhaltungsweisen (etwa Nächstenhilfe). Näher aber geht
der Verfasser hierauf nicht ein, sondern bemerkt im Verlauf der Untersuchung
nur regelmäßig: „für das praktologische Gebiet gilt Entsprechendes."
Unser Bericht kann sich also auf das Wertgebiet beschränken. Anscheinend
wechseln die Werte von Zeit zu Zeit, von Volk zu Volk, von einem Menschen zum
andern, von Standpunkt zu Standpunkt. Aber die Unterschiede beruhen — von
Irrtümern und Täuschungen zu schweigen — großenteils darauf, daß der Gegen-
stand der Bewertung verschieden gesehen wird. Westermarck hat einmal über den
Elternmord bei gewissen Primitiven gesagt: „Was den meisten von uns ein grau-
samer Gebrauch erscheint, kann in Wirklichkeit eine Tat der Barmherzigkeit sein,
die von den Alten selbst gelobt oder sogar gefördert wird." Wenn Kinder grausam
gegen Tier und Mensch handeln, so liegt vielfach nicht Gefühlsroheit zugrunde,
sondern ein Nichtwissen dessen, was sie dem andern zufügen. Übrigens sind die
Kinder in einigen Fragen der Ehre einig. Und um nochmals Westermarck anzu-
führen: „Unter allen Wilden verbietet die Sitte Mord und Diebstahl." Zu diesen
Einsichten, die den Relativismus erschüttern, gesellt sich die Erkenntnis, daß man
lernen kann, Werte oder bisher vernachlässigte Wertseiten zu sehen. Freilich blei-
ben Unvollkommenheiten des Wertlebens bestehen, aber diese gründen — nach
Herbert Spiegelberg: Antirelativismus. Max Niehaus Verlag,
Zürich und Leipzig, 1935.
Die vorliegende Schrift will den Anspruch des Relativismus und des Skepti-
zismus als einen ungerechtfertigten Dogmatismus entlarven. Die grobkörnige Be-
weisführung jener Richtungen, gestützt auf den Widerspruch der Meinungen, endet
in dem Ergebnis, daß es keinerlei feste Werte gebe. Dies Ergebnis, meint der Ver-
fasser, ist unerträglich, denn es raubt unserem ganzen Tun Sinn und Halt; es ist
auch gefährlich, denn es läßt — da nichts unbedingt verbindlich sein soll — alles
als verhältnismäßig erlaubt erscheinen. Im Gegensatz zu Spiegelberg möchte ich
bezweifeln, daß mit einer solchen Widerlegung der Relativismus aus dem Feld zu
schlagen ist. Es wäre doch einfach zu entgegnen, daß mit relativen Werten, die
von einem Volke und für etwa hundert Jahre allgemein angenommen werden, das
menschliche Handeln hinlänglich verfestigt werden kann; wer das Gesetz des Vol-
kes und der Zeit auf sich nimmt, kommt nicht in Versuchung, alles für erlaubt zu
erklären. — Auch eine andere Überlegung Spiegelbergs hält nicht Stich. Wer
unbedingte Werte leugnet, so heißt es, der müsse alles Existierende durchprüfen,
um sicher zu sein, daß es nirgends einen unbedingten Wert gibt — eine Leugnung
absoluter Werte setze also „eine ganz erstaunliche Kenntnis der Welt voraus".
Damit wird das Problem völlig verschoben. Der Relativist erklärt einen absoluten
Wert für unmöglich, für undenkbar; er braucht so wenig die Wirklichkeit zu durch-
forschen wie jemand, dem zugemutet wird, 5 als die Summe von 2 und 2 anzuerkennen.
— Werte sind eigentümliche, den Gegenständen zugeschriebene Bestimmtheiten wie
schön und gut. Daneben gibt es „Prakta", z. B. das ideale Seinsollen eines Sach-
verhaltes (etwa dessen, daß die Menschen fähig zum Guten sind) und das ethisch
verbindliche Sollen von Verhaltungsweisen (etwa Nächstenhilfe). Näher aber geht
der Verfasser hierauf nicht ein, sondern bemerkt im Verlauf der Untersuchung
nur regelmäßig: „für das praktologische Gebiet gilt Entsprechendes."
Unser Bericht kann sich also auf das Wertgebiet beschränken. Anscheinend
wechseln die Werte von Zeit zu Zeit, von Volk zu Volk, von einem Menschen zum
andern, von Standpunkt zu Standpunkt. Aber die Unterschiede beruhen — von
Irrtümern und Täuschungen zu schweigen — großenteils darauf, daß der Gegen-
stand der Bewertung verschieden gesehen wird. Westermarck hat einmal über den
Elternmord bei gewissen Primitiven gesagt: „Was den meisten von uns ein grau-
samer Gebrauch erscheint, kann in Wirklichkeit eine Tat der Barmherzigkeit sein,
die von den Alten selbst gelobt oder sogar gefördert wird." Wenn Kinder grausam
gegen Tier und Mensch handeln, so liegt vielfach nicht Gefühlsroheit zugrunde,
sondern ein Nichtwissen dessen, was sie dem andern zufügen. Übrigens sind die
Kinder in einigen Fragen der Ehre einig. Und um nochmals Westermarck anzu-
führen: „Unter allen Wilden verbietet die Sitte Mord und Diebstahl." Zu diesen
Einsichten, die den Relativismus erschüttern, gesellt sich die Erkenntnis, daß man
lernen kann, Werte oder bisher vernachlässigte Wertseiten zu sehen. Freilich blei-
ben Unvollkommenheiten des Wertlebens bestehen, aber diese gründen — nach