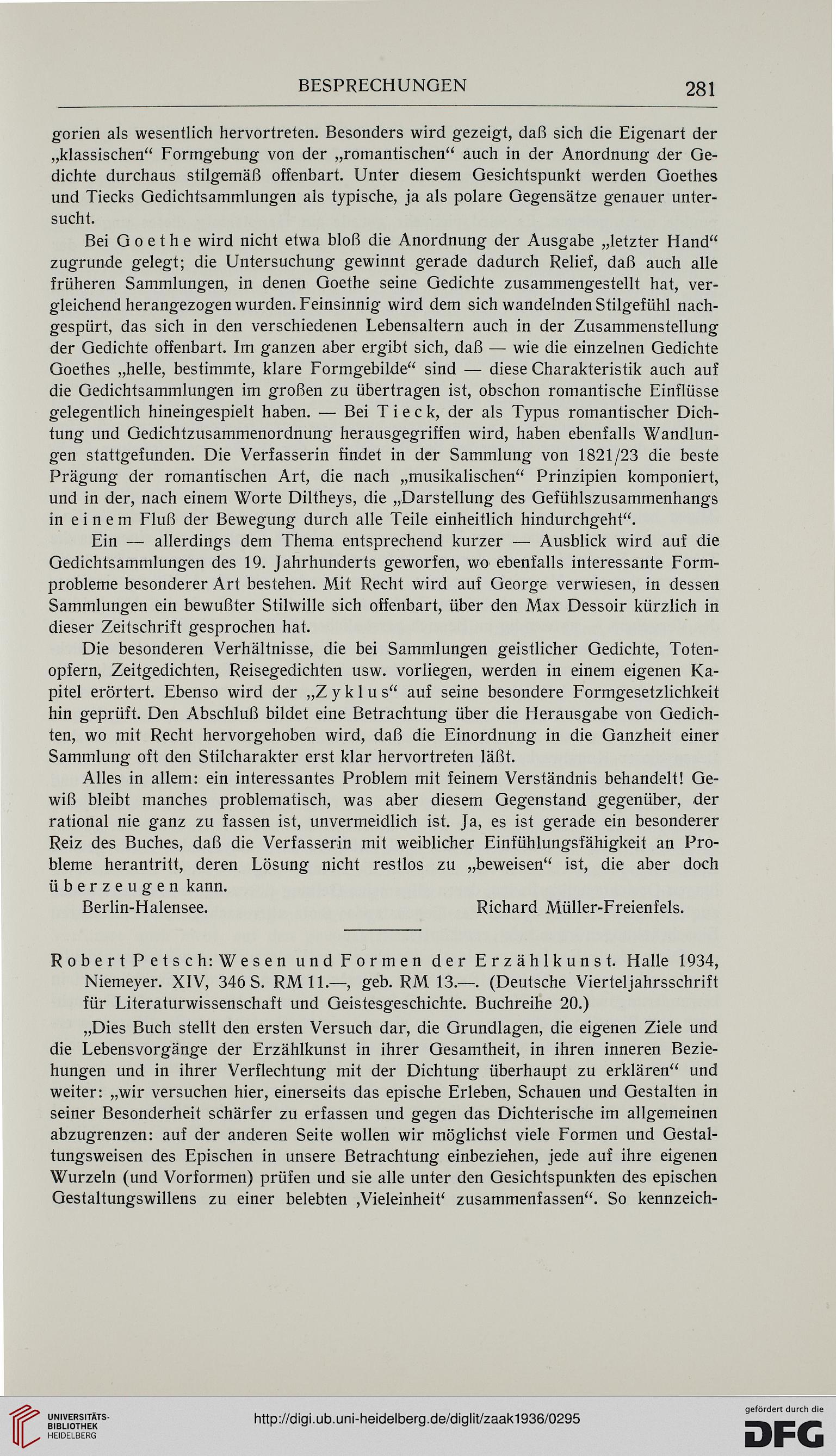gorien als wesentlich hervortreten. Besonders wird gezeigt, daß sich die Eigenart der
„klassischen" Formgebung von der „romantischen" auch in der Anordnung der Ge-
dichte durchaus stilgemäß offenbart. Unter diesem Gesichtspunkt werden Goethes
und Tiecks Gedichtsammlungen als typische, ja als polare Gegensätze genauer unter-
sucht.
Bei Goethe wird nicht etwa bloß die Anordnung der Ausgabe „letzter Hand"
zugrunde gelegt; die Untersuchung gewinnt gerade dadurch Relief, daß auch alle
früheren Sammlungen, in denen Goethe seine Gedichte zusammengestellt hat, ver-
gleichend herangezogen wurden. Feinsinnig wird dem sich wandelnden Stilgefühl nach-
gespürt, das sich in den verschiedenen Lebensaltern auch in der Zusammenstellung
der Gedichte offenbart. Im ganzen aber ergibt sich, daß — wie die einzelnen Gedichte
Goethes „helle, bestimmte, klare Formgebilde" sind — diese Charakteristik auch auf
die Gedichtsammlungen im großen zu übertragen ist, obschon romantische Einflüsse
gelegentlich hineingespielt haben. — Bei T i e c k, der als Typus romantischer Dich-
tung und Gedichtzusammenordnung herausgegriffen wird, haben ebenfalls Wandlun-
gen stattgefunden. Die Verfasserin findet in der Sammlung von 1821/23 die beste
Prägung der romantischen Art, die nach „musikalischen" Prinzipien komponiert,
und in der, nach einem Worte Diltheys, die „Darstellung des Gefühlszusammenhangs
in einem Fluß der Bewegung durch alle Teile einheitlich hindurchgeht".
Ein —■ allerdings dem Thema entsprechend kurzer — Ausblick wird auf die
Gedichtsammlungen des 19. Jahrhunderts geworfen, wo ebenfalls interessante Form-
probleme besonderer Art bestehen. Mit Recht wird auf George verwiesen, in dessen
Sammlungen ein bewußter Stilwille sich offenbart, über den Max Dessoir kürzlich in
dieser Zeitschrift gesprochen hat.
Die besonderen Verhältnisse, die bei Sammlungen geistlicher Gedichte, Toten-
opfern, Zeitgedichten, Reisegedichten usw. vorliegen, werden in einem eigenen Ka-
pitel erörtert. Ebenso wird der „Z y k 1 u s" auf seine besondere Formgesetzlichkeit
hin geprüft. Den Abschluß bildet eine Betrachtung über die Herausgabe von Gedich-
ten, wo mit Recht hervorgehoben wird, daß die Einordnung in die Ganzheit einer
Sammlung oft den Stilcharakter erst klar hervortreten läßt.
Alles in allem: ein interessantes Problem mit feinem Verständnis behandelt! Ge-
wiß bleibt manches problematisch, was aber diesem Gegenstand gegenüber, der
rational nie ganz zu fassen ist, unvermeidlich ist. Ja, es ist gerade ein besonderer
Reiz des Buches, daß die Verfasserin mit weiblicher Einfühlungsfähigkeit an Pro-
bleme herantritt, deren Lösung nicht restlos zu „beweisen" ist, die aber doch
überzeugen kann.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Robert Petsch: Wesen und Formen der Erzählkunst. Halle 1934,
Niemeyer. XIV, 346 S. RM11.—, geb. RM 13.—. (Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe 20.)
„Dies Buch stellt den ersten Versuch dar, die Grundlagen, die eigenen Ziele und
die Lebensvorgänge der Erzählkunst in ihrer Gesamtheit, in ihren inneren Bezie-
hungen und in ihrer Verflechtung mit der Dichtung überhaupt zu erklären" und
weiter: „wir versuchen hier, einerseits das epische Erleben, Schauen und Gestalten in
seiner Besonderheit schärfer zu erfassen und gegen das Dichterische im allgemeinen
abzugrenzen: auf der anderen Seite wollen wir möglichst viele Formen und Gestal-
tungsweisen des Epischen in unsere Betrachtung einbeziehen, jede auf ihre eigenen
Wurzeln (und Vorformen) prüfen und sie alle unter den Gesichtspunkten des epischen
Gestaltungswillens zu einer belebten , Vieleinheit' zusammenfassen". So kennzeich-
„klassischen" Formgebung von der „romantischen" auch in der Anordnung der Ge-
dichte durchaus stilgemäß offenbart. Unter diesem Gesichtspunkt werden Goethes
und Tiecks Gedichtsammlungen als typische, ja als polare Gegensätze genauer unter-
sucht.
Bei Goethe wird nicht etwa bloß die Anordnung der Ausgabe „letzter Hand"
zugrunde gelegt; die Untersuchung gewinnt gerade dadurch Relief, daß auch alle
früheren Sammlungen, in denen Goethe seine Gedichte zusammengestellt hat, ver-
gleichend herangezogen wurden. Feinsinnig wird dem sich wandelnden Stilgefühl nach-
gespürt, das sich in den verschiedenen Lebensaltern auch in der Zusammenstellung
der Gedichte offenbart. Im ganzen aber ergibt sich, daß — wie die einzelnen Gedichte
Goethes „helle, bestimmte, klare Formgebilde" sind — diese Charakteristik auch auf
die Gedichtsammlungen im großen zu übertragen ist, obschon romantische Einflüsse
gelegentlich hineingespielt haben. — Bei T i e c k, der als Typus romantischer Dich-
tung und Gedichtzusammenordnung herausgegriffen wird, haben ebenfalls Wandlun-
gen stattgefunden. Die Verfasserin findet in der Sammlung von 1821/23 die beste
Prägung der romantischen Art, die nach „musikalischen" Prinzipien komponiert,
und in der, nach einem Worte Diltheys, die „Darstellung des Gefühlszusammenhangs
in einem Fluß der Bewegung durch alle Teile einheitlich hindurchgeht".
Ein —■ allerdings dem Thema entsprechend kurzer — Ausblick wird auf die
Gedichtsammlungen des 19. Jahrhunderts geworfen, wo ebenfalls interessante Form-
probleme besonderer Art bestehen. Mit Recht wird auf George verwiesen, in dessen
Sammlungen ein bewußter Stilwille sich offenbart, über den Max Dessoir kürzlich in
dieser Zeitschrift gesprochen hat.
Die besonderen Verhältnisse, die bei Sammlungen geistlicher Gedichte, Toten-
opfern, Zeitgedichten, Reisegedichten usw. vorliegen, werden in einem eigenen Ka-
pitel erörtert. Ebenso wird der „Z y k 1 u s" auf seine besondere Formgesetzlichkeit
hin geprüft. Den Abschluß bildet eine Betrachtung über die Herausgabe von Gedich-
ten, wo mit Recht hervorgehoben wird, daß die Einordnung in die Ganzheit einer
Sammlung oft den Stilcharakter erst klar hervortreten läßt.
Alles in allem: ein interessantes Problem mit feinem Verständnis behandelt! Ge-
wiß bleibt manches problematisch, was aber diesem Gegenstand gegenüber, der
rational nie ganz zu fassen ist, unvermeidlich ist. Ja, es ist gerade ein besonderer
Reiz des Buches, daß die Verfasserin mit weiblicher Einfühlungsfähigkeit an Pro-
bleme herantritt, deren Lösung nicht restlos zu „beweisen" ist, die aber doch
überzeugen kann.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Robert Petsch: Wesen und Formen der Erzählkunst. Halle 1934,
Niemeyer. XIV, 346 S. RM11.—, geb. RM 13.—. (Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe 20.)
„Dies Buch stellt den ersten Versuch dar, die Grundlagen, die eigenen Ziele und
die Lebensvorgänge der Erzählkunst in ihrer Gesamtheit, in ihren inneren Bezie-
hungen und in ihrer Verflechtung mit der Dichtung überhaupt zu erklären" und
weiter: „wir versuchen hier, einerseits das epische Erleben, Schauen und Gestalten in
seiner Besonderheit schärfer zu erfassen und gegen das Dichterische im allgemeinen
abzugrenzen: auf der anderen Seite wollen wir möglichst viele Formen und Gestal-
tungsweisen des Epischen in unsere Betrachtung einbeziehen, jede auf ihre eigenen
Wurzeln (und Vorformen) prüfen und sie alle unter den Gesichtspunkten des epischen
Gestaltungswillens zu einer belebten , Vieleinheit' zusammenfassen". So kennzeich-