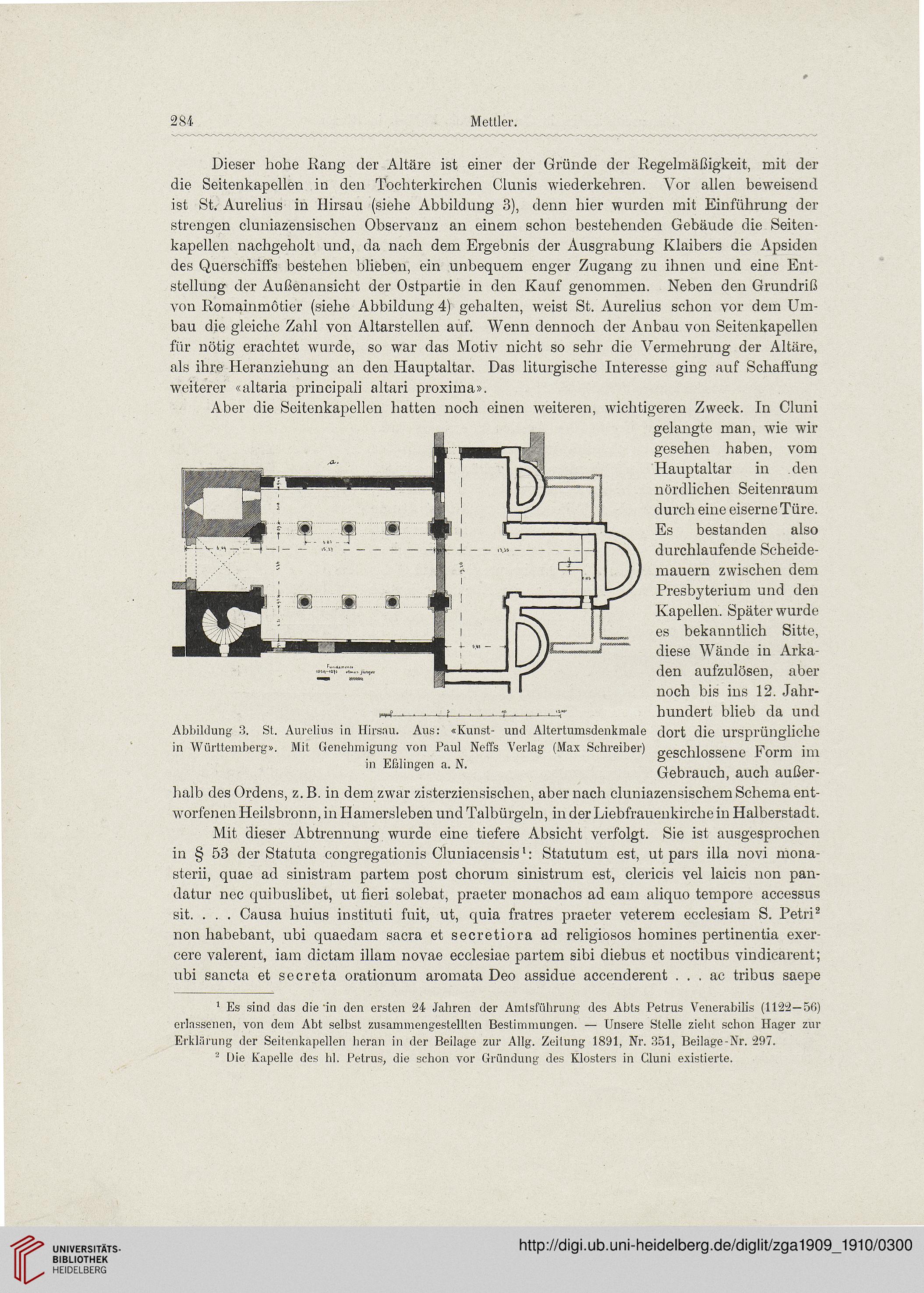284 Mettie
Dieser hohe Rang der Altäre ist einer der Gründe der Kegelmäßigkeit, mit der
die Seitenkapellen in den Tochterkirchen Clunis wiederkehren. Vor allen beweisend
ist St. Aurelius in Hirsau (siehe Abbildung 3), denn hier wurden mit Einführung der
strengen cluniazensischen Observanz an einem schon bestehenden Gebäude die Seiten-
kapellen nachgeholt und, da nach dem Ergebnis der Ausgrabung Klaibers die Apsiden
des Querschiffs bestehen blieben, ein unbequem enger Zugang zu ihnen und eine Ent-
stellung der Außenansicht der Ostpartie in den Kauf genommen. Neben den Grundriß
von Romainmötier (siehe Abbildung 4) gehalten, weist St. Aurelius schon vor dem Um-
bau die gleiche Zahl von Altarstellen auf. Wenn dennoch der Anbau von Seitenkapellen
für nötig erachtet wurde, so war das Motiv nicht so sehr die Vermehrung der Altäre,
als ihre Heranziehung an den Hauptaltar. Das liturgische Interesse ging auf Schaffung
weiterer «altaria principali altari proxima».
Aber die Seitenkapellen hatten noch einen weiteren, wichtigeren Zweck. In Cluni
gelangte man, wie wir
gesehen haben, vom
Hauptaltar in den
nördlichen Seitenraum
durch eine eiserne Türe.
^ Es bestanden also
"X\ durchlaufende Scheide-
)) mauern zwischen dem
Presbyterium und den
Kapellen. Später wurde
es bekanntlich Sitte,
_ (jjggg Wände in Arka-
den aufzulösen, aber
noch bis ius 12. Jahr-
hundert blieb da und
Abbildung 3. St. Aurelius in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale dort die ursprüngliche
in Württemberg». Mit Genehmigung von Paul Neffs Verlag (Max Schreiber) geschlossene Form im
in Eßlingen a. N. ^ , , , n
Gebrauch, auch außer-
halb des Ordens, z.B. in dem zwar zisterziensischen, aber nach cluniazensischem Schema ent-
worfenen Heilsbronn, in Hamersleben und Talbürgeln, in der Liebfrauenkirche in Halberstadt.
Mit dieser Abtrennung wurde eine tiefere Absicht verfolgt. Sie ist ausgesprochen
in § 53 der Statuta congregationis CluniacensisStatutum est, ut pars illa novi mona-
sterii, quae ad sinistram partein post chorum sinistrum est, clericis vel laicis non pan-
datur nec quibuslibet, ut fieri solebat, praeter monachos ad eam aliquo tempore accessus
sit. . . . Causa huius instituti fuit, ut, quia fratres praeter veterem ecclesiam S. Petri2
non habebant, ubi quaedam sacra et secretiora ad religiosos homines pertinentia exer-
cere valerent, iam dictam illam novae ecclesiae partem sibi diebus et noctibus vindicarent;
ubi sancta et secreta orationum aromata Deo assidue accenderent . . . ac tribus saepe
1 Es sind das die "in den ersten 24 Jahren der Amisführung des Abts Petrus Venerabiiis (1122—56)
erlassenen, von dem Abt selbst zusammengestellten Bestimmungen. — Unsere Stelle zieht schon Hager zur
Erklärung der Seilenkapellen heran in der Beilage zur Allg. /eilung 1891, Nr. 351, Beilage-Nr. 297.
2 Die Kapelle des hl. Petrus, die schon vor Gründung des Klosters in Cluni existierte.
Dieser hohe Rang der Altäre ist einer der Gründe der Kegelmäßigkeit, mit der
die Seitenkapellen in den Tochterkirchen Clunis wiederkehren. Vor allen beweisend
ist St. Aurelius in Hirsau (siehe Abbildung 3), denn hier wurden mit Einführung der
strengen cluniazensischen Observanz an einem schon bestehenden Gebäude die Seiten-
kapellen nachgeholt und, da nach dem Ergebnis der Ausgrabung Klaibers die Apsiden
des Querschiffs bestehen blieben, ein unbequem enger Zugang zu ihnen und eine Ent-
stellung der Außenansicht der Ostpartie in den Kauf genommen. Neben den Grundriß
von Romainmötier (siehe Abbildung 4) gehalten, weist St. Aurelius schon vor dem Um-
bau die gleiche Zahl von Altarstellen auf. Wenn dennoch der Anbau von Seitenkapellen
für nötig erachtet wurde, so war das Motiv nicht so sehr die Vermehrung der Altäre,
als ihre Heranziehung an den Hauptaltar. Das liturgische Interesse ging auf Schaffung
weiterer «altaria principali altari proxima».
Aber die Seitenkapellen hatten noch einen weiteren, wichtigeren Zweck. In Cluni
gelangte man, wie wir
gesehen haben, vom
Hauptaltar in den
nördlichen Seitenraum
durch eine eiserne Türe.
^ Es bestanden also
"X\ durchlaufende Scheide-
)) mauern zwischen dem
Presbyterium und den
Kapellen. Später wurde
es bekanntlich Sitte,
_ (jjggg Wände in Arka-
den aufzulösen, aber
noch bis ius 12. Jahr-
hundert blieb da und
Abbildung 3. St. Aurelius in Hirsau. Aus: «Kunst- und Altertumsdenkmale dort die ursprüngliche
in Württemberg». Mit Genehmigung von Paul Neffs Verlag (Max Schreiber) geschlossene Form im
in Eßlingen a. N. ^ , , , n
Gebrauch, auch außer-
halb des Ordens, z.B. in dem zwar zisterziensischen, aber nach cluniazensischem Schema ent-
worfenen Heilsbronn, in Hamersleben und Talbürgeln, in der Liebfrauenkirche in Halberstadt.
Mit dieser Abtrennung wurde eine tiefere Absicht verfolgt. Sie ist ausgesprochen
in § 53 der Statuta congregationis CluniacensisStatutum est, ut pars illa novi mona-
sterii, quae ad sinistram partein post chorum sinistrum est, clericis vel laicis non pan-
datur nec quibuslibet, ut fieri solebat, praeter monachos ad eam aliquo tempore accessus
sit. . . . Causa huius instituti fuit, ut, quia fratres praeter veterem ecclesiam S. Petri2
non habebant, ubi quaedam sacra et secretiora ad religiosos homines pertinentia exer-
cere valerent, iam dictam illam novae ecclesiae partem sibi diebus et noctibus vindicarent;
ubi sancta et secreta orationum aromata Deo assidue accenderent . . . ac tribus saepe
1 Es sind das die "in den ersten 24 Jahren der Amisführung des Abts Petrus Venerabiiis (1122—56)
erlassenen, von dem Abt selbst zusammengestellten Bestimmungen. — Unsere Stelle zieht schon Hager zur
Erklärung der Seilenkapellen heran in der Beilage zur Allg. /eilung 1891, Nr. 351, Beilage-Nr. 297.
2 Die Kapelle des hl. Petrus, die schon vor Gründung des Klosters in Cluni existierte.